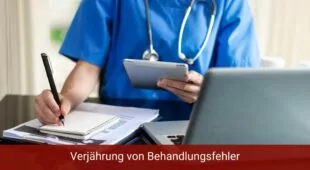OLG Nürnberg
Az.: 9 U 3995/93
vom 02.03.1994
Vorinstanz: LG Ansbach Az.: 3 0 743/92
Der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nürnberg hat durch Verhandlung vom 2. März 1994 für Recht erkannt:
I. Auf die Berufung des Beklagten wird das Endurteil des Landgerichts Ansbach vom 8. November 1993 abgeändert.
II. l. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger 12.500,- DM und 4 % Zinsen hieraus seit dem 12. Juni 1992 zu zahlen, und zwar Zug um Zug gegen Rückgabe des Pkw Typ CS l, Fahrzeugbrief
2. Es wird festgestellt, daß der Beklagte sich mit der Abholung des vorbezeichneten Pkw in Annahmeverzug befindet.
III. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
V. Der Beklagte trägt die Kosten beider Rechtszüge.
VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
VII. Der Wert der Beschwer wird für den Beklagten auf 12.500,- DM und für den Kläger auf 1,39 DM festgesetzt.
Beschluß :
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 12.500,- DM festgesetzt.
Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß § 543 Abs. l ZPO abgesehen.
Entscheidungsgründe:
Die Berufung ist zulässig (§§ 511, 511 a Abs. l, 516, 518, 519 ZPO). Sie hat in der Hauptsache keinen Erfolg; denn der Kläger verlangt zu Recht wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft die Wandelung. Anspruchsgrundlage sind die §§ 459 Abs. 2, 462, 467 S. l, 346 S. l BGB.
I. Der Beklagte erklärte dem Kläger bei Vertragsschluß, das Fahrzeug sei „technisch einwandfrei in Ordnung“. Das ist unstreitig.
1. Diese Erklärung enthält die Zusicherung einer Eigenschaft. Ob eine Angabe zur Kaufsache lediglich deren Beschreibung dient (§ 459 Abs. l BGB) oder ob mit ihr eine Eigenschaft zugesichert wird (§ 459 Abs. 2 BGB), ist – wie bei jeder Willenserklärung – nach anerkannten Auslegungsgrundsätzen (§§ 133, 157 BGB) in erster Linie danach zu beurteilen, in welchem Sinne sie der Geschäftsgegner als Erklärungsempfänger verstehen durfte. Eine Zusicherung liegt vor, wenn aus der Sicht des Käufers der Wille des Verkäufers erkennbar wird, die Gewähr für das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft zu übernehmen.
Im vorliegenden Fall erfolgte die Erklärung, das Fahrzeug sei „technisch einwandfrei in Ordnung“, nicht nur konkludent, sondern sogar ausdrücklich. Ihr durfte der Kläger bei verständiger Würdigung entnehmen, der Beklagte wolle jedenfalls für die Fahrbereitschaft und Verkehrssicherheit des Wagens und für alle Folgen deren Fehlens im Sinne einer Gewährübernahme einstehen (BGH NJW 1992, 170; 1993, 1854; NJW-RR 1991, 1401; OLG Karlsruhe NJW-RR 1993, 1138, 1139; Palandt-Putzo, 53. Aufl., § 459 BGB Rdnr. 15, 16, 30). Dem Kläger kam es nicht zuletzt wegen der Kaufpreishöhe vor allem darauf an, einen Wagen zu erwerben, der jedenfalls zum Zeitpunkt der Übergabe Verkehrs- und betriebssicher ist, dessen Zustand also die gefahrlose Benutzung im Straßenverkehr und damit die bedenkenfreie Inbetriebnahme erlaubt. Diese Erwartungshaltung war überdies mit Sicherheit auch dem Beklagten bewußt.
Der Annahme der Zusicherung steht nicht der Umstand entgegen, daß der Beklagte seiner Darstellung zufolge dem Kläger auch erklärte, er selbst habe den Wagen das letzte Jahr nicht benutzt, aber Herr würde nicht mit einem Fahrzeug fahren, „das technisch nicht in Ordnung ist“ (Bl. 30 d.A.). Dieser Zusatz brachte aus der maßgebenden Sicht des Klägers keine irgendwie geartete Einschränkung der Gewährübernahme zum Ausdruck; denn der Beklagte machte sich dem Kläger gegenüber gleichsam für die Zuverlässigkeit und den technischen Sachverstand noch im Prozeß als „sehr autokundig“ bezeichnete (Bl. 19 d.A.; vgl. OLG Frankfurt NZV 1990, 24). Dieser Sachverhalt ist folglich nicht mit den Fällen vergleichbar, in denen der Verkäufer lediglich nicht überprüfte Angaben des Vorbesitzers weitergibt, ohne sich diese zu eigen zu machen (vgl. OLG Celle NJW-RR 1988, 1135).
Der vereinbarte Gewährleistungsausschluß rechtfertigt keine andere Beurteilung. Er ist durch die Annahme einer Zusicherung nicht „entwertet“, sondern beschränkt sich auf etwaige Mängel, deren Fehlen nicht zugesichert ist. Im übrigen ist es Sache des Verkäufers, ob er Zusicherungen gibt oder nicht. Gibt er sie, muß er sich daran festhalten lassen (BGH NJW 1991, 1880; 1993, 1854).
2. Für die Bestimmung des Umfangs der gegebenen Zusicherung kommt es darauf an, wie der Kläger als Käufer die ihm gegenüber abgegebene Erklärung, das Fahrzeug sei „technisch einwandfrei in Ordnung“
(Bl. 30 d.A.), bei verständiger Würdigung aller Umstände verstehen durfte. Wird ein Fahrzeug – wie hier – zum sofortigen Gebrauch auf öffentlichen Straßen verkauft, so kann der Käufer im allgemeinen erwarten, daß es sich in einem Zustand befindet, der seine gefahrlose Benutzung im Straßenverkehr erlaubt. In seinem schutzwürdigen Vertrauen auf die gefahrlose Benutzbarkeit des Fahrzeuges im Straßenverkehr wird der Käufer jedenfalls dann enttäuscht, wenn das Fahrzeug bei einer an der „Richtlinie für die Beurteilung von Mängeln bei Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen nach § 29 StVZO und Anlage VIII, Nr. 1.2 i.V.m. Nr. 3.1, 3.3 und 4.2 StVZO“ vom 17. Dezember 1988 (VerkBl S. 173 Nr. 52) ausgerichteten Überprüfung als „verkehrsunsicher“ eingestuft werden müßte, weil es mit gravierenden Mängeln behaftet ist, die zu einer unmittelbaren Verkehrsgefährdung führen können (BGH NJW 1993, 1854, 1855; vgl. auch: BGH NJW 1978, 2241). Besondere Umstände, die hier ein anderes Verständnis des Klägers von der Zusicherung „technisch einwandfrei in Ordnung“ begründen könnten, sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Zwar war der Wagen, ein sogenannter Oldtimer, bei Vertragsschluß nahezu 18 Jahre alt. Jedoch verlangte der Beklagte einen relativ hohen Betrag als Kaufpreis. Im Vertragsformular ist von der Überholung des Motors, und zwar des Zylinderkopfes, die Rede. Diese schriftliche Zusicherung und vor allem die Kaufpreishöhe verstärkten den Eindruck des Klägers, ein jedenfalls bei Übergabe verkehrssicheres Fahrzeug zu erwerben.
Mithin kommt es nicht mehr darauf an, daß der Zeuge hat: „Der Beklagte sagte, da das Fahrzeug dem Alter entsprechend in einem sehr guten Zustand sei und auch beim TÜV vorgefahren werden könne“ (Bl. 35 d.A).
II. Das Fahrzeug war bei Übergabe am 11. Juni 1992 (Bl. 4 d.A.) nicht verkehrssicher.
l. Der Motor verlor in einer die Verkehrs- und Betriebssicherheit gefährdenden Stärkeöl. Aus der Kraftstoffpumpe trat laufend Öl aus. Das Ölfiltergehäuse war undicht, was ebenfalls einen starken Ölverlust zur Folge hatte. Auch am Ölmeßstab war der Motor undicht.
Die ausgeprägten Ölundichtigkeiten waren bereits bei Fahrzeugübergabe vorhanden; denn sie sind wegen ihrer Vielzahl der Abschluß eines sich über Monate hinziehenden und eine Fahrtstrecke von mehreren tausend Kilometern erfordernden Prozesses. Der Kläger legte den Wagen bereits am 26. Juni 1992 still. Das ergibt eine entsprechende Eintragung im Fahrzeugbrief. Die zahlreichen Undichtigkeiten können nicht erst in den zwei Wochen nach Obergabe des Wagens auf getreten sein, und zwar auch nicht bei starker Beanspruchung des Fahrzeugs. Überdies hatte der Kläger bereits mit dem Schreiben seiner nunmehrigen Prozeßbevollmächtigten vom 15. Juni 1992, also schon am vierten Tag nach der Übergabe, u.a. behauptet, daß die Ölwanne undicht sei und der Motor „unverhältnismäßig viel Öl“ verliere. Es spricht nichts dafür, daß die Rüge nicht zugetroffen haben könnte.
Der Senat folgt mit diesen Feststellungen dem Gutachten des Sachverständigen vom 29. Januar 1992 (Bl. 43 – 73 d.A.). Zweifel an der Sachkunde des Sachverständigen sind umso weniger berechtigt, als mit der Feststellung des Ausmaßes und der Ursache von Motorölverlusten keine besonders schwierigen technischen Fragen beantwortet werden. Es liegt auf der Hand, daß es insoweit entgegen der Ansicht des Klägers auch nicht darauf ankommt, ob es sich um „normale Gebrauchsfahrzeuge“ oder um sogenannte „Klassiker/Oldtimer“ (Bl. 139 d.A.) handelt. Irgendwelche Widersprüche enthalten die Ausführungen des Sachverständigen nicht. Sie waren inhaltlich klar, fachlich stichhaltig und vollständig. Da das für irgendwelche Zweifel keinen Raum lassende Gutachten einschließlich der mündlichen Erläuterungen auch den Senat überzeugt, war die beantragte Erholung eines weiteren Gutachtens nicht veranlaßt (§ 412 ZPO). Der Sachverständige hat sich im Rahmen der Anhörung zudem mit den Einwendungen des Beklagten gegen sein Gutachten befaßt und überzeugend zu ihnen Stellung genommen. Der Kläger hat mit seinem bloßen Hinweis darauf, daß der Sachverständige „nur“ Gutachter für „normale“ Gebrauchsfahrzeuge sei (Bl. 139 d.A.), die Überlegenheit des Fachwissens und der Forschungsmittel eines in erster Linie sogenannte „Klassiker/Oldtimer“ (Bl. 139 d.A.) begutachtenden Sachverständigen nicht ausreichend dargetan (§ 286 ZPO; BGH LM § 412 ZPO Nr. 2 Bl. l R; VersR 1985, 188; 1988, 801; NJW 1982, 2874; 1986, 1928, 1930; 1987, 442; 1988, 762, 763; NJW-RR 1988, 763, 764, 1429, 1430; BayObLG NJW 1986, 2892, 2893; OLG München NJW-RR 1986, 1142; 1991, 17; Thomas-Putzo, 18. Aufl., § 412 ZPO Rdnr. l, 3; Baumbach-Lauterbach-Albers-Hartmann, 52. Aufl., § 286 ZPO Rdnr. 53, 54, § 412 ZPO Rdnr. l, 2, 3, 4).
Die Möglichkeit eines plötzlichen, starken Ölaustritts als Folge einer Motorüberhitzung hat im übrigen der Sachverständige bei seiner Anhörung am 29. September 1993 durchaus bedacht (S. 2 des Protokolls; Bl. 93 d.A.). Daß es schon am Tage der Fahrzeugübergabe oder im Laufe der folgenden 3 Tage zu einer nicht erkennbaren Motorüberhitzung kam, weil z.B. der Thermostat hängen geblieben war (Bl. 127, 138 d.A.), ist indes eine rein theoretische Möglichkeit, für die hier auch unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters nichts spricht und die deshalb außer acht gelassen werden kann. Der Beklagte übersieht, daß die nach § 286 ZPO erforderliche, vom Senat im vorliegenden Falle gewonnene Überzeugung vom starken Ölaustritt bereits zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe keine absolute oder unumstößliche Gewißheit und auch keine „an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“ erfordert, sondern nur einen für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewißheit, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGH NJW 1970, 946, 948; 1982, 2874, 2875; 1989, 2948, 2949; VersR 1977, 721; 1992, 58, 59; Baumbach-Lauterbach-AIbers-Hartmann, 52. Aufl., § 286 ZPO Rdnr. 16, 18). Entgegen der Ansicht des Beklagten rechtfertigt die Beurteilung, weshalb schon aus diesem Grunde dessen erneute Vernehmung nicht veranlaßt ist (§ 398 Abs. l ZPO). Der Zeuge fuhr den Wagen seiner Aussage zufolge nur bis „etwa“ November 1991 (Bl. 33 d.A.), weshalb er verläßliche Angaben zum Zustand des Fahrzeugs bei dessen Übergabe an den Kläger nicht machen kann. Daß der Verkäufer noch selbst den Wagen bis zu dessen Stillegung am 19. November 1991 benutzte, ist gerade keine theoretische Möglichkeit, die außer acht gelassen werden könnte – Der Beklagte hat nämlich bei seiner Argumentation im Berufungsverfahren aus den Augen verloren, daß er in erster Instanz bezüglich des vom Sachverständigen festgestellten Ölaustritts an der Kraftstoffpumpe und am Aufnahmeflansch des Ölfilters vortrug, er habe den Kläger vor Abschluß des Kaufvertrages darauf hingewiesen, „daß öl im Motorraum zu sehen war“, habe also auf die Ölundichtigkeiten aufmerksam gemacht (Schriftsätze vom 18. Februar 1993, Seite l, Bl. 75 d.A., und 9. März 1993, S. l, Bl. 82 d.A.) . Da er sich die Aussage des Zeugen zu eigen macht, der zufolge das Fahrzeug, so lange dieser es fuhr, nur „leicht“ öl verlor (Bl. 32, 127 d.A.), muß er unter Berücksichtigung seines erstinstanzlichen Vertrags noch selbst den Wagen gefahren haben. Zu diesem Schluß zwingt auch die weitere der Lenkgeometrie“ nichts „Negatives“ aufgefallen (Bl. 33 d.A.). Der Sachverständige hat indes anläßlich verschiedener Fahrzeugversuche schon nach kurzer Fahrtstrecke festgestellt, daß das Fahrzeug je nach Fahrbahnquerneigung und Lenkradeinschlag „ausgeprägt“ nach links oder rechts zieht. Das Auto hat keinen exakten Geradeaus-Lauf, sondern zieht häufig stark nach rechts. Die Vorderachsgeometrie ist also so extrem verstellt, daß sowohl beim Fahren als auch beim Bremsen das Fahrzeug nicht in der Spur gehalten werden kann. Dieser Mangel war bereits bei Übergabe des Fahrzeugs an den Kläger vorhanden. Zu diesem Schluß zwingt das ausgeprägte Verschleiß- bzw. Abriebbild der Reifen an der Vorderachse (Bl. 55 – 57, 93 d.A.). Auch mit dieser Feststellung folgt der Senat dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen. Überdies zieht der Beklagte insoweit die Untersuchungsergebnisse und Schlußfolgerungen des Sachverständigen nicht in Zweifel; denn er beruft sich gerade darauf, daß er den Kläger bei Vertragsschluß auf die Notwendigkeit der Spureinstellung hingewiesen habe und daß überdies auch ein technischer Laie hätte erkennen können, „daß mit der Lenkgeometrie irgend etwas nicht 100%ig stimmte“ (Bl. 76, 126 d.A.). Dann aber muß der Beklagte, da er sich die Aussage seines Freundes zu eigen macht, dem an der Lenkgeometrie gerade nichts auffiel, mit dem Fahrzeug vor der Stillegung noch eine gehörige Strecke gefahren sein.
Es kann dahinstehen, ob der Beklagte den Kläger vor Vertragsschluß auf öl im Motorraum, also auf Ölundichtigkeiten, hinwies; denn allein mit einem solchen Hinweis schränkte er nämlich nicht die gegebene Zusicherung der Verkehrssicherheit ein, daß sich der Wagen jedenfalls in einem Zustand befindet, der seine gefahrlose Benutzung im Straßenverkehr erlaubt. Überdies haben die vom Beklagten benannten Zeugen einen solchen Hinweis nicht bestätigt. Der Zeuge war bei den Vertragsverhandlungen nicht zugegen. Der Zeuge versicherte:
„Über Ölverlust an dem Fahrzeug wurde nicht gesprochen……Soweit ich mich erinnere, wurde über eine kleine Undichtigkeit am Motor nicht gesprochen“ (Bl, 34 d.A.).
Der Zeuge hat ausgesagt: „Über eine Undichtigkeit am Motor wurde nicht gesprochen“ (Bl. 35 d.A.).
2. Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, daß das Fahrzeug bereits bei Übergabe an den Kläger auch deshalb nicht verkehrssicher war, weil die Vorderachsgeometrie extrem verstellt ist, weil also der Wagen beim Fahren wie beim Bremsen nicht in der Spur gehalten werden kann.
Der Beklagte behauptet, er habe den Kläger bei Vertragsschluß auf die Notwendigkeit der Spureinstellung hingewiesen (Bl. 76 d.A.). Der von ihm hierfür benannte Zeuge hat einen solchen Hinweis aber nicht bestätigt. Der widerspruchsvolle Sachvortrag des Beklagten rechtfertigt überdies den Schluß, daß der Beklagte den Kläger vor oder bei Vertrags Schluß auf die Notwendigkeit der Spureinstellung nicht aufmerksam machte; denn noch in der Klageerwiderung bestritt der Beklagte, „daß bei Abschluß des Kaufvertrages die Lenkgeometrie nicht mehr stimmte“, was er auch zu begründen versuchte (Schriftsatz vom 11. August 1992, S. 6; Bl. 13 d.A.). Merkte er aber nicht, daß die Vorderachsgeometrie extrem verstellt ist. kann er ein solches Wissen auch dem Kläger nicht unterstellen. Selbst die Offensichtlichkeit dieses Mangels rechtfertigt nicht den Schluß, daß der Kläger den Mangel bei Abschluß des Kaufvertrages kannte. Nur das positive Wissen, das der Beklagte beweisen muß, würde dessen Haftung für das Fehlen der zugesicherten Eigenschaft der Verkehrssicherheit ausschließen (§ 460 BGB; BGH NJW 1993, 1854, 1855; Palandt-Putzo, 53. Aufl., § 460 BGB Rdnr. 5, 6. 8, 9).
3. Ob weitere die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Mängel vorliegen und ob der Zylinderkopf überholt worden ist, kann dahinstehen.
Es kann auch auf sich beruhen, was es kosten würde, das Fahrzeug in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Auf eine Nachbesserung braucht der Kläger sich nämlich nicht einzulassen. Im Gegensatz zum Werkvertragsrecht kennt das Kaufrecht kein Nachbesserungsrecht des Verkäufers. Ein solches ist auch hier nicht vereinbart.
III.
Der Beklagte befindet sich gemäß § 295 bgb in Annahmeverzug, weil er die Abholung des Fahrzeugs verweigert, obwohl ihm der Kläger mit dem Schreiben seiner Prozeßbevollmächtigten vom 15. Juni 1992 dazu eine Frist bis 25. Juni 1992 gesetzt hatte (BGH NJW 1983, 1479, 1480; Palandt-Heinrichs, 53. Aufl., § 269 BGB Rdnr. 15. § 295 BGB Rdnr. 5; Palandt-Putzo, 53. Aufl., § 467 BGB Rdnr. 4, 19). An der Feststellung des Annahmeverzugs besteht im Hinblick auf § 756 ZPO auch ein Rechtsschutzinteresse (OLG Köln MDR 1991, 260; Thomas-Putzo, 18. Aufl., § 756 ZPO Rdnr. 8; Baumbach-Lauterbach-AIbers-Hartmann, 52. Aufl., § 756 ZPO Rdnr. 10; Zöller-Stöber, 18. Aufl., § 756 ZPo Rdnr. 10; Christmann DGVZ 1990, l).
Der Zinsanspruch beruht auf den §§ 467 S. l, 347 S. 3, 246 BGB. Entgegen der Ansicht des Landgerichts setzt die Zinspflicht aber erst mit Beginn des der Kaufpreiszahlung folgenden Tages ein, also erst mit Beginn des 12. Juni 1992 (Bl. 4, 106 d.A.); denn der Rechtsgedanke des § 187 BGB rechtfertigt es, den Zinslauf erst an dem der Zahlung folgenden Tag beginnen zu lassen (vgl. BGH NJW-RR 1990, 518, 519; OLG Karlsruhe NJW 1988, 74, 75; Palandt-Heinrichs, 53. Aufl., § 187 BGB Rdnr. l, § 284 BGB Rdnr. 27; Zimmermann JuS 1991, 229, 232). Folglich weist der Senat hinsichtlich eines Zinstages die Klage ab.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10 ZPO.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 546 Abs. l ZPO), weshalb die Anordnung einer Sicherheitsleistung unterbleibt (§§ 711, 713 ZPO).
Die Festsetzung des Wertes der Beschwer beruht auf den §§ 546 Abs. 2 S. l, 3 ZPO.