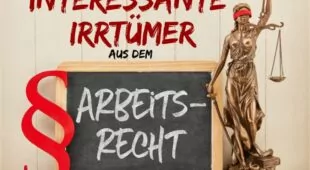AG Düsseldorf – Az.: 51 C 505/18 – Urteil vom 31.01.2019
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin zu 1. weitere 300,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.09.2018, an den Kläger zu 2. weitere 300,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.09.2018, an die Klägerin zu 3. weitere 300,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.09.2018 und an die Klägerin zu 4. weitere 300,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.09.2018 zu zahlen
Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung eine Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages leistet.
Tatbestand
Die Kläger hatten bei der Beklagten einen Flug von Florida nach Düsseldorf für den 16.08.2018 gebucht.
Der Flug sollte am 17.08.2018 um 9:25 Uhr den Zielflughafen erreichen, tatsächlich war dies jedoch erst um 12:48 Uhr der Fall.
Die Kläger verlangten von der Beklagten mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 26.08.2018 unter Fristsetzung bis zum 15.09.2018 jeweils eine Ausgleichszahlung i n Höhe von 600,00 EUR nach der EG-VO 261/2004.
Hierauf reagierte die Beklagte nicht, so dass der Prozessbevollmächtigte der Kläger sich unter dem 30.09.2018 erneut an die Beklagte wandte und eine Zahlungsfrist bis zum 02.10.2018 setzte. Zugleich machte er außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten unter dem Gesichtspunkt des Verzuges in Höhe von 500,02 EUR geltend.
Auch hierauf erfolgte keine Zahlung der Beklagten, so dass die Kläger ihren geltend gemachten Anspruch mit der vorliegenden Klage weiterverfolgen.
Die Beklagte anerkannte mit der Klageerwiderung auf die Hauptforderungen der Kläger jeweils einen Betrag in Höhe von 300,00 EUR zzgl. der geltend gemachten Zinsen.
Unter dem 02.01.2019 erging daraufhin insoweit ein Teil-Anerkenntnisurteil.
Die Kläger sind der Auffassung, dass ihnen auch die weitere geltend gemachte Ausgleichszahlung zustehe.
Nachdem sie in der Hauptverhandlung den geltend gemachten Anspruch auf Ausgleich von außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten zurückgenommen haben, beantragen sie wie erkannt
Die Beklagte beantragt, die (verbliebene) Klage abzuweisen.
Sie ist der Auffassung, dass ihr ein Kürzungsrecht in Höhe von 50% nach Art. 7 Abs. 2 EG-VO 261/2004 zustehe, da der streitgegenständliche nicht später als vier Stunden sein Ziel erreicht habe.
Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die gewechselten Schriftsätze und den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die verbliebene Klage ist zulässig und begründet.
1.
Der Anspruch der Kläger auf die Hauptforderung ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. c i. V. m. Art. 7 Abs. 1 S. 1. lit. c EG-VO 261/2004.
Nach dem unstreitigen Vortrag der Kläger erreichten sie ihr Reiseziel mit einer Verspätung von über drei Stunden.
Somit steht den Klägern grundsätzlich der geltend gemachte Ausgleichsanspruch zu. Ausschlussgründe nach Art. 5 Abs. 1 lit. c i) – iii) EG-VO 261/2004 liegen ebenfalls unbestritten nicht vor.
a.
Die Höhe des Ausgleichsanspruchs ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 S. 1. lit. c EG-VO 261/2004 und beträgt jeweils 600,00 EUR.
b.
Die Beklagte kann sich dabei nicht auf eine Kürzung dieses Betrages um 50% auf jeweils 300,00 EUR nach Art. 7 Abs. 2 lit. c EG-VO 261/2004 berufen.
aa.
Eine unmittelbare Anwendung dieser Vorschrift ist nicht möglich, diese Vorschrift voraussetzt, dass „gemäß Art. 8 eine anderweitige Beförderung zu ihrem Endziel mit einen Alternativflug“ erfolgt und damit erkennbar (zuvor) eine Nichtbeförderung oder Annullierung voraussetzt. Bei einer nur verspätet durchgeführten Beförderung liegt aber eine Annullierung oder Nichtbeförderung nicht vor, da der Fluggast ist im Rahmen des geplanten Fluges befördert worden ist.
bb.
Ob die Berechtigung zur Kürzung der Ausgleichsleistung sich aufgrund einer analogen Anwendung des Art. 7 Abs. 2 lit. c EG-VO 261/2004 ergeben kann, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt.
Eine solche ist nach Auffassung des Gerichts jedoch zu vermeinen.
(1.)

Der Verordnungsgeber hat in der EG-VO 261/2004 eine Ausgleichszahlung nach dem dortigen Art. 7 Abs. 1 für sog. große Verspätungen gar nicht vorgesehen. Einen entsprechenden Anspruch hat der EuGH erst in seinem Urteil vom 19.11.2009 (C-402 und C-432) im Rahmen einer Rechtsfortbildung entwickelt mit dem Argument, dass die Beeinträchtigungen eines Fluggastes bei einer Verspätung ab drei Stunden denen einer Annullierung gleichstehen (aaO, Rz. 61).
Dies rechtfertigt jedoch nicht den Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 2 EG-VO 261/2004 ebenfalls auf Fälle der großen Verspätung zu erweitern.
Zum einen wäre, anders als Art. 7 Abs. 1 EG-VO, Art. 7 Abs. 2 EG-VO nur sehr eingeschränkt anwendbar: Bei Kurzstreckenflügen nach lit. a ist schon tatbestandlich eine Halbierung nicht denkbar, da die Verspätung einerseits nicht mehr als zwei aber andererseits zumindest drei Stunden betragen müsste; ebenso kann eine Verspätung bei der Mittelstrecke gemäß lit. b nicht weniger als drei Stunden ausmachen und gleichzeitig zumindest drei Stunden; lediglich bei einer Ankunftsverspätung von exakt 180 Minuten könnte eine Reduzierung anwendbar sein; bei Langstreckenflügen im Sinne von lit. c wäre im Falle einer großen Ankunftsverspätung eine Kürzung der Ausgleichsleistung um 50% zumindest dann anzuwenden, wenn die tatsächliche Ankunftszeit eines Fluges zwar drei Stunden oder mehr verspätet ist, nicht aber mehr als vier.
Es ist daher nicht nachvollziehbar, weshalb die ausführenden Luftfahrtunternehmen nur bei einer bestimmten Art von Flügen eine Privilegierung erhalten – und im Umkehrschluss Reisende eine Anspruchskürzung hinnehmen – sollten. Eine solche Differenzierung ist nicht sachgerecht und stellt Reisende, die von einer Verspätung von drei Stunden und mehr betroffen sind, unter Umständen nicht mit Reisenden gleich, welche von einer Annullierung oder Nichtbeförderung betroffen sind.
Eine solche (volle) Gleichstellung hat der EuGH in seiner zitierten Entscheidung aber beabsichtigt.
(2.)
Es fehlt auch an einer planwidrigen Regelungslücke.
Die Regelungslücke, welche die Voraussetzung für eine doppelt analoge Anwendung des Art. 7 Abs. 2 EG-VO ist nicht planwidrig. Denn eine Regelungslücke ist erst durch die Rechtsfortbildung des EuGH in der zitierten Entscheidung entstanden. Denn anders als bei der sog. großen Verspätung ergibt sich in den Fällen der Annullierung und der Nichtbeförderung im Hinblick auf mögliche Ausgleichszahlungen ein geschlossener Regelungsapparat (Art. Abs. 3 und Art. 5 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 7 Abs. 1 und 2).
Gegen eine Planwidrigkeit der dadurch entstandenen Regelungslücke spricht zudem, dass der Verordnungsgeber seit der Entscheidung des EuGH keine konkreten Anstrengungen unternommen hat, welche in eine inhaltliche Änderung der EG-VO 261/2004 mündeten.
(3.)
Soweit der EuGH in der zitierten Entscheidung eine analoge Anwendung Art. 7 Abs. 2 lit. c EG-VO 261/2004 auf die Fälle von großen Verspätungen angenommen hat, kann dies auch inhaltlich nicht überzeugen. Er stellt dabei allein auf das Merkmal der Verspätung ab. Tatsächlich soll mit dieser Vorschrift jedoch ein finanzieller Anreiz bei den Luftfahrtunternehmen geschaffen werden Fluggäste bei Annullierung und Nichtbeförderung im Rahmen eines Alternativfluges innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters doch noch zu befördern.
Da die Sanktion Ausgleichszahlung bei der großen Verspätung auf eben dieser beruht, würde dies darauf hinauslaufen, dass innerhalb der großen Verspätung noch einmal hinsichtlich der Höhe des Ausgleichsanspruchs differenziert wird. Konsequenterweise müsste man dann Reisenden auch eine Erhöhung des Ausgleichsanspruchs bei einer Verspätung zubilligen, die weit über drei Stunden hinausgeht.
Das Vorstehende zeigt, dass eine analoge Anwendung von Art. 7 Abs. 2 EG-VO 261/2004 weder teleologisch noch systematisch sinnvoll begründbar ist.
Colorandi causa sei angemerkt, dass die Beklagte, die sich vorliegend auf die analoge Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 2 EG-VO 261/2004 hier beruft, in anderen Verfahren vor dem hiesigen Gericht geführten Verfahren regelmäßig die Auffassung vertreten hat, dass dem EuGH die Kompetenz zur Rechtsfortbildung hinsichtlich der Anwendbarkeit von Art. 7 Abs.1 EG-VO 261/2004 auf große Verspätungen fehle.
2.
Der Zinsanspruch ergibt sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges, die Zinshöhe folgt aus §§ 247 Abs. 2, 288 Abs. 1 BGB.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Soweit die Kläger die Klage hinsichtlich des Klageantrages zu 2. zurückgenommen haben, hatte dies keine Auswirkungen auf die Kostenentscheidung, da der Klageantrag zu 2. als Nebenforderung nicht im vorliegenden Fall in den Streitwert einfließt.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit fußt auf §§ 709, 711 ZPO.
Der Streitwert wird auf:
2.400,00 EUR bis zum 02.01.2019
1.200,00 EUR ab dem 03.01.2019
festgesetzt.