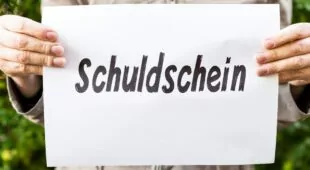BGH, Az.: VI ZR 213/84, Urteil vom 18.03.1986
Tatbestand
Die Klägerin hatte Anfang Juli 1982 bei der Zweitbeklagten einen neuen PKW gekauft. Als sie am 26. Juli 1982 die Lenkung des Wagens beanstandete, unternahm der Erstbeklagte, der als Kraftfahrzeugmeister bei der Zweitbeklagten tätig war, mit der Klägerin eine Probefahrt, um die Lenkung zu überprüfen. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h bremste er stark ab, worauf sich der Wagen überschlug und schwer beschädigt wurde.
Mit der Klage verlangt die Klägerin Zahlung von 16.588,45 DM als Ersatz für die Beschädigung ihres Fahrzeugs. Die Beklagten bestreiten ihre Haftung dem Grunde nach nicht, sind jedoch der Auffassung, die Klägerin müsse ihre Vollkaskoversicherung in Anspruch nehmen. In Höhe der Selbstbeteiligung von 650 DM haben sie die Klage anerkannt und sich ferner bereit erklärt, Einbußen der Klägerin wegen des Verlustes des Schadensfreiheitsrabatts und von Ansprüchen auf Beitragsrückerstattung zu übernehmen.
Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage bis auf einen Teil der Zinsforderung stattgegeben. Mit der Revision verfolgt der Erstbeklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter. Über das Vermögen der Zweitbeklagten ist nach Erlaß des Berufungsurteils das Konkursverfahren eröffnet worden, so daß der Rechtsstreit insoweit unterbrochen ist.
Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es könne offenbleiben, ob die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) erfüllt seien, wonach der Kaskoversicherer gegen den berechtigten Fahrer und bestimmte andere Personen keinen Rückgriff nehmen könne, wenn sie den Versicherungsfall weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt hätten. Auch wenn hiernach ein Rückgriff der Kaskoversicherung gegen die Beklagten ausgeschlossen sei, sei die Klägerin nicht nach § 254 Abs. 2 BGB verpflichtet, ihre Kaskoversicherung in Anspruch zu nehmen. Es sei nicht der Zweck der Kaskoversicherung, dem Schädiger das Haftungsrisiko abzunehmen. § 15 Abs. 2 AKB schütze den Schädiger nur vor der Inanspruchnahme durch den Kaskoversicherer, nicht aber vor der Inanspruchnahme durch den Geschädigten selbst. Außerdem würde es zu einer ungerechtfertigten Besserstellung des Schädigers führen, wenn er nur die Schäden des nicht kaskoversicherten Geschädigten zu ersetzen hätte.
II. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.
1. Im Normalfall ist es für den Schädiger nicht von Interesse, ob der Geschädigte seine Kaskoversicherung in Anspruch nimmt oder nicht. Der Schädiger wird durch die Erstattung des Schadens seitens der Kaskoversicherung nicht entlastet, weil diese gemäß § 67 Abs. 1 VVG bei ihm Rückgriff nimmt. Dieser Rückgriff ist dem Kaskoversicherer jedoch nach § 15 Abs. 2 AKB in bestimmten Fällen verwehrt. Hiernach können Ersatzansprüche des Versicherungsnehmers, die nach § 67 VVG auf den Versicherer übergegangen sind, gegen den berechtigten Fahrer und andere in der Haftpflichtversicherung mitversicherte Personen sowie gegen den Mieter oder Entleiher nur geltend gemacht werden, wenn von ihnen der Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. Diese Bestimmung ist zum Schutz des berechtigten Fahrers und der weiteren dort genannten Personen mit Wirkung vom 1.1.1971 in die Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) eingefügt worden (vgl. Bruck/Möller/Johannsen, VVG, 8. Aufl., Bd. V Anm. J 177). Der bis zur Einfügung des § 15 Abs. 2 AKB bestehende Rechtszustand, wonach der berechtigte Fahrer auch bei leichter Fahrlässigkeit dem Rückgriff des Kaskoversicherers nach § 67 Abs. 1 VVG ausgesetzt war, wurde weithin als unbefriedigend und unbillig empfunden (Johannsen aaO; v. Hippel NJW 1966, 1012). Denn der berechtigte Fahrer ist zwar wegen der von ihm bei Gebrauch des Kraftfahrzeuges angerichteten Schäden grundsätzlich in der für das Kraftfahrzeug bestehenden Haftpflichtversicherung mitversichert (§ 10 Nr. 2 c AKB), so daß er prinzipiell von einer Haftung freigestellt ist. Dagegen ist er wegen des in dieser Versicherung nach § 11 Nr. 3 AKB bestehenden Risikoausschlusses bei Beschädigung des Kraftfahrzeugs selbst, auf das sich die Haftpflichtversicherung bezieht, nicht geschützt. Dieser Risikoausschluß verweist den Eigentümer oder Halter des Kraftfahrzeugs darauf, sich wegen der Fahrzeugschäden bei einer Kaskoversicherung abzusichern und dient so der Abgrenzung des versicherten Wagnisses der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gegenüber der Kaskoversicherung. Wegen der Abhängigkeit des Mitversicherten von dem Versicherungsvertrag, der ihn nur als begünstigten Dritten schützt (§ 328 BGB), hat dies zur Folge, daß auch der mitversicherte Fahrer insoweit von einer Haftungsfreistellung durch die Haftpflichtversicherung ausgenommen ist. Das führte bis zur Einführung des § 15 Abs. 2 AKB dahin, daß der berechtigte Fahrer auch in den Fällen, in denen der Kraftfahrzeugeigentümer – dem Anliegen des damals noch in § 11 Nr. 6 AKB a.F. verankerten Risikoausschlusses folgend – das Risiko eines Fahrzeugschadens in einer Kaskoversicherung abgedeckt hatte, gegen dieses sein Haftungsrisiko keinen Versicherungsschutz besaß. Dem sozialen Anliegen aus diesem Rechtszustand hat § 15 Abs. 2 AKB Rechnung getragen. Indem der berechtigte Fahrer und die weiteren Personen durch § 15 Abs. 2 AKB vor einem Rückgriff der Kaskoversicherung geschützt werden, ist faktisch eine Versicherung für fremde Rechnung geschaffen worden (Johannsen aaO unter Bezugnahme auf Bruck/Möller/Sieg, VVG, 8. Aufl., Anm. 13 vor §§ 74 bis 80 VVG).
2. Diese Stellung des berechtigten Fahrers führt nach Auffassung des erkennenden Senats indes nicht dazu, daß der kaskoversicherte Fahrzeugeigentümer in jedem Fall einer leicht fahrlässigen Beschädigung seines Fahrzeugs durch einen berechtigten Fahrer verpflichtet wäre, seine Kaskoversicherung in Anspruch zu nehmen und den Fahrer damit von seiner Haftung freizustellen. Aus § 254 Abs. 2 BGB kann sich eine solche Verpflichtung nicht ergeben. Denn durch die Inanspruchnahme der Kaskoversicherung wird der Schaden nicht gemindert, sondern nur vom Schädiger auf den Versicherer verlagert. Grundlage der Verpflichtung, den Schaden durch die Kaskoversicherung regulieren zu lassen und damit von einer Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs gegen den Schädiger abzusehen, kann nur der Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB) sein. Ob eine solche Verpflichtung zur Inanspruchnahme der Kaskoversicherung im Einzelfall besteht, beurteilt sich auf der Grundlage der Rechtsbeziehungen, die zwischen dem geschädigten Fahrzeugeigentümer und dem berechtigten Fahrer bestehen. Hat beispielsweise der Eigentümer sich dem Fahrer gegenüber vertraglich zum Abschluß einer Kaskoversicherung verpflichtet, so muß er diese Versicherung auch im Schadensfall in Anspruch nehmen (so zutreffend Johannsen aaO Anm. J 178). Entgegen der Auffassung von Johannsen sind auch noch andere Fallgestaltungen denkbar, in denen der Geschädigte sich an seine Kaskoversicherung halten muß, so etwa wenn er auf eine entsprechende Frage des Fahrers vor Antritt der Fahrt erklärt hat, der Wagen sei kaskoversichert, oder wenn der Fahrer sich auf Bitten des Eigentümers und in dessen Interesse an das Steuer des Wagens gesetzt hat.
3. Im vorliegenden Fall ist dagegen eine Verpflichtung der Klägerin zur Inanspruchnahme ihrer Kaskoversicherung nicht gegeben. Die Klägerin hat ihr Fahrzeug in die Obhut der Zweitbeklagten gegeben, damit diese ihrer kaufvertraglichen Gewährleistungspflicht nachkommen und den von der Klägerin behaupteten Mangel an der Lenkung des Wagens beheben konnte. Dabei durfte die Klägerin darauf vertrauen, daß die Zweitbeklagte für eine eventuelle Beschädigung des Fahrzeugs voll einstehen werde und daß sie insoweit – wie dies allgemein üblich ist – durch eine entsprechende betriebliche Haftpflichtversicherung vorgesorgt hatte. Der Erstbeklagte hat sich in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer der Zweitbeklagten in Erfüllung der von dieser übernommenen Werkstattaufgaben auf eine entsprechende Aufforderung des persönlich haftenden Gesellschafters der Zweitbeklagten hin an das Steuer des Wagens der Klägerin gesetzt. Weder er noch die Zweitbeklagte haben dabei in irgendeiner Weise darauf vertraut, daß der Wagen der Klägerin kaskoversichert sei. Bei dieser Sachlage war die Klägerin nicht nach Treu und Glauben verpflichtet, ihre Kaskoversicherung im Schadensfall in Anspruch zu nehmen.
Auch als die Beklagten der Klägerin nach Eintritt des Schadens mitteilten, sie seien nicht haftpflichtversichert, war die Klägerin nicht gehalten, ihre Kaskoversicherung einzuschalten. Der Zweitbeklagten hätte dies ohnehin nichts genutzt. Sie wäre dem Rückgriff der Kaskoversicherung nach § 67 VVG ausgesetzt gewesen, weil sie nicht zum Kreis der in § 15 Abs. 2 AKB aufgeführten Personen gehörte. Sie war weder in der Haftpflichtversicherung mitversichert noch Mieter oder Entleiher des Fahrzeugs. Daß die Klägerin den Erstbeklagten mitverklagt hat, als die Zweitbeklagte sich weigerte, den berechtigten Schadensersatzanspruch der Klägerin zu erfüllen, ist ihr ebenfalls nicht als unzulässige Rechtsausübung vorzuwerfen. Denn die Klägerin konnte davon ausgehen, daß die Zweitbeklagte den Erstbeklagten unter dem Gesichtspunkt der gefahrgeneigten Arbeit von der Haftung gegenüber der Klägerin freizustellen hatte. Daß die Zweitbeklagte später einmal in Konkurs fallen könnte, brauchte die Klägerin nicht in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Daß mittlerweile über das Vermögen der Zweitbeklagten das Konkursverfahren eröffnet ist und die Zweitbeklagte daher ihrer Freistellungsverpflichtung wahrscheinlich nicht mehr nachkommen kann, ist – sofern es überhaupt revisionsrechtlich berücksichtigt werden kann (vgl. § 561 Abs. 1 ZPO) – ebenfalls nicht geeignet, die Rechtsbeziehungen zwischen der Klägerin und dem Erstbeklagten unter dem Gesichtspunkt des § 242 BGB abweichend zu beurteilen. Denn für diese Rechtsbeziehungen sind grundsätzlich die Verhältnisse bei Antritt der Fahrt maßgeblich. Die spätere ungünstige Entwicklung in den Vermögensverhältnissen des Schädigers hat hierauf keinen Einfluß.
Damit erweist sich die Revision des Erstbeklagten als unbegründet.