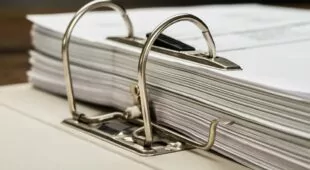Das Verhältnis zwischen Werbeblockern und Urheberrecht wird erneut vor Gericht verhandelt. Ein großes Verlagshaus wirft dem Betreiber eines Browser-Plugins vor, durch das Blockieren von Werbung die geschützte Programmierung seiner Websites unzulässig zu manipulieren. Ein Vorfall, bei dem sogar redaktionelle Inhalte blockiert wurden, spitzt den Fall zu und wirft grundlegende Fragen auf. Doch gilt die Art und Weise, wie ein Browser Inhalte im Speicher darstellt, als urheberrechtlich geschütztes Werk – und darf ein Plugin diese dann nicht verändern?
Übersicht:
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Worum geht es im Streit zwischen Publishern und Werbeblockern?
- Der Fall „Werbeblocker IV“: Was ist passiert?
- Welche rechtlichen und technischen Grundlagen sind relevant?
- Warum hat der BGH das Urteil aufgehoben?
- Welche Folgen hat das BGH-Urteil für Publisher und Nutzer?
- Was können Publisher jetzt gegen Werbeblocker tun?
- Wie geht der Rechtsstreit jetzt weiter?
- Die Urteilslogik
- Einordnung aus der Praxis
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Können temporäre Datenstrukturen, die im Arbeitsspeicher eines Computers erzeugt werden, urheberrechtlich geschützt sein?
- Wann liegt eine unzulässige Vervielfältigung oder Bearbeitung eines Computerprogramms im Sinne des Urheberrechts vor?
- Welche technischen Prozesse laufen im Browser ab, wenn eine Webseite geladen und dargestellt wird, und wie können diese urheberrechtlich relevant werden?
- Welche möglichen Auswirkungen hätte eine rechtliche Einschränkung von Webseiten-Filterwerkzeugen auf das Surferlebnis im Internet und die Finanzierung von Online-Inhalten?
- Dürfen Nutzer mittels Browser-Erweiterungen die Darstellung von Webseiten auf ihrem Endgerät beeinflussen oder filtern?

Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Ein Verlagshaus, das Online-Nachrichten anbietet, verklagte den Hersteller eines Werbeblockers. Der Verlag warf dem Werbeblocker vor, Webseiten unerlaubt zu verändern und damit sein Urheberrecht zu verletzen.
- Die Frage: Ist es eine Urheberrechtsverletzung, wenn ein Werbeblocker die Darstellung einer Webseite auf dem Computer verändert?
- Die Antwort: Nein, noch nicht abschließend. Das höchste Gericht hat den Fall zur erneuten Prüfung an ein niedrigeres Gericht zurückgegeben. Es muss genau geprüft werden, ob Werbeblocker den geschützten Programmcode einer Webseite im Arbeitsspeicher tatsächlich verändern.
- Das bedeutet das für Sie: Kurzfristig ändert sich für Nutzer nichts. Werbeblocker können weiterhin genutzt werden. Langfristig könnte dies aber bedeuten, dass Sie mehr Werbung sehen oder für Inhalte zahlen müssen, wenn Werbeblocker eingeschränkt werden.
Die Fakten im Blick
- Ein Verlagshaus klagte gegen einen Software-Anbieter, dessen Werbeblocker-Browser-Plugin Inhalte auf den Online-Portalen der Klägerin unterdrückt.
- Die Klägerin argumentierte, die Programmierung ihrer Webseiten sei ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm, dessen temporäre Datenstrukturen (DOM, CSSOM) geschützte Ausdrucksformen darstellten.
- Sie behauptete, der Werbeblocker führe durch seine Manipulation dieser Strukturen zu einer unberechtigten Vervielfältigung oder Umarbeitung des Computerprogramms.
- Ein fehlerhafter Eintrag im Werbeblocker führte 2016 dazu, dass auf einer Webseite der Klägerin auch redaktionelle Elemente nicht angezeigt wurden.
- Nachdem die Vorinstanzen die Klage abgewiesen hatten, hob der Bundesgerichtshof deren Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das Oberlandesgericht zurück.
- Das Berufungsgericht muss nun klären, ob die durch den Browser im Arbeitsspeicher erzeugten temporären Datenstrukturen oder der Bytecode als schutzfähige Ausdrucksformen des Webseitenprogramms gelten und ob der Werbeblocker diese verändert.
Quelle: Bundesgerichtshof, Urteil vom 31. Juli 2025, Az.: I ZR 131/23
Worum geht es im Streit zwischen Publishern und Werbeblockern?
Sind Werbeblocker illegal? Eine endgültige Antwort gibt das jüngste BGH-Urteil nicht, aber eine klare Richtung vor: Das Blockieren von Werbung kann eine Urheberrechtsverletzung darstellen.

Der Bundesgerichtshof hat den Fall zur technischen Detailprüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen – eine Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen für die gesamte Online-Branche.
Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelte diese Frage im Juli 2025. Seine Entscheidung ist kein endgültiger Sieg für eine der beiden Seiten. Vielmehr ist sie eine präzise juristische Anweisung an die Vorinstanzen. Das Urteil blickt tief in die Funktionsweise des Internets und zwingt die Richter, genauer hinzusehen.
Das Gericht hat den Fall an das Oberlandesgericht Hamburg zurückverwiesen, aber mit einer klaren Marschroute: Es muss klären, ob ein Werbeblocker nicht nur die Darstellung einer Webseite manipuliert, sondern den Kern ihres Programmcodes im Arbeitsspeicher Ihres Computers rechtswidrig verändert.
Dieses Urteil (Az. I ZR 131/23) beleuchtet einen blinden Fleck des digitalen Urheberrechts. Es stellt die entscheidende Frage: Wo genau endet das Recht eines Webseiten-Betreibers an seinem Code und wo beginnt die Autonomie des Nutzers, Inhalte auf seinem eigenen Gerät zu filtern? Die Antwort darauf wird die finanzielle Grundlage von Online-Medien, die Zukunft von Browser-Erweiterungen und letztlich Ihr Surferlebnis im Netz maßgeblich beeinflussen.
Der Fall „Werbeblocker IV“: Was ist passiert?
Die Geschichte beginnt mit einem großen deutschen Verlagshaus, das bekannte Online-Portale wie b.de und w.de betreibt. Wie viele Medienhäuser finanziert es seine journalistischen Inhalte maßgeblich durch Werbung, die es auf diesen Seiten anzeigt. Auf der anderen Seite des Konflikts steht ein Unternehmen, das die populäre Browser-Erweiterung „A B Plus“ vertreibt – einen Werbeblocker.
Wenn Sie eine Webseite aufrufen, passiert im Hintergrund ein komplexer technischer Prozess. Ihr Browser fragt die Webseite vom Server des Verlagshauses an und lädt eine HTML-Datei in den Arbeitsspeicher Ihres Computers. Diese Datei ist das Grundgerüst. Sie enthält Texte, aber auch Befehle und Verweise, die den Browser anweisen, zusätzliche Elemente von anderen Servern zu laden – zum Beispiel Bilder, Videos und eben auch Werbebanner von sogenannten AdServern.
Hier greift der Werbeblocker ein. Er arbeitet mit Filterlisten, die wie eine Art Türsteher funktionieren. Diese Listen enthalten Adressen von bekannten Werbeservern (Blacklists) und manchmal auch von erwünschten Werbepartnern (Whitelists). Der Werbeblocker nutzt hauptsächlich zwei Methoden:
- Blockieren von Netzwerkanfragen: Der Blocker verhindert von vornherein, dass Ihr Browser überhaupt Kontakt zu den in der Blacklist geführten Werbeservern aufnimmt. Die Werbung wird also gar nicht erst auf Ihren Computer geladen.
- Verstecken von Elementen (Element Hiding): Manchmal wird ein Werbeelement trotzdem geladen, weil es zum Beispiel direkt von der Webseite selbst kommt. In diesem Fall greift der Werbeblocker in die Darstellung ein. Er manipuliert die Anweisungen im Arbeitsspeicher so, dass der Browser das geladene Werbeelement einfach nicht anzeigt. Es ist da, aber für Sie unsichtbar.
Der Verlag argumentierte, dass beide Methoden seine Rechte verletzen. Der Konflikt spitzte sich zu, als 2016 ein Fehler in einer Filterliste des Werbeblockers dazu führte, dass auf einer der Nachrichtenseiten nicht nur Werbung, sondern auch redaktionelle Inhalte verschwanden. Für das Verlagshaus war das der Beweis: Der Werbeblocker greift unkontrolliert in die Substanz seiner redaktionellen Arbeit und seiner technischen Programmierung ein.
Deshalb zog das Unternehmen vor Gericht. Es forderte, dem Anbieter des Werbeblockers zu verbieten, seine Software weiter anzubieten oder zu bewerben. Zudem verlangte es Auskunft über die Verbreitung und forderte, es sei festzustellen, dass der Anbieter für entstandene Schäden hafte. Der Kern des Vorwurfs war nicht unlauterer Wettbewerb, wie in früheren Fällen, sondern eine direkte Verletzung des Urheberrechts.
Welche rechtlichen und technischen Grundlagen sind relevant?
Um die Argumente beider Seiten und die Entscheidung des BGH zu verstehen, müssen Sie zwei Welten betrachten: die juristische Welt des Urheberrechts für Software und die technische Welt, wie Ihr Browser eine Webseite zum Leben erweckt.
Was schützt das Urheberrecht bei Software?
Das deutsche Urheberrechtsgesetz schützt Computerprogramme auf eine besondere Weise. Laut § 69a UrhG gilt ein Programm als Werk, wenn es eine „individuelle geistige Schöpfung“ seines Entwicklers ist. Diese Hürde ist bewusst niedrig angesetzt; fast jeder nicht-triviale Code genießt diesen Schutz.
Entscheidend ist, was genau geschützt ist. Das Gesetz schützt die Ausdrucksform eines Programms. Damit sind vor allem zwei Dinge gemeint:
- Der Quellcode: Das ist der für Menschen lesbare Text, den ein Programmierer schreibt. Er enthält die Logik und die Anweisungen in einer Programmiersprache wie JavaScript.
- Der Objektcode: Das ist die vom Computer direkt ausführbare Version des Programms, eine Folge von Einsen und Nullen.
Der Urheber hat das ausschließliche Recht zu bestimmen, wer sein Programm verändern oder vervielfältigen darf. Das Verlagshaus stützte seine Argumentation dabei auf zwei entscheidende Kernpunkte des Paragrafen § 69c UrhG:
- § 69c Nr. 1 UrhG (Das Vervielfältigungsrecht): Dieser Paragraf verbietet die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung eines Programms. Eine Vervielfältigung ist dabei nicht nur eine exakte 1:1-Kopie. Sie liegt auch vor, wenn eine Kopie erstellt und dabei verändert wird.
- § 69c Nr. 2 UrhG (Das Umarbeitungsrecht): Dieser Paragraf verbietet die Übersetzung, die Bearbeitung oder eine andere Form der Umgestaltung des Programms. Eine Umarbeitung greift also in die Struktur oder den Inhalt des Originalwerks ein.
Das Verlagshaus argumentierte: Unsere Webseite ist nicht nur eine Ansammlung von Texten und Bildern, sondern ein komplexes Computerprogramm. Die Programmierung, insbesondere die enthaltenen JavaScript-Elemente, steuert aktiv, wie die Seite funktioniert und Inhalte nachlädt. Der Werbeblocker, so die Klägerin, schafft eine veränderte Kopie dieses Programms im Arbeitsspeicher und arbeitet es somit unrechtmäßig um.

Technische Analyse: Wie eine Webseite im Browser entsteht
Die Argumentation des Verlagshauses zielt auf Prozesse ab, die im Verborgenen ablaufen, sobald Sie eine URL in Ihren Browser tippen. Halten Sie sich fest, jetzt wird es kurz technisch – aber es lohnt sich. Was der Server sendet (die ursprüngliche HTML-Datei), ist nur der Anfang. Ihr Browser agiert als eine Art dynamisches Ausführungsorgan, eine „virtuelle Maschine“.
- Parsen und der DOM-Baum: Der Browser liest die HTML-Datei und baut daraus eine logische Struktur im Arbeitsspeicher auf: den DOM-Knotenbaum (Document Object Model). Sie können sich diesen Baum als ein dynamisches Inhaltsverzeichnis der Webseite vorstellen, das der Browser in Echtzeit erstellt und nutzt. Jeder Ast und jedes Blatt repräsentiert ein Element der Seite – eine Überschrift, einen Absatz, ein Bild oder einen für Werbung reservierten Platzhalter.
- Styling und der CSSOM-Baum: Parallel dazu verarbeitet der Browser die Design-Anweisungen aus den CSS-Dateien (Cascading Style Sheets) und erstellt daraus das CSS Object Model (CSSOM). Diese Struktur legt fest, wie die Elemente aus dem DOM-Baum aussehen sollen: Schriftart, Farbe, Größe, Position.
- Zusammenführung im Render Tree: Eine sogenannte Render-Engine fügt DOM und CSSOM zu einem Render Tree zusammen. Dieser enthält nur die sichtbaren Elemente und dient als finale Bauanleitung für das, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.
- Die Rolle von JavaScript und Bytecode: Das ist der entscheidende Punkt. Moderne Webseiten sind nicht statisch. JavaScript-Code, der in der Webseite eingebettet ist, kann den DOM-Baum auch nach dem Laden noch aktiv verändern. Er kann Elemente hinzufügen, entfernen oder deren Verhalten ändern. Um diese Befehle auszuführen, übersetzt die Engine des Browsers den JavaScript-Code oft nicht direkt in den für die CPU verständlichen Objektcode. Stattdessen wird ein Zwischencode erzeugt: der Bytecode. Dieser Bytecode ist eine optimierte, maschinennahe, aber noch plattformunabhängige Version des Programms. Die virtuelle Maschine des Browsers führt diesen Bytecode aus und erzeugt daraus erst den finalen Objektcode für den Prozessor Ihres Computers.

Der Werbeblocker greift genau in diese dynamischen, im Arbeitsspeicher erzeugten Strukturen ein. Er verändert den DOM-Baum, um Werbe-Platzhalter zu entfernen, oder manipuliert CSS-Regeln, um Elemente unsichtbar zu machen. Das Verlagshaus argumentierte, dass diese temporären Strukturen – insbesondere der ausführbare Bytecode – nicht nur ein Nebenprodukt, sondern eine geschützte „Ausdrucksform“ ihres ursprünglichen Webseitenprogramms sind.
Warum hat der BGH das Urteil aufgehoben?
Die Vorinstanzen, das Landgericht und das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg, hatten die Klage des Verlagshauses abgewiesen. Ihre Begründung war im Kern, dass der Werbeblocker nicht die „Substanz“ des ursprünglichen Programms auf dem Server verändere. Er beeinflusse lediglich den Ablauf und die temporären Datenstrukturen im Arbeitsspeicher des Nutzers. Diese seien aber keine urheberrechtlich geschützte Kopie des Programms.
Der Bundesgerichtshof sah das differenzierter. Er hob das Urteil des OLG auf und schickte den Fall zurück, weil die Argumentation der Vorinstanz an mehreren Stellen zu kurz griff und entscheidende Fragen offenließ.
Akt 1: Eine unklare Definition des Schutzobjekts
Der BGH kritisierte, dass das OLG nie klar definiert hatte, was genau an der Webseite des Verlags urheberrechtlich geschützt sein soll. Das OLG hatte die Schutzfähigkeit einfach unterstellt, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass ohnehin kein Eingriff vorliege. Dieses Vorgehen ist zwar juristisch manchmal zulässig, hier aber problematisch.
Der BGH stellte klar: Man kann nicht beurteilen, ob ein Recht verletzt wird, wenn man nicht genau weiß, was dieses Recht schützt. Das OLG hätte präzise feststellen müssen, welche Teile der Webseitenprogrammierung die Merkmale einer „individuellen geistigen Schöpfung“ aufweisen. Nur dann lässt sich prüfen, ob der Werbeblocker genau in diese schöpferischen Merkmale eingreift. Ohne diese Grundlage bleibt die gesamte Argumentation im Vagen.
Akt 2: Die übersehene Rolle des Bytecodes
Dies ist das Herzstück der BGH-Entscheidung. Das OLG hatte die im Browser erzeugten Strukturen (DOM, CSSOM etc.) als bloße „Zwischenergebnisse der Programmausführung“ abgetan. Der BGH fand diese Sichtweise zu einfach. Er nahm den Vortrag des Verlagshauses ernst, dass moderne Browser als virtuelle Maschinen agieren und der Webseiten-Code in einen ausführbaren Bytecode übersetzt wird.
Der BGH verwies auf eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Diese Entscheidung besagt: Quell- und Objektcode eines Programms sind geschützt. Der Grund dafür ist, dass erst sie die Vervielfältigung oder spätere Entstehung des Programms ermöglichen. Sie sind der „buchstäbliche Ausdruck“ der Befehlsfolge, die den Computer steuert. Der BGH stellte nun die entscheidende Anschlussfrage, die das OLG unbeantwortet gelassen hatte: Könnte der im Browser erzeugte Bytecode nicht ebenfalls eine solche geschützte Ausdrucksform sein?
Das OLG muss nun prüfen:
- Ist der aus dem JavaScript der Webseite erzeugte Bytecode eine Übersetzung, die als schutzfähige Ausdrucksform des ursprünglichen Programms anzusehen ist?
- Ermöglicht dieser Bytecode die „spätere Entstehung“ des Programms im Sinne der EuGH-Rechtsprechung?
- Greift der Werbeblocker direkt in diesen Bytecode oder den daraus erzeugten finalen Code ein und verändert ihn?
Wenn diese Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, könnte der Einsatz des Werbeblockers tatsächlich eine illegale Umarbeitung (§ 69c Nr. 2 UrhG) oder eine abändernde Vervielfältigung (§ 69c Nr. 1 UrhG) darstellen. Die entscheidende Frage lautet also: Ist dieser dynamisch erzeugte Code selbst eine geschützte Ausdrucksform des ursprünglichen Programms?
Akt 3: Die widersprüchliche Logik der Vorinstanz
Zuletzt bemängelte der BGH die in sich widersprüchliche Argumentation des OLG. Einerseits behauptete das OLG, der Werbeblocker greife nur in den „Programmablauf“ ein, nicht aber in die „Programmsubstanz“. Andererseits stellte es selbst fest, dass der Werbeblocker aktiv Programmbefehle des Verlags blockiert, überschreibt und den Code direkt verändert.
Dieser Widerspruch ist offensichtlich. Wenn ein Programm so verändert wird, dass es Befehle nicht mehr ausführt, die sein Urheber vorgesehen hat, und stattdessen andere Ergebnisse produziert, ist das mehr als nur eine Beeinflussung des „Ablaufs“. Es ist ein direkter Eingriff in die Funktionsweise des Codes. Der BGH machte deutlich, dass die Unterscheidung zwischen „Ablauf“ und „Substanz“ in diesem Fall nicht überzeugte und einer genaueren technischen und juristischen Prüfung bedarf.
Welche Folgen hat das BGH-Urteil für Publisher und Nutzer?
Der Bundesgerichtshof hat den Ball zurück ins Feld des OLG Hamburg gespielt, aber die Spielregeln verschärft. Die Entscheidung ist kein endgültiges Urteil über Werbeblocker, aber sie ist ein klares Signal, dass die urheberrechtliche Argumentation von Webseiten-Betreibern ernst genommen werden muss. Die Konsequenzen sind weitreichend.
Was bedeutet das Urteil für Verlage und Online-Anbieter?

Das Urteil ist ein Etappensieg. Die Tür für einen urheberrechtlichen Schutz gegen Werbeblocker wurde vom BGH nicht zugeschlagen, sondern einen Spalt weiter geöffnet. Sollte das OLG Hamburg (oder später erneut der BGH) zu dem Schluss kommen, dass Werbeblocker tatsächlich das Urheberrecht verletzen, könnten Verlage deren Einsatz auf ihren Seiten wirksam unterbinden oder von den Anbietern eine Vergütung verlangen. Dies würde ihre Geschäftsmodelle stabilisieren, die stark von Werbeeinnahmen abhängen.
Welche Risiken entstehen für Werbeblocker-Anbieter?
Die Rechtsunsicherheit wächst. Sie müssen nun damit rechnen, dass Gerichte die technische Funktionsweise ihrer Software noch genauer unter die Lupe nehmen. Ein negatives Urteil könnte sie zwingen, die Technologie ihrer Produkte grundlegend zu ändern oder sich auf bestimmte Funktionsweisen zu beschränken. Der pauschale Hinweis, man helfe dem Nutzer nur bei der Konfiguration seines Browsers, könnte in Zukunft nicht mehr ausreichen.
Ändert sich durch das Urteil etwas für Internetnutzer?
Kurzfristig ändert sich nichts. Sie können Werbeblocker weiterhin nutzen. Langfristig könnte die Auseinandersetzung jedoch Ihr Surferlebnis verändern. Sollten Werbeblocker rechtlich stark eingeschränkt werden, müssten Sie auf Webseiten wieder mehr Werbung sehen. Alternativ könnten mehr Anbieter von Inhalten auf Bezahlschranken (Paywalls) oder Modelle setzen, bei denen Sie für eine werbefreie Nutzung bezahlen müssen. Das Recht auf ein selbstbestimmtes, filterbasiertes Interneterlebnis steht hier dem Recht der Urheber gegenüber, die Integrität und Monetarisierung ihrer Werke zu schützen.
Dieser Fall zeigt exemplarisch, wie das Recht versucht, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Die nächste Runde in Hamburg wird zeigen, ob das Urheberrecht stark genug ist, um die unsichtbaren Code-Strukturen im Speicher Ihres Computers zu schützen. Die Entscheidung wird direkte Folgen für die sichtbare Welt des World Wide Web haben.
Was können Publisher jetzt gegen Werbeblocker tun?
Während die endgültige Klärung noch aussteht, müssen Publisher nicht tatenlos zusehen. Die Entscheidung des BGH stärkt die Position, dass der Webseiten-Code ein schutzwürdiges Gut ist. Daraus ergeben sich bereits jetzt strategische und technische Überlegungen:
1. Adblocker-Nutzung technisch erkennen
Der erste Schritt ist, das Ausmaß des Problems zu verstehen. Mittels sogenannter „Adblock-Detection-Skripte“ können Sie technisch feststellen, wie viele Ihrer Nutzer einen Werbeblocker aktiviert haben. Diese Information ist die Grundlage für jede weitere strategische Entscheidung.
2. Einen Dialog mit Nutzern starten
Anstatt Inhalte pauschal zu sperren, können Sie Nutzer mit aktivem Werbeblocker gezielt ansprechen. Bitten Sie sie höflich, Ihre Seite auf die „Whitelist“ zu setzen, oder bieten Sie alternative, werbefreie Bezahlmodelle (z.B. einen Tagespass für 1€) an. Dies kann die Akzeptanz erhöhen und neue Erlösquellen schaffen.
3. Eigene Nutzungsbedingungen (AGB) anpassen
Obwohl die urheberrechtliche Frage noch offen ist, können Sie Ihre vertragliche Position stärken. Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Rechtsbeistand, ob Ihre AGB die Nutzung der Webseite von der Zustimmung zur Anzeige von Inhalten, inklusive Werbung, abhängig machen. Ein expliziter Passus, der die Manipulation der Seitendarstellung durch Blocker untersagt, kann eine zusätzliche rechtliche Grundlage für zukünftige Auseinandersetzungen schaffen.
Wie geht der Rechtsstreit jetzt weiter?
Der BGH hat dem OLG Hamburg eine klare, aber technisch anspruchsvolle Aufgabe gestellt. Der weitere Verlauf dürfte sich wie folgt gestalten:
Warum jetzt ein Sachverständigengutachten entscheidend ist
Da die Kernfrage – die Funktion und Schutzfähigkeit von Bytecode – hochtechnisch ist, wird das OLG Hamburg mit hoher Wahrscheinlichkeit einen oder mehrere unabhängige IT-Sachverständige bestellen. Diese sollen klären, ob der Bytecode tatsächlich eine schutzfähige „Ausdrucksform“ des ursprünglichen Programms ist und wie genau der Werbeblocker diesen verändert. Allein dieser Prozess kann mehrere Monate bis über ein Jahr in Anspruch nehmen. Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich gründlich, aber langsam.
Welche drei Entscheidungsszenarien sind möglich?
Basierend auf dem Gutachten sind drei Ausgänge denkbar:
- Das OLG bejaht die Urheberrechtsverletzung: Sollten die Gutachter bestätigen, dass der Bytecode eine geschützte Werkform ist und der Blocker diesen unzulässig umarbeitet, könnte das OLG den Werbeblocker-Anbieter verurteilen. Dies wäre ein bahnbrechender Sieg für die Publisher.
- Das OLG verneint die Urheberrechtsverletzung: Kommen die Gutachter zum Schluss, dass der Bytecode keine schutzfähige Ausdrucksform ist oder der Eingriff irrelevant ist, würde die Klage erneut abgewiesen.
- Erneute Revision zum BGH: Unabhängig vom Ausgang ist es sehr wahrscheinlich, dass die unterlegene Partei erneut Revision beim BGH einlegen wird, um eine endgültige Klärung der Grundsatzfrage herbeizuführen. Der Fall „Werbeblocker IV“ wird uns also voraussichtlich noch mehrere Jahre beschäftigen.
Die Urteilslogik
Gerichte präzisieren die Grenzen des Urheberrechts für digitale Inhalte, indem sie ihre technische Funktionsweise genau untersuchen.
- Konkrete Bestimmung des Schutzobjekts: Juristische Prüfungen zur Urheberrechtsverletzung setzen voraus, dass das Gericht präzise feststellt, welche konkreten Teile eines digitalen Werkes eine schutzwürdige individuelle geistige Schöpfung darstellen.
- Schutz des dynamisch erzeugten Codes: Dynamisch im Arbeitsspeicher erzeugter, ausführbarer Code kann ebenfalls als eine urheberrechtlich geschützte Ausdrucksform eines Computerprogramms gelten, wenn er dessen buchstäblichen Ausdruck bildet.
- Eingriff in Programmsubstanz: Eine Veränderung, Blockade oder Überschreibung von Programmbefehlen greift die geschützte Substanz eines Werkes an, nicht nur dessen bloßen Ablauf.
Die rechtliche Beurteilung digitaler Werke erfordert eine tiefe technische Analyse, um den Schutz des Urhebers mit der autonomen Nutzung zu vereinbaren.
Einordnung aus der Praxis
Die strategische Bedeutung dieses Urteils liegt darin, dass der BGH den Konflikt um Werbeblocker vom allgemeinen Wettbewerbsrecht auf den harten, technischen Kern des Software-Urheberrechts verlagert. Die Vorinstanz ist nun gezwungen, die entscheidende Frage zu klären: Ist der dynamisch im Arbeitsspeicher eines Browsers erzeugte Code eine urheberrechtlich geschützte Werkform der Webseite? Diese technische Weichenstellung eröffnet den Rechteinhabern eine neue, potenziell schärfere Waffe und stellt die Balance zwischen der Integrität eines digitalen Werkes und der Autonomie des Nutzers auf eine grundlegend neue Probe.
Benötigen Sie Hilfe?
Werden die Inhalte oder die technische Programmierung Ihrer Webseite durch Werbeblocker derart beeinflusst oder blockiert, dass sich hieraus urheberrechtliche Fragen ergeben? Gerne können Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung anfragen, um Ihren spezifischen Sachverhalt zu klären.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Können temporäre Datenstrukturen, die im Arbeitsspeicher eines Computers erzeugt werden, urheberrechtlich geschützt sein?
Im Arbeitsspeicher eines Computers temporär erzeugte Datenstrukturen wie Bytecode können potenziell urheberrechtlich geschützt sein, aber Gerichte müssen dies im Einzelfall noch klären. Die Frage, ob solcher dynamisch erzeugter Code eine geschützte Ausdrucksform eines Computerprogramms darstellt, ist Gegenstand aktueller Gerichtsverfahren.
Das Urheberrecht schützt traditionell den Quell- und Objektcode eines Computerprogramms als dessen feste Ausdrucksform. Bei modernen Webseiten, die viel JavaScript nutzen, entstehen jedoch dynamisch erst zur Laufzeit im Browser neue Code-Strukturen im Arbeitsspeicher, etwa der sogenannte Bytecode. Dieser Bytecode wird aus dem ursprünglichen JavaScript erzeugt und dann vom Computer ausgeführt.
Der Bundesgerichtshof prüft nun die komplexe Frage, ob auch dieser dynamisch erzeugte Bytecode als eine schutzfähige „Ausdrucksform“ des ursprünglichen Programms gelten kann. Er hat einen Gerichtsfall zurückverwiesen, damit detailliert geklärt wird, ob ein Werbeblocker durch Eingriffe in diese temporären Strukturen eine unzulässige Vervielfältigung oder Umarbeitung des urheberrechtlich geschützten Webseiten-Programms vornimmt.
Die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend für die Reichweite des Urheberrechtsschutzes im Internet und beeinflusst maßgeblich Geschäftsmodelle von Online-Medien sowie die Zukunft von Browser-Erweiterungen.
Wann liegt eine unzulässige Vervielfältigung oder Bearbeitung eines Computerprogramms im Sinne des Urheberrechts vor?
Eine unzulässige Vervielfältigung oder Bearbeitung eines Computerprogramms im Sinne des Urheberrechts liegt vor, wenn man das Programm ohne Erlaubnis kopiert oder dessen Struktur oder Inhalte verändert. Dies gilt nicht nur für exakte Kopien, sondern auch für Abwandlungen, die das Programm anders aussehen oder funktionieren lassen, selbst wenn diese nur vorübergehend im Arbeitsspeicher eines Computers entstehen.
Das Vervielfältigungsrecht nach § 69c Nr. 1 UrhG schützt ein Computerprogramm vor unerlaubter Kopie, egal ob dauerhaft oder nur für kurze Zeit. Eine solche Vervielfältigung kann auch gegeben sein, wenn die Kopie beim Erstellen verändert wird oder nur im Arbeitsspeicher des Computers existiert, wie es zum Beispiel beim Laden einer Webseite und der Bearbeitung ihres Codes im Browser der Fall sein kann.
Das Umarbeitungsrecht gemäß § 69c Nr. 2 UrhG wird verletzt, wenn man ein Programm übersetzt, bearbeitet oder in anderer Form umgestaltet. Hier geht es um Eingriffe in die Struktur oder den Inhalt des Originalprogramms, die seine Funktionsweise beeinflussen oder eine neue, abweichende Version des Programms schaffen.
Im Kern solcher rechtlichen Auseinandersetzungen steht oft die Frage, ob die Manipulation von Programmteilen oder die Generierung veränderter Ausführungsformen des Programms – wie etwa durch die Beeinflussung des Programmcodes einer Webseite im Arbeitsspeicher – eine unzulässige Handlung darstellt.
Das Urheberrecht dient dazu, die kreative Leistung hinter Software zu schützen und dem Urheber die Kontrolle über die Nutzung und Veränderung seines Programms zu ermöglichen.
Welche technischen Prozesse laufen im Browser ab, wenn eine Webseite geladen und dargestellt wird, und wie können diese urheberrechtlich relevant werden?
Wenn eine Webseite im Browser geladen wird, durchläuft sie komplexe technische Prozesse, die von der Umwandlung des Codes bis zur dynamischen Darstellung reichen und dabei urheberrechtlich relevant werden können. Dies liegt daran, dass der Browser die ursprünglichen Dateien verarbeitet und in neue, ausführbare Strukturen umwandelt.
Zuerst liest der Browser die HTML-Datei der Webseite und erstellt daraus einen logischen Bauplan im Arbeitsspeicher, den sogenannten DOM-Baum (Document Object Model). Parallel dazu werden die Gestaltungsanweisungen aus CSS-Dateien verarbeitet, woraus das CSSOM (CSS Object Model) entsteht. Beide werden zusammengeführt, um festzulegen, wie die Webseite auf dem Bildschirm aussieht.
Moderne Webseiten sind oft dynamisch und nutzen JavaScript, um Inhalte auch nach dem ersten Laden zu verändern oder nachzuladen. Um diesen JavaScript-Code auszuführen, übersetzt der Browser ihn häufig in einen Zwischencode, den Bytecode. Dieser Bytecode ist eine optimierte, maschinennahe Version des Programms und wird von einer virtuellen Maschine im Browser ausgeführt, die die endgültigen Befehle für den Computer erzeugt.
Gerade diese dynamisch im Arbeitsspeicher erzeugten Strukturen – der DOM-Baum, das CSSOM und insbesondere der ausführbare Bytecode – sind Gegenstand juristischer Debatten. Man fragt sich, ob diese Strukturen als eine geschützte „Ausdrucksform“ des ursprünglichen Webseitenprogramms gelten können und somit unter das Urheberrecht fallen.
Welche möglichen Auswirkungen hätte eine rechtliche Einschränkung von Webseiten-Filterwerkzeugen auf das Surferlebnis im Internet und die Finanzierung von Online-Inhalten?
Eine mögliche rechtliche Einschränkung von Webseiten-Filterwerkzeugen könnte dazu führen, dass man als Internetnutzer wieder mehr Werbung sieht oder zunehmend für werbefreie Inhalte bezahlen muss. Für Online-Inhaltsanbieter hingegen könnten sich ihre werbebasierten Geschäftsmodelle stabilisieren und neue Einnahmequellen erschließen.
Sollte gerichtlich festgestellt werden, dass Werbeblocker Urheberrechte verletzen, könnten Verlage und andere Online-Anbieter deren Einsatz auf ihren Webseiten wirksam unterbinden. Dies würde ihre Finanzierung, die stark von Werbeeinnahmen abhängt, sichern. Alternativ könnten sie von den Anbietern der Filterwerkzeuge eine Vergütung für die Nutzung verlangen, was ebenfalls neue Einnahmequellen erschlösse.
Als Internetnutzer würde sich dadurch das Surferlebnis merklich verändern. Man müsste gegebenenfalls wieder eine höhere Anzahl von Werbeanzeigen in Kauf nehmen. Eine weitere Folge könnte sein, dass mehr Online-Inhalte hinter Bezahlschranken verschwinden oder man für die werbefreie Nutzung von Webseiten direkt bezahlen muss.
Im Kern beleuchtet diese Entwicklung den grundlegenden Interessenkonflikt zwischen dem Wunsch des Nutzers, Inhalte nach eigenem Ermessen zu filtern, und dem Recht der Urheber, ihre digitalen Werke zu monetarisieren und deren Integrität zu schützen.
Dürfen Nutzer mittels Browser-Erweiterungen die Darstellung von Webseiten auf ihrem Endgerät beeinflussen oder filtern?
Man darf Browser-Erweiterungen nutzen, um Webseiten anzupassen, doch die tiefgreifende Manipulation von Inhalten kann rechtlich problematisch sein. Die genaue Grenze zur Urheberrechtsverletzung ist dabei gerichtlich noch nicht abschließend geklärt.
Browser-Erweiterungen sind ursprünglich dafür gedacht, Nutzern die Anpassung ihres Surferlebnisses zu ermöglichen. Die juristische Herausforderung beginnt, wenn solche Manipulationen so weit gehen, dass sie als unerlaubte Vervielfältigung oder Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Computerprogramms – der Webseite selbst – angesehen werden könnten.
Der Bundesgerichtshof hat in einem Fall um Werbeblocker darauf hingewiesen, dass eine Webseite als Computerprogramm urheberrechtlich geschützt sein kann. Wenn eine Erweiterung nicht nur die sichtbare Darstellung beeinflusst, sondern direkt in den dynamisch vom Browser erzeugten ausführbaren Code im Arbeitsspeicher des Computers eingreift, könnte dies eine Verletzung der Rechte des Webseiten-Betreibers darstellen. Hierbei geht es insbesondere um die Frage, ob der aus dem Webseiten-Code erzeugte „Bytecode“ selbst als schützenswerte Form des Programms gilt und von der Erweiterung verändert wird.
Diese Frage ist weiterhin gerichtlich umstritten und wird maßgeblich die zukünftigen Spielregeln für Browser-Erweiterungen und Online-Inhalte beeinflussen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Ich bin seit meiner Zulassung als Rechtsanwalt im Jahr 2003 Teil der Kanzlei der Rechtsanwälte Kotz in Kreuztal bei Siegen. Als Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Versicherungsrecht, sowie als Notar setze ich mich erfolgreich für meine Mandanten ein. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind Mietrecht, Strafrecht, Verbraucherrecht, Reiserecht, Medizinrecht, Internetrecht, Verwaltungsrecht und Erbrecht. Ferner bin ich Mitglied im Deutschen Anwaltverein und in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften. Als Rechtsanwalt bin ich bundesweit in allen Rechtsgebieten tätig und engagiere mich unter anderem als Vertragsanwalt für […] mehr über Dr. Christian Gerd Kotz