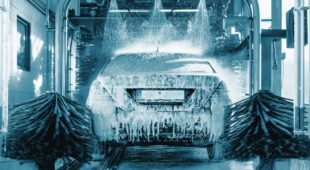Übersicht:
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Strompreis-Dschungel gelichtet? Bundesgerichtshof fordert mehr Klarheit bei Heizstromtarifen
- Der Fall „Doppeltarifzähler II“: Worum ging es genau?
- Der lange Weg durch die Instanzen
- Das Machtwort aus Luxemburg: Was der EuGH zur Preisberechnung sagt
- Zurück in Deutschland: Der Bundesgerichtshof zieht die Konsequenzen (I ZR 65/22)
- Die Entscheidung: Aufhebung und Zurückverweisung – Was bedeutet das?
- Die detaillierten Gründe des BGH – Klartext für Verbraucher
- Informationspflichten sind kein Papiertiger (§ 5a, 5b UWG)
- Die Crux mit der Zumutbarkeit: Was muss der Anbieter leisten?
- Warum ein Hinweis in den AGB oft nicht reicht
- Irreführung durch unklare Preise (§ 5 UWG)
- Keine „gespaltene Verkehrsauffassung“: Der durchschnittlich informierte Verbraucher zählt
- Das Problem der „falschen Menge“ ist auch ein Problem des „falschen Preises“
- Das Urteil und Ihr Alltag: Warum „Doppeltarifzähler II“ für Sie relevant ist
- Was bedeutet das für mich als Stromkunde? Praktische Hinweise
- Häufig gestellte Fragen zum Thema Heizstromtarife und Preistransparenz
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was genau ist diese „Ausgleichsmenge“ noch einmal und warum ist sie bei Heizstromtarifen oft ein Knackpunkt?
- Der BGH hat den Fall ja an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen. Heißt das, für mich als Verbraucher ändert sich vorerst noch gar nichts Konkretes?
- Mein Energieanbieter hat einen Online-Tarifrechner. Welche Informationen zur „Ausgleichsmenge“ kann ich dort nach diesem Urteil erwarten?
- Was bedeutet die „Zumutbarkeit der Informationsbeschaffung“ für den Anbieter genau? Und was, wenn mein Anbieter sagt, er könne die exakte Ausgleichsmenge für mein Gebiet nur schwer ermitteln?
- Ich nutze einen Doppeltarifzähler für meine Nachtspeicherheizung. Worauf sollte ich nach diesem Urteil beim Online-Vergleich von Heizstromtarifen jetzt besonders achten?
- Im Artikel steht, dass ein Hinweis auf die Ausgleichsmenge in den AGB oft nicht ausreicht. Warum ist das so und wo sollten diese Infos stattdessen stehen?
- Klarheit statt Kostenfalle: BGH justiert Heizstrom-Spielregeln neu
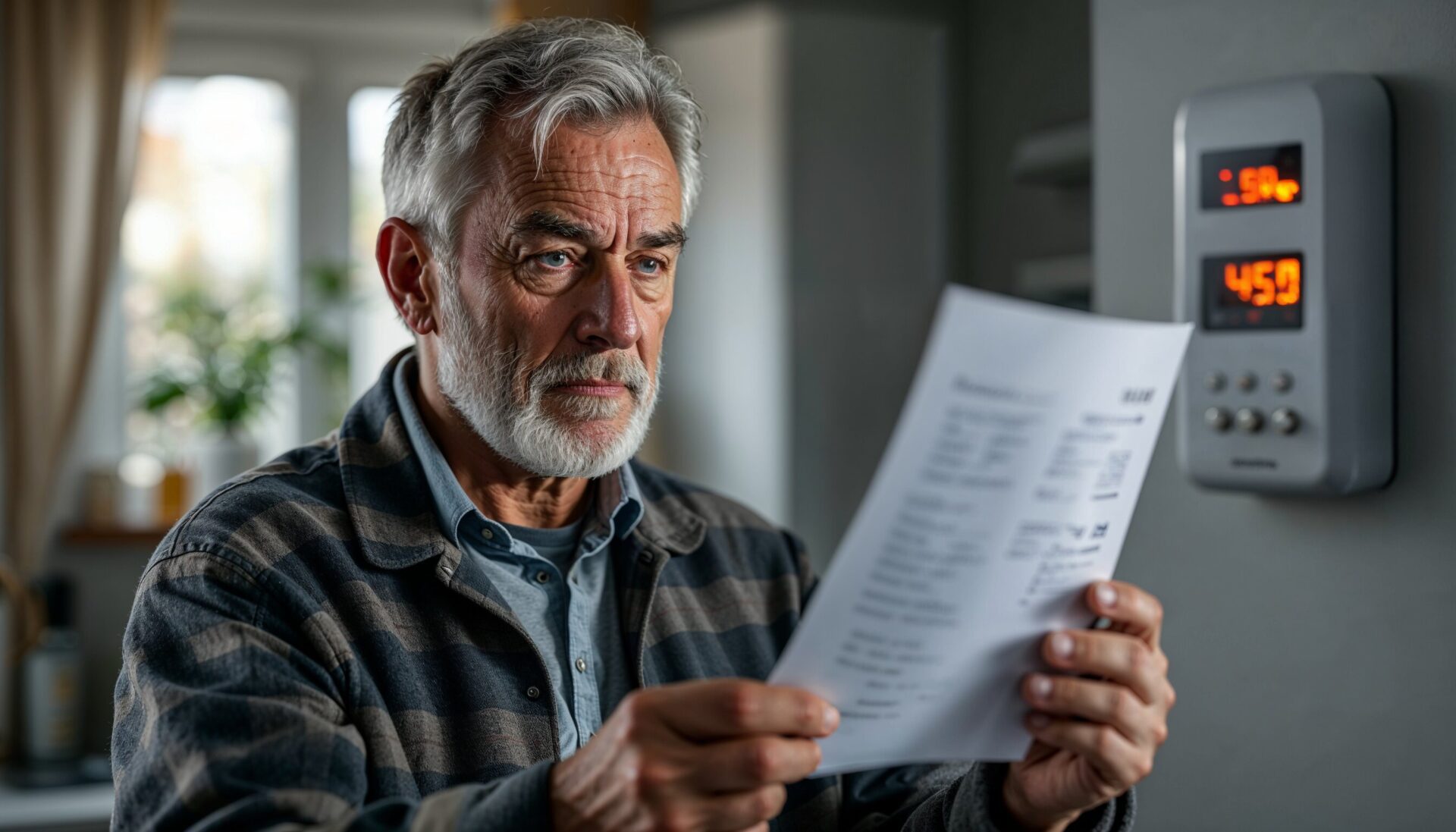
Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Energieanbieter müssen Verbrauchern bei Heizstromtarifen viel klarer erklären, wie der Preis zustande kommt.
- Betroffen sind Kunden mit Nachtspeicherheizungen und Doppeltarifzählern, die Heizstrom beziehen.
- Energieanbieter müssen vermutlich genauere Infos zu Preisbestandteilen (z.B. „Ausgleichsmenge“) geben, auch in Online-Vergleichen, wenn ihnen das möglich ist.
- Das soll helfen, dass der angezeigte Preis dem tatsächlichen Preis näher kommt und Überraschungen auf der Jahresrechnung seltener werden.
- Das Problem war, dass ein Teil des günstigen Nachtstroms („Ausgleichsmenge“) teurer abgerechnet wird, was Anbieter oft nicht transparent zeigten.
- Das Urteil wurde am 27. März 2025 gefällt. Der Fall ist noch nicht ganz abgeschlossen, sondern wurde zur erneuten Prüfung an ein niedrigeres Gericht zurückverwiesen.
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH) vom 27. März 2025 (Az.: I ZR 65/22)
Strompreis-Dschungel gelichtet? Bundesgerichtshof fordert mehr Klarheit bei Heizstromtarifen
Stellen Sie sich vor, Sie suchen einen neuen, günstigeren Stromtarif für Ihre Nachtspeicherheizung. Sie nutzen einen Online-Tarifrechner, geben Ihren Verbrauch ein und freuen sich über ein scheinbar unschlagbares Angebot. Doch die erste Jahresabrechnung bringt eine böse Überraschung: Der Preis ist deutlich höher als erwartet.
Ein Szenario, das viele Verbraucher kennen und das nun im Mittelpunkt eines wegweisenden Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) stand. Unter dem Aktenzeichen I ZR 65/22, bekannt als „Doppeltarifzähler II“, haben die Karlsruher Richter am 27. März 2025 entschieden, dass Energieanbieter bei der Werbung für Heizstromtarife deutlich transparenter über komplexe Preisbestandteile informieren müssen. Dieses Urteil könnte für Millionen Haushalte mit sogenannten Doppeltarifzählern weitreichende Folgen haben und die Spielregeln für Online-Preisvergleiche neu definieren.
Der Fall „Doppeltarifzähler II“: Worum ging es genau?
Im Zentrum des Rechtsstreits stand ein bundesweit tätiges Energieversorgungsunternehmen und der Dachverband der deutschen Verbraucherzentralen. Der Zankapfel: der Online-Tarifrechner des Unternehmens für Heizstrom. Kunden, die Strom für Nachtspeicherheizungen beziehen, nutzen oft sogenannte Doppeltarifzähler. Diese Zähler erfassen den Stromverbrauch getrennt nach Hochtarif (HT), also dem normalen, teureren Tagesstrom, und Niedertarif (NT), einem günstigeren Tarif, der meist nachts für das Aufladen der Speicherheizungen gilt.
Die Tücke der „Ausgleichsmenge“
Das Problem entsteht, wenn über den Doppeltarifzähler nicht nur der Heizstrom, sondern auch der allgemeine Haushaltsstrom erfasst wird – eine gängige Praxis. Denn auch während der günstigen Niedertarifzeiten läuft im Haushalt Strom für Kühlschrank, Router oder andere Geräte. Dieser Allgemeinstrom kann bei gemeinsamer Messung nicht separat vom Heizstrom erfasst werden.
Um zu verhindern, dass dieser Haushaltsstrom ungerechtfertigt zum billigeren NT-Preis abgerechnet wird, geben viele örtliche Verteilernetzbetreiber eine sogenannte „Ausgleichsmenge“ vor. Das bedeutet, ein pauschal festgelegter Prozentsatz des im Niedertarif gemessenen Stromverbrauchs wird nachträglich dem teureren Hochtarif zugeschlagen. Diese Ausgleichsmenge gibt der verklagte Energieanbieter, wie im Urteil festgestellt, an seine Kunden weiter. Am eigenen Unternehmenssitz betrug diese beispielsweise 25 Prozent.
Der Streitpunkt: Irreführende Preise im Tarifrechner?
Die Verbraucherzentrale kritisierte, dass der Tarifrechner des Anbieters diese Ausgleichsmenge bei der Anzeige des voraussichtlichen Gesamtpreises nicht oder nicht ausreichend berücksichtigte. Kunden, die ihre Verbrauchsdaten aus alten Rechnungen – möglicherweise von Anbietern, die eine andere oder gar keine Ausgleichsmenge ansetzten – in den Rechner eingaben, erhielten so ein potenziell zu niedriges Preisangebot. Die tatsächlichen Kosten, so der Vorwurf, würden erst mit der Jahresabrechnung sichtbar.
Der Kläger forderte daher, dem Unternehmen zu untersagen, mit Preisen zu werben, die diese Ausgleichsmenge nicht korrekt abbilden. Außerdem sollte der Anbieter verpflichtet werden, im gesamten Bestellvorgang ausdrücklich auf die konkrete Höhe der für das jeweilige Netzgebiet geltenden Ausgleichsmenge hinzuweisen.
Der lange Weg durch die Instanzen
Bevor der Fall den Bundesgerichtshof erreichte, hatten sich bereits zwei niedrigere Gerichte damit befasst – mit für die Verbraucherschützer enttäuschendem Ergebnis. Sowohl das Landgericht Mönchengladbach als auch das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf wiesen die Klage ab.
Das OLG Düsseldorf argumentierte unter anderem, dass ein Teil der Verbraucher ohnehin nur Schätzwerte eingebe oder über das notwendige Vorwissen zur Ausgleichsmenge verfüge. Selbst wenn ein Verbraucher zu einem falschen Preis gelange, sei dies eher ein Problem der eingegebenen Menge als des Preises. Ein allgemeiner Hinweis auf die Praxis der Ausgleichsmenge, wie er in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters zu finden war, sei ausreichend.
Die entscheidende Frage an Europa: Der EuGH muss ran
Angesichts der europarechtlichen Dimension – es ging um die Auslegung der EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (Richtlinie 2005/29/EG) – legte der BGH die Sache dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg vor. Die zentrale Frage lautete vereinfacht: Wie detailliert muss ein Unternehmen über die Art der Preisberechnung informieren, insbesondere über variable Bestandteile wie die Ausgleichsmenge, damit ein Verbraucher eine fundierte Entscheidung treffen kann?
Das Machtwort aus Luxemburg: Was der EuGH zur Preisberechnung sagt
Mit Urteil vom 23. Januar 2025 (Az. C-518/23, „NEW Niederrhein Energie und Wasser“) gab der EuGH eine differenzierte Antwort. Die Richter stellten klar, dass die Information über die Art der Preisberechnung nicht notwendigerweise den exakten Prozentsatz eines variablen Bestandteils wie der Ausgleichsmenge enthalten muss. Entscheidend sei vielmehr, dass in der kommerziellen Kommunikation – also beispielsweise auf der Webseite mit dem Tarifrechner – die grundsätzliche Anwendbarkeit eines solchen Prozentsatzes, eine mögliche Größenordnung und die Faktoren, die diesen Prozentsatz beeinflussen, angegeben werden. Ziel ist es, den Durchschnittsverbraucher in die Lage zu versetzen, eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen.
Der EuGH betonte, dass der Umfang der Informationspflicht von den Umständen des Einzelfalls, dem verwendeten Kommunikationsmittel und der Frage abhängt, ob die Informationen zum Geschäfts- und Verantwortungsbereich des Unternehmers gehören oder er sie sich mit zumutbarem Aufwand beschaffen kann.
Zurück in Deutschland: Der Bundesgerichtshof zieht die Konsequenzen (I ZR 65/22)
Mit dieser europäischen Weichenstellung im Rücken traf der BGH nun seine Entscheidung im Fall „Doppeltarifzähler II“.
Die Kernfragen für den BGH
Der BGH musste klären, ob die Informationspraxis des Energieanbieters im Lichte der EuGH-Vorgaben und des deutschen Wettbewerbsrechts (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG) rechtens war. Konkret ging es um zwei zentrale Aspekte:
- Verstößt der Anbieter gegen seine Informationspflichten, indem er die Ausgleichsmenge im Tarifrechner nicht oder unzureichend berücksichtigt und im Bestellprozess nicht explizit auf deren konkrete Höhe hinweist?
- Führt die Darstellung der Preise im Tarifrechner zu einer Irreführung der Verbraucher?
Die Entscheidung: Aufhebung und Zurückverweisung – Was bedeutet das?
Der BGH hob das Urteil des OLG Düsseldorf auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung dorthin zurück. Das bedeutet, der Fall ist bislang nicht endgültig entschieden. Das OLG Düsseldorf muss nun unter Beachtung der Rechtsauffassung des BGH erneut prüfen, ob die Klage der Verbraucherzentrale begründet ist. Die Chancen für die Verbraucherschützer haben sich durch das BGH-Urteil jedoch deutlich verbessert.
Die detaillierten Gründe des BGH – Klartext für Verbraucher
Die Richter des I. Zivilsenats begründeten ihre Entscheidung ausführlich und nahmen dabei insbesondere die §§ 5a und 5b UWG (Irreführung durch Unterlassen wesentlicher Informationen) sowie § 5 UWG (Irreführende geschäftliche Handlungen) in den Blick.
Informationspflichten sind kein Papiertiger (§ 5a, 5b UWG)
Der BGH stellte zunächst fest, dass der Online-Tarifrechner des Anbieters eine sogenannte „Aufforderung zum Kauf“ im Sinne des § 5b Abs. 1 UWG darstellt. Dieser Begriff ist weit zu verstehen: Es reicht, wenn der Verbraucher ausreichend über das Produkt und dessen Preis informiert ist, um eine geschäftliche Entscheidung treffen zu können – sei es der direkte Vertragsabschluss oder auch nur das Aufrufen eines Verkaufsportals oder, wie hier, das Eintreten in einen Bestellvorgang.
Da der Endpreis für Strom von der tatsächlich verbrauchten Menge abhängt und somit nicht exakt im Voraus berechnet werden kann, ist der Anbieter verpflichtet, über die „Art der Preisberechnung“ zu informieren. Hier kommt die Ausgleichsmenge ins Spiel.
Die Crux mit der Zumutbarkeit: Was muss der Anbieter leisten?
Unter Berücksichtigung der EuGH-Rechtsprechung betonte der BGH, dass der Umfang dieser Informationspflicht von den Umständen des Einzelfalls abhängt. Entscheidend ist, ob die Information zum Geschäfts- und Verantwortungsbereich des Unternehmers gehört oder er sie sich mit zumutbarem Aufwand beschaffen kann.
- Bezogen auf den ersten Klageantrag (Preisdarstellung im Tarifrechner): Das OLG Düsseldorf muss nun klären, ob es der Beklagten zumutbar ist, die aktuellen Ausgleichsmengen-Prozentsätze der verschiedenen Netzbetreiber (laut Anbieter über 870 an der Zahl) zu ermitteln und in die Berechnung des Tarifrechners einzubeziehen. Der BGH wies darauf hin, dass die Beklagte vorgetragen hatte, diese Prozentsätze seien oft schwer zu bekommen. Das OLG muss nun den tatsächlichen Aufwand für die Beschaffung und Aktualisierung dieser Daten prüfen.
- Bezogen auf den zweiten Klageantrag (Hinweis auf konkrete Ausgleichsmenge im Bestellvorgang): Auch hier ist die Zumutbarkeit der Informationsbeschaffung maßgeblich. Sollte die Beschaffung der konkreten, standortabhängigen Ausgleichsmenge unzumutbar sein, kann auch keine Pflicht zur Angabe des exakten Prozentsatzes im Bestellvorgang bestehen.
Warum ein Hinweis in den AGB oft nicht reicht
Der BGH machte deutlich, dass der pauschale Hinweis in den AGB der Beklagten, wonach die Ausgleichsmenge „im Gebiet der Netz GmbH aktuell 25 % beträgt“, nicht ausreicht, um die Informationspflicht für alle anderen Netzgebiete zu erfüllen. Wenn die Informationsbeschaffung als zumutbar erachtet wird, dann benötigt der Verbraucher die Angabe des konkreten Prozentsatzes, um eine informierte Entscheidung zu treffen und Angebote vergleichen zu können. Diese Information ist wesentlich, so der BGH, da sie den Gesamtpreis beeinflusst und erst einen echten Preisvergleich mit anderen Anbietern ermöglicht – insbesondere wenn diese andere Ausgleichsmengen ansetzen oder Tarife mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei Hoch- und Niedertarifpreisen anbieten.
Irreführung durch unklare Preise (§ 5 UWG)
Neben dem Vorenthalten wesentlicher Informationen prüfte der BGH auch eine mögliche Irreführung der Verbraucher nach § 5 UWG.
Keine „gespaltene Verkehrsauffassung“: Der durchschnittlich informierte Verbraucher zählt
Hier rügte der BGH einen zentralen Fehler des OLG Düsseldorf. Das Berufungsgericht war von einer „gespaltenen Verkehrsauffassung“ ausgegangen – also der Annahme, dass ein Teil der Verbraucher die Problematik der Ausgleichsmenge versteht, ein anderer Teil nicht. Eine solche Differenzierung innerhalb eines einheitlichen Verkehrskreises (hier: Mieter und Eigentümer von Wohnimmobilien, die Heizstrom beziehen) ist laut BGH aber grundsätzlich unzulässig. Maßgeblich ist das Verständnis des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers.
Das Problem der „falschen Menge“ ist auch ein Problem des „falschen Preises“
Die Argumentation des OLG, die Eingabe falscher Verbrauchswerte sei ein „Mengenproblem“ und kein „Preisproblem“ des Anbieters, ließ der BGH nicht gelten. Wenn die Berechnungsgrundlage unklar ist und der Verbraucher deshalb möglicherweise unzutreffende Werte eingibt, kann der daraus resultierende, im Tarifrechner angezeigte Preis sehr wohl irreführend sein.
Der BGH deutete an, dass es sinnvoll wäre, wenn Verbraucher die abgelesenen Zählerstände vor Berücksichtigung einer etwaigen Ausgleichsmenge in den Tarifrechner eingeben könnten. Dann müsse der Anbieter aber auch klar und verständlich kommunizieren, welche Werte genau einzugeben sind, um zu einer korrekten Preisberechnung zu gelangen. Das OLG Düsseldorf muss nun den Gesamteindruck, den die Preisangabe im Tarifrechner der Beklagten erweckt, neu bewerten.
Bezüglich des zweiten Klageantrags (fehlender Hinweis im Bestellvorgang) sah der BGH hingegen keine Irreführung durch unwahre Angaben. Die Informationen in den AGB der Beklagten zur Ausgleichsmenge seien zwar zutreffend, aber möglicherweise unvollständig – dies ist jedoch eine Frage der Informationspflicht (§ 5a, 5b UWG), nicht der aktiven Irreführung durch Falschangaben.
Das Urteil und Ihr Alltag: Warum „Doppeltarifzähler II“ für Sie relevant ist
Auch wenn der Rechtsstreit nun zurück ans OLG Düsseldorf geht, sendet das BGH-Urteil ein starkes Signal für mehr Verbraucherschutz und Preistransparenz im Energiemarkt.
Mehr Transparenz bei Stromtarifen gefordert
Das Urteil verdeutlicht, dass Energieanbieter sich nicht einfach hinter der Komplexität von Preismodellen verstecken können. Sie stehen in der Pflicht, Verbrauchern die Art der Preisberechnung so zu erläutern, dass diese eine fundierte Entscheidung treffen können. Zwar verlangt der BGH, im Einklang mit dem EuGH, nicht zwingend die Angabe jedes Detailchens im ersten Schritt. Aber die grundlegenden Mechanismen, mögliche Kostenfaktoren wie die Ausgleichsmenge und deren ungefähre Größenordnung müssen klar kommuniziert werden, insbesondere wenn diese Informationen für den Anbieter mit zumutbarem Aufwand beschaffbar sind.
Vorher-Nachher-Betrachtung: Die Rechtslage vor dem Urteil und die neuen Impulse
Vor dieser Entscheidung tendierten Gerichte eher dazu, die Verantwortung für die korrekte Interpretation von Tarifangeboten und die Eingabe passender Verbrauchswerte stärker beim Verbraucher zu sehen. Ein allgemeiner Hinweis auf komplexe Preisbestandteile in den AGB wurde oft als ausreichend erachtet.
Durch das BGH-Urteil, gestützt auf die EuGH-Vorgaben, verschiebt sich diese Balance. Nun rückt die Zumutbarkeit der Informationsbeschaffung und -bereitstellung durch den Anbieter stärker in den Fokus. Unternehmen müssen aktiver dafür sorgen, dass Verbraucher nicht durch intransparente Preismodelle getäuscht oder zu ungünstigen Entscheidungen verleitet werden. Die pauschale Ausrede „Das steht doch alles in den AGB“ zieht nicht mehr ohne Weiteres, wenn wesentliche Informationen für die Kaufentscheidung fehlen oder schwer zugänglich sind.
Konsequenzen für Energieanbieter: mehr Aufwand, aber auch mehr Fairness?
Für Energieanbieter bedeutet dies potenziell mehr Aufwand. Sie müssen prüfen, welche Informationen über Preisbestandteile wie die Ausgleichsmenge sie mit zumutbarem Aufwand ermitteln und ihren Kunden – sei es im Tarifrechner oder im Bestellprozess – zur Verfügung stellen können. Die bloße Angabe von Grund- und Arbeitspreisen reicht bei komplexen Tarifstrukturen oft nicht mehr aus. Langfristig könnte dies jedoch zu faireren Wettbewerbsbedingungen führen, da Anbieter mit versteckten Kostenfallen es schwerer haben dürften.
Was bedeutet das für mich als Stromkunde? Praktische Hinweise
Als Verbraucher, insbesondere wenn Sie Heizstrom über einen Doppeltarifzähler beziehen, können Sie aus diesem Urteil wichtige Erkenntnisse für Ihren Alltag ziehen. Achten Sie bei Online-Tarifvergleichen künftig noch genauer darauf, wie sich der angezeigte Preis zusammensetzt. Fragen Sie sich: Sind alle relevanten Kostenbestandteile berücksichtigt? Gibt es Hinweise auf eine „Ausgleichsmenge“ oder ähnliche pauschale Verrechnungen?
Seien Sie besonders kritisch, wenn ein Angebot signifikant günstiger erscheint als andere. Lesen Sie die Fußnoten und die Produktinformationsblätter sorgfältig. Zwar entbindet das Urteil Verbraucher nicht von jeglicher Sorgfalt, aber es stärkt Ihre Position, transparente und verständliche Informationen zu erhalten.
Wenn Sie sich unsicher sind, wie ein Preis berechnet wird oder welche Werte Sie in einen Tarifrechner eingeben sollen, zögern Sie nicht, direkt beim Anbieter nachzufragen. Fordern Sie eine klare Erläuterung der Preisberechnung, bevor Sie einen Vertrag abschließen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bleiben wichtig. Auch wenn der BGH klargestellt hat, dass wesentliche Informationen nicht ausschließlich dort versteckt werden dürfen, finden sich hier oft Details zur Preisgestaltung. Nehmen Sie sich die Zeit, zumindest die für den Preis relevanten Passagen zu lesen. Sollten Sie nach Vertragsabschluss feststellen, dass Ihnen wesentliche Informationen vorenthalten wurden und der Preis deutlich höher ausfällt als erwartet, kann es sinnvoll sein, sich an eine Verbraucherzentrale zu wenden und die Situation prüfen zu lassen. Das Urteil „Doppeltarifzähler II“ hat die Tür für mehr Klarheit im Strompreis-Dschungel ein Stück weiter aufgestoßen.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Heizstromtarife und Preistransparenz
Nachfolgend beantworten wir die häufigsten Fragen zu unserem Artikel über das BGH-Urteil „Doppeltarifzähler II“ und dessen Auswirkungen für Sie als Stromkunden, insbesondere bei der Nutzung von Heizstrom.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was genau ist diese „Ausgleichsmenge“ noch einmal und warum ist sie bei Heizstromtarifen oft ein Knackpunkt?
Der BGH hat den Fall ja an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen. Heißt das, für mich als Verbraucher ändert sich vorerst noch gar nichts Konkretes?
Mein Energieanbieter hat einen Online-Tarifrechner. Welche Informationen zur „Ausgleichsmenge“ kann ich dort nach diesem Urteil erwarten?
Was bedeutet die „Zumutbarkeit der Informationsbeschaffung“ für den Anbieter genau? Und was, wenn mein Anbieter sagt, er könne die exakte Ausgleichsmenge für mein Gebiet nur schwer ermitteln?
Ich nutze einen Doppeltarifzähler für meine Nachtspeicherheizung. Worauf sollte ich nach diesem Urteil beim Online-Vergleich von Heizstromtarifen jetzt besonders achten?
Im Artikel steht, dass ein Hinweis auf die Ausgleichsmenge in den AGB oft nicht ausreicht. Warum ist das so und wo sollten diese Infos stattdessen stehen?
Klarheit statt Kostenfalle: BGH justiert Heizstrom-Spielregeln neu
Das Urteil zur „Ausgleichsmenge“ ist mehr als eine juristische Feinheit; es ist ein Weckruf für mehr Transparenz im Energiemarkt. Anbieter müssen nun proaktiver über komplexe Preisbestandteile aufklären, wenn die Informationen zumutbar beschaffbar sind, und können sich nicht pauschal auf AGBs berufen.
Für Verbraucher bedeutet dies eine gestärkte Position: Sie können und sollten nun noch genauer auf die Verständlichkeit von Tarifdetails, insbesondere bei variablen Kostenfaktoren, achten. Der bloße Verweis auf das Kleingedruckte reicht für Anbieter künftig seltener aus, um ihre Informationspflichten zu erfüllen.