Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- OLG Celle: Jahrelange Nichtzahlung von Gerichtskosten als fiktive Klagerücknahme – Kostentragungspflicht des Arbeitnehmers bestätigt
- Streit um Lohnzahlung: Vom Arbeitsgericht zum Landgericht Hannover
- Gerichtskostenvorschuss nicht gezahlt: Stillstand des Verfahrens vor dem Landgericht
- Antrag der Arbeitgeber: Kostenentscheidung wegen mutmaßlicher Klagerücknahme
- Landgericht Hannover: Zunächst Ablehnung, dann Kostenauferlegung nach fiktiver Rücknahme
- Beschwerde des Arbeitnehmers: Zuständigkeit des Landgerichts und Klagerücknahme bestritten
- OLG Celle weist Beschwerde zurück: Arbeitnehmer trägt die Kosten des Rechtsstreits
- Begründung des OLG Celle: Verbindlichkeit der Verweisung an das Landgericht gemäß § 17a GVG
- Begründung des OLG Celle: Fiktive Klagerücknahme nach § 269 ZPO durch jahrelange Untätigkeit
- Begründung des OLG Celle: Keine Schutzlosigkeit des Arbeitnehmers – Prozesskostenhilfe als Option
- Kosten der Beschwerde und keine Rechtsbeschwerde zugelassen
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet „fiktive Klagerücknahme“ und welche Folgen hat sie?
- Warum muss ein Gerichtskostenvorschuss gezahlt werden und was passiert, wenn man ihn nicht bezahlt?
- Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsgericht und Landgericht und warum wurde der Fall zwischen den Gerichten verschoben?
- Was bedeutet Kostentragungspflicht und wer muss die Gerichtskosten bezahlen?
- Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man sich die Gerichtskosten nicht leisten kann?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 14 W 7/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Celle
- Verfahrensart: Sofortige Beschwerde
- Rechtsbereiche: Zivilprozessordnung, Gerichtskostengesetz, Gerichtsverfassungsgesetz
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die Partei, die den ursprünglichen Rechtsstreit eingeleitet hat und gegen die Kostenentscheidung des Landgerichts Beschwerde einlegt.
- Beklagte: Die Partei, die im ursprünglichen Rechtsstreit verklagt wurde und eine Kostenentscheidung beantragte.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Ein Teil einer ursprünglichen Klage wurde vom Arbeitsgericht an das Landgericht verwiesen. Das Landgericht forderte den Kläger zur Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses auf. Der Kläger zahlte diesen Vorschuss über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren nicht ein. Die Beklagten beantragten daraufhin, dem Kläger die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, da sie dies als Klagerücknahme werteten.
- Kern des Rechtsstreits: Die Kernfrage war, ob die jahrelange Nichtzahlung eines angeforderten Gerichtskostenvorschusses in einem den Beklagten bekannten Verfahren als fiktive Klagerücknahme angesehen werden kann, die zur Kostentragungspflicht des Klägers führt.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Oberlandesgericht hat die sofortige Beschwerde des Klägers gegen die Kostenentscheidung des Landgerichts zurückgewiesen. Der Kläger muss die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen.
- Begründung: Die Zuständigkeit des Landgerichts durch den Verweisungsbeschluss war bindend. Die Nichtzahlung des Vorschusses über Jahre stellte unter den besonderen Umständen (Rechtshängigkeit, Kenntnis der Beklagten, potenzielle Kosten der Beklagten) eine fiktive Klagerücknahme dar. Dies rechtfertigt eine Kostenentscheidung zugunsten der Beklagten, vergleichbar einer ausdrücklichen Klagerücknahme.
- Folgen: Der Kläger trägt die Kosten des ursprünglichen Rechtsstreits für die abgetrennten Ansprüche sowie die Kosten seiner erfolglosen sofortigen Beschwerde. Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.
Der Fall vor Gericht
OLG Celle: Jahrelange Nichtzahlung von Gerichtskosten als fiktive Klagerücknahme – Kostentragungspflicht des Arbeitnehmers bestätigt
Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat in einem Beschluss klargestellt, unter welchen Umständen das jahrelange Ausbleiben der Zahlung eines angeforderten Gerichtskostenvorschusses als fiktive Klagerücknahme gewertet werden kann.
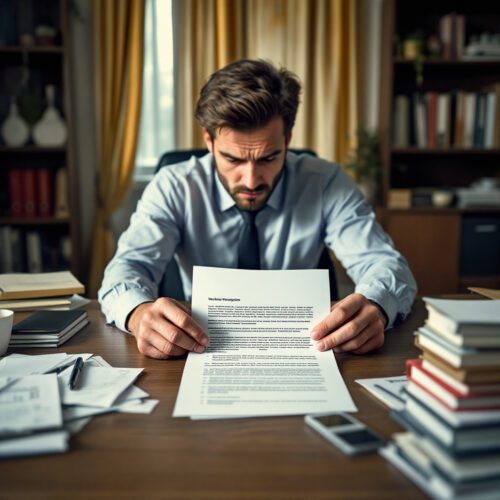
Dies hat zur Folge, dass derjenige, der die Klage ursprünglich eingereicht hat, die gesamten Kosten des Verfahrens tragen muss, auch wenn er die Klage nicht ausdrücklich zurückgenommen hat. Die Entscheidung betraf einen Rechtsstreit, der ursprünglich vor dem Arbeitsgericht begann und später teilweise an das Landgericht verwiesen wurde.
Streit um Lohnzahlung: Vom Arbeitsgericht zum Landgericht Hannover
Der Ausgangspunkt des Falles war eine Klage eines Arbeitnehmers vor dem Arbeitsgericht (ArbG) Hannover, die bereits am 20. August 2019 eingereicht wurde. Der Arbeitnehmer forderte unter anderem die Feststellung eines Arbeitsverhältnisses und mit einem spezifischen Antrag (Ziffer 6) die Abrechnung und Auszahlung von Nettolohn für von ihm behauptete Arbeitsleistungen gegenüber seinen ehemaligen Arbeitgebern.
Nach mehreren Verhandlungen entschied das Arbeitsgericht Hannover am 6. März 2020, den Antrag bezüglich der Lohnzahlung (Antrag zu 6) vom restlichen Verfahren abzutrennen. Kurz darauf, mit Beschluss vom 11. März 2020, verwies das Arbeitsgericht diesen abgetrennten Teil des Rechtsstreits an das Landgericht (LG) Hannover, da es sich hierfür nicht für zuständig hielt.
Gegen diese Verweisung legte der Arbeitnehmer sofortige Beschwerde ein. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen prüfte die Sache und änderte die Entscheidung teilweise ab: Für Lohnansprüche bis zum 19. Mai 2015 sei der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten doch zulässig. Für die später entstandenen Entgeltansprüche, nämlich ab dem 20. Oktober 2015, wies das LAG die Beschwerde des Arbeitnehmers jedoch zurück und bestätigte damit indirekt die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte (hier: Landgericht). Eine vom Arbeitnehmer daraufhin beim Bundesarbeitsgericht (BAG) eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde als unzulässig verworfen.
Schließlich gab das Arbeitsgericht Hannover mit Beschluss vom 3. August 2021 das Verfahren bezüglich der Lohnansprüche ab dem 20. Oktober 2015 endgültig an das Landgericht Hannover ab, wie ursprünglich am 11. März 2020 beschlossen.
Gerichtskostenvorschuss nicht gezahlt: Stillstand des Verfahrens vor dem Landgericht
Nachdem die Sache beim Landgericht Hannover eingegangen war, setzte dieses zunächst einen vorläufigen Streitwert fest. Basierend darauf forderte das Gericht vom Arbeitnehmer mit einer Vorschusskostenrechnung vom 31. August 2021, die später am 20. April 2022 korrigiert wurde, die Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses gemäß § 12 Gerichtskostengesetz (GKG). Dies ist eine übliche Vorgehensweise, da Gerichtsverfahren in der Regel erst nach Zahlung eines Vorschusses weiterbetrieben werden. In der korrigierten Rechnung vom 20. April 2022 wurde der Arbeitnehmer ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zustellung wichtiger gerichtlicher Dokumente an die Gegenseite (hier die Arbeitgeber) gemäß § 12 Abs. 1 GKG erst nach Eingang der Gebühr erfolgen würde.
Obwohl der vorläufige Streitwertbeschluss den Arbeitgebern zugestellt wurde, welche daraufhin am 10. September 2021 reagierten und die Abweisung der Klage beantragten, zahlte der Arbeitnehmer den angeforderten Kostenvorschuss nicht.
Monate vergingen ohne Zahlungseingang. Am 21. Oktober 2022 wurde dennoch eine Kostenrechnung über eine Verfahrensgebühr erstellt und dem Arbeitnehmer in Rechnung gestellt. Daraufhin bat der Arbeitnehmer mit Schreiben vom 29. Oktober 2022 um Stundung des Betrages, was auf finanzielle Schwierigkeiten hindeuten könnte. Die Zahlung des Vorschusses blieb jedoch weiterhin aus.
Antrag der Arbeitgeber: Kostenentscheidung wegen mutmaßlicher Klagerücknahme
Da das Verfahren aufgrund der fehlenden Vorschusszahlung nicht vorankam, stellten die Arbeitgeber am 22. Februar 2023 beim Landgericht Hannover einen Antrag. Sie beantragten, dem Arbeitnehmer gemäß § 269 Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO) die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Ihre Begründung: Das Verfahren sei faktisch „nach Rücknahme der Klage aufgrund Nichteinzahlung des Gerichtskostenvorschusses“ beendet.
Der Arbeitnehmer widersprach diesem Antrag. Er erklärte, er habe keineswegs die Klage zurückgenommen. Der Grund für die Nichtzahlung sei ein laufender Streit mit seiner Rechtsschutzversicherung über die Kostenübernahme. Das Verfahren ruhe lediglich, sei aber nicht beendet.
Landgericht Hannover: Zunächst Ablehnung, dann Kostenauferlegung nach fiktiver Rücknahme
Das Landgericht Hannover wies den Antrag der Arbeitgeber zunächst mit Beschluss vom 4. April 2023 zurück. Die zuständige Richterin sah zu diesem Zeitpunkt keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Klagerücknahme.
Die Arbeitgeber legten gegen diesen Beschluss am 19. April 2023 sofortige Beschwerde ein. Nach erneuter Prüfung, Gewährung rechtlichen Gehörs und einem entsprechenden Hinweis änderte die Richterin ihre Meinung. Mit Beschluss vom 23. Mai 2023 hob sie ihren vorherigen Beschluss auf und entschied nun doch, dass der Arbeitnehmer die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO zu tragen habe. Sie ging nunmehr von einer fiktiven Klagerücknahme aus.
Beschwerde des Arbeitnehmers: Zuständigkeit des Landgerichts und Klagerücknahme bestritten
Dieser für den Arbeitnehmer nachteilige Beschluss wurde ihm erst sehr viel später, am 26. Februar 2024, zugestellt. Unmittelbar darauf, am 28. Februar 2024, legte der Arbeitnehmer seinerseits sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Celle ein.
Er argumentierte hauptsächlich, dass das Landgericht gar nicht zuständig sei, über die Kosten oder eine vermeintliche Klagerücknahme zu entscheiden. Seiner Ansicht nach handele es sich um eine arbeitsgerichtliche Streitigkeit, und die ursprüngliche Verweisung an das Landgericht sei fehlerhaft gewesen. Er verwies zudem auf eine Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung, die zwischenzeitlich ein abhängiges Arbeitsverhältnis bestätigt habe, was seine ursprüngliche Position im arbeitsgerichtlichen Verfahren stützen sollte. Das Landgericht half dieser Beschwerde nicht ab, sodass das OLG Celle darüber entscheiden musste.
OLG Celle weist Beschwerde zurück: Arbeitnehmer trägt die Kosten des Rechtsstreits
Das OLG Celle wies die sofortige Beschwerde des Arbeitnehmers mit seinem Beschluss als unbegründet zurück. Die Entscheidung des Landgerichts, dem Arbeitnehmer die Kosten aufzuerlegen, wurde damit bestätigt. Der Arbeitnehmer muss somit die Kosten des Rechtsstreits tragen, die bis zur Annahme der fiktiven Klagerücknahme entstanden sind. Eine weitere Beschwerde (Rechtsbeschwerde) ließ das OLG nicht zu.
Begründung des OLG Celle: Verbindlichkeit der Verweisung an das Landgericht gemäß § 17a GVG
Zunächst setzte sich das OLG mit dem Argument des Arbeitnehmers auseinander, das Landgericht sei unzuständig gewesen. Dieses Argument ließ das Gericht nicht gelten. Es verwies auf § 17a Abs. 2 Satz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG). Diese Vorschrift besagt, dass ein Verweisungsbeschluss, mit dem ein Gericht eine Sache an ein anderes Gericht abgibt, für das aufnehmende Gericht bindend ist. Der ursprüngliche Verweisungsbeschluss des Arbeitsgerichts Hannover vom 6. März 2020 (bestätigt durch LAG und BAG für den relevanten Zeitraum) war rechtskräftig geworden. Das Landgericht Hannover war daher an diese Verweisung gebunden und somit für die Entscheidung zuständig.
Begründung des OLG Celle: Fiktive Klagerücknahme nach § 269 ZPO durch jahrelange Untätigkeit
Der Kern der Entscheidung des OLG Celle lag in der Bestätigung der Annahme einer fiktiven Klagerücknahme. Zwar sieht § 269 Abs. 2 ZPO normalerweise vor, dass eine Klagerücknahme durch eine ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Gericht erfolgen muss. Eine solche Erklärung hatte der Arbeitnehmer nie abgegeben.
Das OLG schloss sich jedoch der Auffassung des Landgerichts an, dass das Nichtweiterbetreiben des Verfahrens durch die konsequente Nichtzahlung des Kostenvorschusses über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren unter den besonderen Umständen dieses Falles einer Klagerücknahme gleichzustellen ist. Dies rechtfertige die Anwendung der Kostenfolge des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, wonach der Kläger (hier der Arbeitnehmer) die Kosten trägt.
Besondere Umstände rechtfertigen Annahme der Rücknahme
Das OLG betonte, dass diese Auslegung nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich ist und nannte die spezifischen Umstände, die hier vorlagen:
- Rechtshängigkeit: Die Klage war den Arbeitgebern bereits im arbeitsgerichtlichen Verfahren zugestellt worden. Nach der Verweisung an das Landgericht war der Rechtsstreit dort gemäß § 17b Abs. 1 Satz 2 GVG weiterhin rechtshängig. Das bedeutet, das Verfahren war offiziell anhängig und den Parteien bekannt.
- Kenntnis der Arbeitgeber: Die Arbeitgeber hatten durch das Vorverfahren und die Übersendung des Streitwertbeschlusses des Landgerichts Kenntnis von dem beim Landgericht anhängigen Verfahren und mussten sich damit befassen. Es war nicht auszuschließen, dass ihnen dadurch bereits Kosten entstanden waren (z.B. Anwaltskosten).
- Vorschusspflicht nach § 12 GKG: Obwohl die Klage ursprünglich ohne Vorschuss zugestellt wurde (was im Arbeitsrecht üblich ist), durfte das Landgericht nach der Verweisung gemäß § 12 GKG weitere Handlungen von der Zahlung des Vorschusses abhängig machen.
Schutz der Arbeitgeberinteressen bei Verfahrensstillstand
In dieser Konstellation sahen die Richter ein berechtigtes Bedürfnis, eine Kostentragungsregelung herbeizuführen. Die Interessenlage sei vergleichbar mit einer ausdrücklichen Klagerücknahme. Wenn ein Kläger über Jahre hinweg den notwendigen Kostenvorschuss nicht zahlt und das Gericht deshalb untätig bleiben muss, obwohl die Klage bereits zugestellt ist und die Beklagten Kenntnis haben, sei dieses Verhalten als endgültige Absicht zu werten, das Verfahren nicht weiterzuverfolgen.
Die Arbeitgeber hätten ein schutzwürdiges Interesse daran, eine Entscheidung über die bis dahin entstandenen Kosten zu erhalten. Es wäre unzumutbar, sie auf andere Wege zur Kostenerstattung zu verweisen. Beispielsweise wäre es nicht sachgerecht, sie auf einen möglichen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch zu verweisen, der unter Umständen in einem separaten, neuen Gerichtsverfahren durchgesetzt werden müsste. Ebenso wenig könne man von den Arbeitgebern verlangen, selbst den Kostenvorschuss einzuzahlen, nur um das Verfahren fortzuführen und eine Kostenentscheidung zu erwirken.
Begründung des OLG Celle: Keine Schutzlosigkeit des Arbeitnehmers – Prozesskostenhilfe als Option
Das OLG stellte klar, dass der Arbeitnehmer durch diese Auslegung nicht schutzlos gestellt war. Wenn er, wie durch seinen Stundungsantrag angedeutet, tatsächlich nicht über die finanziellen Mittel zur Zahlung des Vorschusses verfügte, hätte er Prozesskostenhilfe (PKH) beantragen können. Bei Bewilligung von PKH hätte der Staat die Kosten vorgestreckt. Alternativ hätte er versuchen können, die Voraussetzungen des § 14 Satz 3 GKG glaubhaft zu machen, um eventuell von der Vorschusspflicht befreit zu werden (was jedoch nur in Eilfällen relevant ist und hier wohl nicht zutraf). Da er diese Wege nicht beschritten, sondern das Verfahren über Jahre hinweg durch Nichtzahlung blockiert habe, müsse er die Konsequenz der fiktiven Klagerücknahme und der damit verbundenen Kostentragungspflicht hinnehmen.
Kosten der Beschwerde und keine Rechtsbeschwerde zugelassen
Die Kosten für das erfolglose Beschwerdeverfahren vor dem OLG Celle muss ebenfalls der Arbeitnehmer tragen. Dies ergibt sich aus den allgemeinen Regeln der Zivilprozessordnung (§§ 91, 97 ZPO). Die Möglichkeit einer weiteren Beschwerde zum Bundesgerichtshof (Rechtsbeschwerde) wurde nicht zugelassen, da der Fall laut OLG keine grundsätzliche Bedeutung hat und auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des obersten Zivilgerichts erfordert (§ 574 Abs. 2 ZPO).
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass die jahrelange Nichtzahlung eines Gerichtskostenvorschusses zur „fiktiven Klagerücknahme“ führen kann, was die Kostentragungspflicht für den ursprünglichen Kläger nach sich zieht – selbst ohne ausdrückliche Rücknahmeerklärung. Bei finanziellen Schwierigkeiten sollte man statt Untätigkeit Prozesskostenhilfe beantragen, da sonst das Risiko besteht, dass das Verfahren als aufgegeben gilt und sämtliche Verfahrenskosten zu tragen sind. Die Entscheidung schützt beklagte Parteien, die nicht unbegrenzt in der Ungewissheit eines blockierten Verfahrens verharren müssen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet „fiktive Klagerücknahme“ und welche Folgen hat sie?
Eine „fiktive Klagerücknahme“ ist ein juristischer Begriff, der bedeutet, dass Ihre Klage vor Gericht als zurückgenommen gilt, obwohl Sie sie nicht ausdrücklich selbst zurückgenommen haben.
Warum wird eine Klage fiktiv zurückgenommen?
Das passiert in der Regel, wenn das Gericht Sie auffordert, einen Gerichtskostenvorschuss zu bezahlen, damit es mit der Bearbeitung der Klage beginnen kann. Dieser Vorschuss deckt erste Kosten des Gerichts ab, zum Beispiel für die Zustellung von Dokumenten an die Gegenseite. Das Gericht setzt Ihnen dafür eine Frist.
Wenn Sie diesen Gerichtskostenvorschuss innerhalb der gesetzten Frist nicht bezahlen, geht das Gesetz davon aus, dass Sie Ihre Klage nicht mehr weiterverfolgen möchten. Es wird so behandelt, als hätten Sie die Klage selbst zurückgezogen. Diesen Zustand nennt man dann „fiktive Klagerücknahme“.
Welche Folgen hat eine fiktive Klagerücknahme?
Die fiktive Klagerücknahme hat klare und wichtige Folgen:
- Das Gerichtsverfahren endet: Das Gericht wird Ihre Klage nicht weiterbearbeiten. Es gibt keine Verhandlung und keine Entscheidung des Gerichts in der Sache (also darüber, wer im Recht ist). Das Verfahren wird beendet.
- Sie tragen die Kosten: Dies ist eine der wichtigsten Folgen. Wer die Klage eingereicht hat und durch Nichtzahlung des Vorschusses die fiktive Klagerücknahme verursacht, muss in der Regel die gesamten Kosten des Verfahrens tragen. Dazu gehören die bisher angefallenen Gerichtskosten sowie oft auch die Kosten, die der Gegenseite durch das Verfahren entstanden sind (z.B. deren Anwaltskosten), soweit diese notwendig waren.
Es ist also sehr wichtig, auf Aufforderungen des Gerichts zur Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses und die gesetzten Fristen zu achten. Das Nichtbezahlen hat gravierende Folgen für den Fortgang der Klage und kann erhebliche Kosten nach sich ziehen, selbst wenn das Gericht die Klage inhaltlich gar nicht geprüft hat.
Warum muss ein Gerichtskostenvorschuss gezahlt werden und was passiert, wenn man ihn nicht bezahlt?
Wenn Sie ein Gerichtsverfahren beginnen möchten, verlangen die Gerichte in der Regel, dass Sie zunächst einen Gerichtskostenvorschuss bezahlen. Stellen Sie sich das wie eine Art Anzahlung oder Kaution vor, die fällig wird, bevor eine Dienstleistung erbracht wird.
Dieser Vorschuss dient dazu, die ersten Ausgaben des Gerichtsverfahrens zu decken. Dazu gehören zum Beispiel die Kosten für das Versenden von Schreiben an die Beteiligten (sogenannte Zustellungen) oder andere notwendige administrative Tätigkeiten, die das Gericht ausführen muss, um Ihren Fall überhaupt bearbeiten zu können. Das Gesetz sieht vor, dass das Gericht diesen Vorschuss anfordern kann. Es stellt sicher, dass zumindest die grundlegenden Kosten für die Einleitung und Bearbeitung des Verfahrens gedeckt sind. Ohne diese Zahlung beginnt das Gericht in der Regel nicht, sich mit Ihrem Fall zu beschäftigen oder ihn voranzutreiben.
Welche Folgen hat die Nichtzahlung des Vorschusses?
Wenn Sie die Aufforderung des Gerichts zur Zahlung des Gerichtskostenvorschusses ignorieren oder die Zahlung nicht innerhalb der gesetzten Frist leisten, hat dies direkte Auswirkungen auf Ihr Verfahren.
Das Gericht wird Ihnen zunächst wahrscheinlich Erinnerungen schicken und Ihnen eine neue Frist für die Zahlung setzen. Zahlen Sie den Vorschuss auch dann nicht, obwohl Sie dazu verpflichtet sind, wird das Gericht Ihr Verfahren nicht weiter bearbeiten.
Dies kann dazu führen, dass Ihre Klage oder Ihr Antrag vom Gericht als zurückgenommen betrachtet wird oder dass das Gericht Ihren Fall abweist. Im Wesentlichen bedeutet das: Ihr Verfahren endet, bevor es richtig begonnen hat, weil die notwendige Voraussetzung für die Bearbeitung – die Zahlung des Vorschusses – nicht erfüllt wurde. Ihr Anliegen wird inhaltlich nicht geprüft und es ergeht keine Entscheidung zur Sache.
Es ist somit entscheidend, auf eine Zahlungsaufforderung für einen Gerichtskostenvorschuss zu reagieren, um die Bearbeitung Ihres Verfahrens nicht zu gefährden.
Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsgericht und Landgericht und warum wurde der Fall zwischen den Gerichten verschoben?
In Deutschland gibt es verschiedene Gerichtsbarkeiten für unterschiedliche Rechtsgebiete. Man kann sich das wie spezialisierte Fachärzte vorstellen.
Spezialisierung der Gerichte
Der Hauptunterschied liegt in den Arten von Streitigkeiten, mit denen sich die Gerichte befassen:
- Das Arbeitsgericht ist, wie der Name schon sagt, spezialisiert auf alle Streitigkeiten, die typischerweise im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis entstehen. Das können zum Beispiel Klagen gegen eine Kündigung, Streitigkeiten um Lohn oder Urlaub oder auch Fragen zu Arbeitszeugnissen sein. Es befasst sich also mit dem individuellen Arbeitsrecht und oft auch mit Fragen des Tarifvertragsrechts oder Betriebsverfassungsrechts.
- Das Landgericht ist ein Gericht der allgemeinen ordentlichen Gerichtsbarkeit. Es befasst sich mit vielen anderen zivilrechtlichen Streitigkeiten, die nichts direkt mit einem Arbeitsverhältnis zu tun haben. Das können zum Beispiel Streitigkeiten aus Kaufverträgen, Mietverträgen (Wohnungsmiete wird oft vor Amtsgerichten verhandelt, aber größere Fälle oder Gewerbemiete können auch vor dem Landgericht landen), Schadensersatzforderungen nach einem Unfall oder andere wirtschaftliche Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen oder Privatpersonen sein.
Warum ein Fall verschoben werden kann
Manchmal kommt es vor, dass ein Fall zunächst beim falschen Gericht landet. Das passiert, wenn die ursprünglich eingereichte Klage nicht genau die Art von Streitigkeit betrifft, für die das Gericht zuständig ist.
Wenn Sie zum Beispiel eine Klage einreichen, weil Sie der Meinung sind, ein bestimmter Vertrag sei ungültig, und dieser Vertrag hat zwar indirekt mit einer Arbeitsbeziehung zu tun, die Klage zielt aber eigentlich auf eine allgemeine zivilrechtliche Frage außerhalb des Kernbereichs des Arbeitsrechts ab (wie zum Beispiel eine allgemeine Vertragsanfechtung oder Schadensersatz aus einem anderen Grund), dann kann es sein, dass das Arbeitsgericht feststellt, dass es für diese konkrete Frage nicht zuständig ist.
In solchen Fällen verweist das Arbeitsgericht den Fall an das sachlich und örtlich zuständige Landgericht. Für Sie als Beteiligten bedeutet das, dass der Fall vom einen Gericht zum anderen übergeben wird, um sicherzustellen, dass er von der richtigen „Fachabteilung“ der Justiz bearbeitet wird. Dieser Wechsel stellt sicher, dass die spezialisierten Regeln und Verfahren der jeweils zuständigen Gerichtsbarkeit angewendet werden. Die Verweisung ist gesetzlich vorgesehen, um sicherzustellen, dass jeder Fall vor dem Gericht landet, das rechtlich dafür zuständig ist.
Was bedeutet Kostentragungspflicht und wer muss die Gerichtskosten bezahlen?
Die Kostentragungspflicht ist die Verpflichtung, die Kosten eines Gerichtsverfahrens zu bezahlen. Wenn ein Gericht über eine Klage entscheidet, bestimmt es am Ende auch, wer die Ausgaben für das Verfahren tragen muss. Diese Kosten können Gerichtsgebühren und die Kosten der am Verfahren beteiligten Anwälte umfassen.
Grundsätzlich gilt in vielen Gerichtsverfahren das Prinzip: Die Partei, die den Prozess vollständig verliert, muss in der Regel die gesamten Verfahrenskosten tragen. Das bedeutet, sie zahlt nicht nur die Gerichtskosten, sondern auch die Kosten des gegnerischen Anwalts.
Gewinnt eine Partei nur teilweise und verliert die andere Partei ebenfalls nur teilweise (man spricht von teilweisem Obsiegen und teilweisem Unterliegen), werden die Kosten des Verfahrens oft im Verhältnis zum Erfolg und Misserfolg aufgeteilt. Hat zum Beispiel jemand nur die Hälfte dessen zugesprochen bekommen, was er gefordert hat, kann es sein, dass er auch nur die Hälfte der Kosten tragen muss, und die andere Partei die restliche Hälfte.
Wenn sich die Parteien während des Verfahrens einigen (einen Vergleich schließen), können sie in der Regel auch eine eigene Regelung zur Kostentragung treffen. Oft vereinbaren sie dann, dass jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten selbst trägt und die Gerichtskosten geteilt werden.
In manchen Gerichtsbarkeiten gibt es auch besondere Regeln. Zum Beispiel tragen im Arbeitsrecht die Parteien in der ersten Instanz oft ihre eigenen Anwaltskosten selbst, unabhängig davon, wer den Prozess gewinnt oder verliert.
Die Höhe der Kosten hängt meist vom Streitwert ab, also dem Wert dessen, worum im Gerichtsverfahren gestritten wird. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel auch die Gerichtsgebühren und die Anwaltskosten.
Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man sich die Gerichtskosten nicht leisten kann?
Wenn Sie ein gerichtliches Verfahren führen müssen, aber nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, gibt es in Deutschland Unterstützungsmöglichkeiten, um Ihnen den Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Der Staat bietet in solchen Fällen unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe an.
Die Prozesskostenhilfe (PKH) ist die wichtigste Form dieser Unterstützung. Sie hilft Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse die Kosten für einen Prozess nicht aufbringen können. Die Prozesskostenhilfe kann die Kosten des Gerichts und unter bestimmten Umständen auch die Kosten für einen Rechtsanwalt übernehmen.
Voraussetzung für Prozesskostenhilfe ist, dass Sie nach Ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten des Verfahrens nicht, nur teilweise oder nur in Raten aufbringen können. Dabei werden Ihr Einkommen und Ihr Vermögen berücksichtigt.
Zusätzlich zu den finanziellen Voraussetzungen muss Ihre beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg haben und nicht mutwillig erscheinen.
- Hinreichende Aussicht auf Erfolg bedeutet, dass das Gericht nach einer ersten Prüfung die Chance sieht, dass Sie mit Ihrem Anliegen im Prozess gewinnen könnten. Es muss also eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Ihren Erfolg bestehen.
- Mutwillig bedeutet, dass jemand einen Prozess führen will, obwohl eine verständige Person ohne finanzielle Schwierigkeiten dies nicht tun würde, zum Beispiel, weil das Ziel auch auf einfacherem Weg erreicht werden könnte.
Wird Ihnen Prozesskostenhilfe bewilligt, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Kosten für immer vom Staat übernommen werden. Das Gericht kann anordnen, dass Sie die Kosten in Raten zurückzahlen müssen, wenn sich Ihre finanzielle Situation innerhalb von vier Jahren nach Ende des Verfahrens verbessert.
Neben der Prozesskostenhilfe kann in Ausnahmefällen auch eine Stundung der Gerichtskosten in Betracht kommen. Dabei werden die Gerichtskosten fällig, aber die Zahlung wird aufgeschoben. Dies ist jedoch seltener und oft mit bestimmten Bedingungen verbunden.
Diese staatlichen Hilfen sollen sicherstellen, dass finanzielle Engpässe kein Hindernis für die Durchsetzung berechtigter Ansprüche vor Gericht darstellen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Gerichtskostenvorschuss
Ein Gerichtskostenvorschuss ist eine Vorauszahlung, die das Gericht vom Kläger verlangt, bevor es das Verfahren aktiv weiterführt. Er dient dazu, die anfänglichen Kosten des Verfahrens zu decken, beispielsweise für die Zustellung von Schriftsätzen an die Gegenseite oder andere Verwaltungstätigkeiten des Gerichts (§ 12 Gerichtskostengesetz – GKG). Ohne diese Zahlung bleibt das Verfahren meist ruhend oder wird eingestellt. Wird der Vorschuss nicht innerhalb einer gesetzten Frist entrichtet, kann das Gericht dies als Absicht werten, das Verfahren nicht weiter zu verfolgen.
Beispiel: Wenn Sie eine Klage einreichen, fordert das Gericht oft zuerst einen Vorschuss, ähnlich wie eine Kaution, bevor es Briefe an den Gegner schicken oder Termine ansetzen kann.
Fiktive Klagerücknahme
Die fiktive Klagerücknahme bezeichnet eine rechtliche Konstruktion, bei der das Gericht annimmt, dass der Kläger seine Klage zurückgenommen hat, obwohl er dies nie ausdrücklich erklärt hat (§ 269 Abs. 3 ZPO). Dies geschieht typischerweise, wenn der Kläger über längere Zeit die erforderlichen Gerichtskosten oder Vorschüsse nicht zahlt und das Verfahren deswegen nicht fortgesetzt wird. In solchen Fällen endet das Verfahren, und der Kläger muss die Kosten tragen, als hätte er aktiv auf die Klage verzichtet.
Beispiel: Wenn Sie aufgefordert werden, den Kostenvorschuss zu zahlen, es aber Jahre lang nicht tun, behandelt das Gericht das so, als hätten Sie die Klage selbst zurückgezogen.
Verweisungsbeschluss (§ 17a GVG)
Ein Verweisungsbeschluss ist eine gerichtliche Anordnung, bei der ein Gericht eine ihm vorgelegte Sache an ein anderes Gericht übergibt, weil dieses für den Fall zuständiger ist (§ 17a Gerichtsverfassungsgesetz – GVG). Dies ist verbindlich für das aufnehmende Gericht, das den Fall dann weiter bearbeitet. Ziel ist es, die Zuständigkeit der Gerichte korrekt zuzuordnen und Streitigkeiten vor dem passenden Gericht zu klären.
Beispiel: Wenn eine Klage ursprünglich beim Arbeitsgericht eingereicht wird, das aber keinen Vorrang für den konkreten Anspruch hat, wird der Fall formal an das Landgericht „verwiesen“ (übergeben), das dann zuständig ist.
Rechtshängigkeit
Rechtshängigkeit bedeutet, dass ein Gerichtsverfahren über einen Streitgegenstand offiziell anhängig ist; das heißt, das Gericht hat den Streitgegenstand angenommen und das Verfahren läuft formal (§ 17b GVG). Die Rechtshängigkeit tritt ein, sobald die Klage wirksam erhoben und dem Gegner zugestellt wurde. Sie ist wichtig, da bestimmte Rechtswirkungen erst mit der Rechtshängigkeit verbunden sind, etwa das Verbot weiterer Verfahren zum gleichen Streitgegenstand.
Beispiel: Sobald das Gericht einer Streitigkeit einen Aktenzeichen zuweist und die Klage an den Gegner zugestellt ist, gilt der Fall als rechtshängig.
Kostentragungspflicht
Die Kostentragungspflicht verpflichtet die unterliegende Partei in einem Gerichtsverfahren, die entstehenden Kosten des Verfahrens zu bezahlen, einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten (§ 91, § 97 ZPO). Grundsätzlich trägt die unterlegene Partei die Kosten, da sie durch das Verfahren belastet wurde. Bei Teil-Erfolg oder Vergleichen kann die Kostentragung aufgeteilt werden. Im Fall einer fiktiven Klagerücknahme muss der Kläger die gesamten Kosten tragen, obwohl keine tatsächliche inhaltliche Entscheidung getroffen wurde.
Beispiel: Wenn Sie vor Gericht klagen und das Gericht die Klage abweist, müssen Sie meist auch die Kosten für das Verfahren und die Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO: Diese Vorschrift regelt, dass der Kläger bei Rücknahme der Klage die Kosten des Verfahrens tragen muss, sofern nichts anderes bestimmt ist. Obwohl eine Klagerücknahme normalerweise ausdrücklich erklärt werden muss, kann unter besonderen Umständen ein schweigendes Verhalten als fiktive Rücknahme gewertet werden. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG wertete die jahrelange Nichtzahlung des Gerichtskostenvorschusses als solchen besonderen Ausnahmefall und stellte fest, dass dies einer Klagerücknahme gleichkommt, wodurch der Arbeitnehmer die Kosten tragen muss.
- § 12 Abs. 1 GKG: Dieses Gesetz regelt die Verpflichtung zur Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses, der vor Weiterführung eines Zivilverfahrens zu leisten ist, um die Verfahrenskosten sicherzustellen. Die Zustellung gerichtlicher Dokumente an die Gegenpartei ist erst nach Eingang dieses Vorschusses vorgesehen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht setzte den Kostenvorschuss fest und machte die Verfahrensfortsetzung von dessen Zahlung abhängig; das Ausbleiben der Zahlung führte zum Stillstand des Verfahrens und zur Annahme der fiktiven Klagerücknahme.
- § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG: Diese Vorschrift bestimmt, dass Verweisungsbeschlüsse zwischen Gerichten bindend sind, sodass das aufnehmende Gericht zuständig ist, wenn ein Verfahren von einem anderen Gericht verwiesen wird. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG bestätigte die Zuständigkeit des Landgerichts für den abgetrennten Teil der Klage, da die Verweisung vom Arbeitsgericht rechtskräftig war, wodurch die Entscheidung über Kosten inkl. fiktiver Klagerücknahme in dessen Zuständigkeit fiel.
- § 91 ZPO: § 91 regelt die Kostenentscheidung im Prozess, wonach grundsätzlich die unterliegende Partei die Kosten zu tragen hat. § 97 konkretisiert die Kostenlast bei Beschwerden und Rechtsmitteln. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die sofortige Beschwerde des Arbeitnehmers gegen die Kostenentscheidung erfolglos blieb, wurden ihm auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.
- § 14 Satz 3 GKG: Diese Vorschrift ermöglicht unter besonderen Umständen die Befreiung von der Kostenvorschusszahlung, beispielsweise bei ernsthafter finanzieller Unmöglichkeit. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG führte an, dass der Arbeitnehmer die Möglichkeit gehabt hätte, eine Befreiung vom Kostenvorschuss zu beantragen, was er jedoch unterließ; dies rechtfertigt die Annahme der fiktiven Klagerücknahme.
- § 17b Abs. 1 Satz 2 GVG: Bestimmt, dass bei Verweisung eines Verfahrens die Rechtshängigkeit beim aufnehmenden Gericht fortbesteht. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Verfahren blieb nach Verweisung an das Landgericht formell anhängig, womit die Interessen der Arbeitgeber an einer Verfahrensfortsetzung und einer Kostenentscheidung Schutz genießen.
Das vorliegende Urteil
OLG Celle – Az.: 14 W 7/24 – Beschluss vom 15.04.2024
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.












