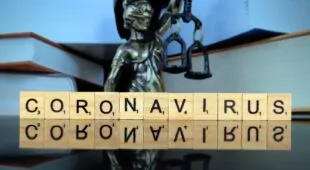Übersicht: [zeigen]
Zum vorliegenden Urteil Az.: 14 T 2/22 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: LG Lübeck
- Datum: 25.02.2022
- Aktenzeichen: 14 T 2/22
- Verfahrensart: Sofortige Beschwerde im Prozesskostenhilfeverfahren
- Rechtsbereiche: Prozesskostenhilferecht, Sozialrecht, Steuerrecht (bzgl. Altersvorsorge)
Beteiligte Parteien:
- Beklagte: Partei, die Prozesskostenhilfe beantragt und sich gegen die Ratenzahlung wehrt
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Eine Partei beantragte Prozesskostenhilfe für die Verteidigung gegen eine Zahlungsklage. Das Gericht bewilligte PKH, ordnete aber Ratenzahlungen an. Die Partei legte Beschwerde ein, weil Ausgaben für eine private Rentenversicherung bei der Einkommensberechnung nicht berücksichtigt wurden.
- Kern des Rechtsstreits: Der zentrale Streitpunkt war, ob Beiträge für eine private, nicht staatlich geförderte Rentenversicherung vom Einkommen abgezogen werden dürfen, um die Höhe der Prozesskostenhilfe-Raten zu reduzieren.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Gericht wies die Beschwerde zurück. Die Entscheidung des Amtsgerichts, Prozesskostenhilfe zu bewilligen, aber monatliche Raten anzuordnen, wurde bestätigt.
- Begründung: Das Gericht begründete dies damit, dass gesetzlich nur staatlich geförderte Altersvorsorgebeiträge (wie die Riester-Rente) vom Einkommen abgezogen werden dürfen. Private Rentenversicherungen dienen primär der Vermögensbildung und werden für die Berechnung der Prozesskostenhilfe in der Regel nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Fall gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Versicherung eine dringend benötigte Altersabsicherung darstellt, insbesondere da die Partei jung, berufstätig und schuldenfrei ist.
- Folgen: Für die betroffene Partei bedeutet dies, dass die monatlichen Raten für die Prozesskostenhilfe wie vom Amtsgericht festgelegt zu zahlen sind. Grundsätzlich können Beiträge zu privaten Rentenversicherungen, die nicht staatlich gefördert werden, das einzusetzende Einkommen im Prozesskostenhilfeverfahren nicht mindern.
Der Fall vor Gericht
Prozesskostenhilfe: Private Rentenversicherung nicht vom Einkommen abziehbar – Urteil LG Lübeck
Ein Rechtsstreit kann teuer werden. Wer sich die Kosten für Anwalt und Gericht nicht leisten kann, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf staatliche Unterstützung, die sogenannte Prozesskostenhilfe (PKH).

Doch wie wird das Einkommen berechnet, das für die PKH-Raten herangezogen wird? Insbesondere stellt sich oft die Frage, welche Ausgaben vom Einkommen abgezogen werden dürfen. Das Landgericht Lübeck musste in einem Beschluss vom 25. Februar 2022 (Az.: 14 T 2/22) klären, ob Beiträge zu einer privaten, nicht staatlich geförderten Rentenversicherung das für die PKH relevante Einkommen mindern können.
Antrag auf Prozesskostenhilfe: Rechtsstreit um Zahlungsforderung und erste Entscheidung
Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Zahlungsklage gegen einen Mann. Es ging um eine Forderung von 1.711,53 Euro zuzüglich Zinsen und Anwaltskosten. Um sich gegen diese Klage verteidigen zu können, ohne die Gerichts- und Anwaltskosten selbst tragen zu müssen, beantragte der Mann am 29. Juli 2021 Prozesskostenhilfe.
Das zuständige Amtsgericht Schwarzenbek prüfte den Antrag und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mannes. Es kam zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Prozesskostenhilfe grundsätzlich vorlagen. Allerdings stellte das Gericht auch fest, dass der Mann über ein gewisses Einzusetzendes Einkommen verfügte. Daher bewilligte das Amtsgericht die PKH zwar, ordnete aber gleichzeitig an, dass der Mann monatliche Raten in Höhe von 34 Euro auf die voraussichtlichen Verfahrenskosten zahlen muss. Diese Entscheidung stützte sich auf § 115 Absatz 4 der Zivilprozessordnung (ZPO), der die Ratenzahlung bei PKH regelt, wenn das einzusetzende Einkommen bestimmte Grenzen übersteigt.
Streitpunkt: Abzugsfähigkeit von Beiträgen zur privaten Altersvorsorge bei PKH
Mit der Anordnung von Ratenzahlungen war der Mann nicht einverstanden. Er legte am 28. September 2021 Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichts ein. Sein zentrales Argument: Das Gericht habe bei der Berechnung seines einzusetzenden Einkommens monatliche Beiträge für eine private Rentenversicherung in Höhe von XX Euro (genauer Betrag im Urteil anonymisiert) fälschlicherweise nicht berücksichtigt. Seiner Ansicht nach verbliebe kein für Ratenzahlungen verfügbares Einkommen, wenn diese Versicherungsausgaben korrekt abgezogen würden.
Das Amtsgericht Schwarzenbek prüfte die Beschwerde, blieb aber bei seiner ursprünglichen Einschätzung. Mit einem sogenannten Nichtabhilfebeschluss vom 11. Januar 2022 wies es die Argumente des Mannes zurück. Die Begründung des Amtsgerichts lautete: Die vom Mann angeführte private Rentenversicherung diene lediglich seiner eigenen Kapitalbildung. Solche Ausgaben seien bei der Ermittlung des für die Prozesskostenhilfe relevanten Einkommens nicht abzugsfähig.
Sofortige Beschwerde beim Landgericht Lübeck: Kampf um Anrechnung der Rentenbeiträge
Gegen diesen Nichtabhilfebeschluss des Amtsgerichts legte der Mann daraufhin sofortige Beschwerde beim nächsthöheren Gericht, dem Landgericht Lübeck, ein. Er verfolgte weiterhin das Ziel, die Beiträge für seine private Rentenversicherung vom Einkommen abziehen zu können und somit von der Pflicht zur Ratenzahlung befreit zu werden. Das Landgericht Lübeck musste nun abschließend entscheiden, ob die private Rentenversicherung bei der PKH-Berechnung zu berücksichtigen ist oder nicht.
Entscheidung des Landgerichts Lübeck: Beschwerde zurückgewiesen, Ratenzahlung bestätigt
Das Landgericht Lübeck wies die sofortige Beschwerde des Mannes als zulässig, aber unbegründet zurück. Damit bestätigte das Gericht die Entscheidung des Amtsgerichts Schwarzenbek in vollem Umfang. Das Ergebnis: Der Mann muss trotz seiner privaten Rentenversicherungsbeiträge die monatlichen Raten in Höhe von 34 Euro für die Prozesskostenhilfe leisten. Die Beiträge zur privaten, nicht staatlich geförderten Rentenversicherung sind nicht vom Einkommen abziehbar.
Begründung des Gerichts: Warum private Rentenversicherungsbeiträge nicht abzugsfähig sind
Das Landgericht Lübeck legte in seiner Begründung detailliert dar, warum die Beschwerde des Mannes keinen Erfolg haben konnte. Zunächst bestätigte es die Einkommensberechnung des Amtsgerichts als korrekt gemäß § 115 ZPO. Die Kernfrage war jedoch die Abzugsfähigkeit der privaten Rentenversicherungsbeiträge.
Gesetzliche Regelung: Nur staatlich geförderte Altersvorsorge ist abziehbar
Das Gericht stellte klar, dass die Abzugsfähigkeit von Rentenversicherungsbeiträgen im Rahmen der Prozesskostenhilfe gesetzlich geregelt ist. Maßgeblich ist hier § 115 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1a ZPO. Diese Vorschrift verweist auf § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Nach dieser sozialrechtlichen Regelung sind vom Einkommen nur solche Beiträge zur Altersvorsorge absetzbar, die nach § 82 des Einkommensteuergesetzes (EStG) gefördert werden.
Konkret bedeutet dies: Abzugsfähig sind nur Beiträge zu einem staatlich geförderten Altersvorsorgevertrag, der nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) zertifiziert ist. Dies betrifft in erster Linie die sogenannte Riester-Rente. Das Gericht betonte ausdrücklich, dass die vom Mann abgeschlossene Versicherung laut den vorliegenden Unterlagen gerade keine solche staatlich geförderte Riester-Rente war. Folglich fiel sie nicht unter die gesetzliche Regelung für abzugsfähige Altersvorsorgebeiträge.
Abgrenzung: Sozialleistung versus private Vermögensbildung
Das Landgericht unterstrich weiterhin, dass das Recht der Prozesskostenhilfe im Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes (Art. 20 Abs. 3 GG) wurzelt. Daher seien die Vorschriften zur PKH vorrangig sozialrechtlich auszulegen. Bei privaten Lebens- oder Rentenversicherungen müsse konsequent unterschieden werden:
- Beiträge, die der Abdeckung eines sozialhilferechtlich anerkannten Risikos dienen (also der Grundversorgung im Alter).
- Beiträge, die allein der privaten Vermögensbildung zuzurechnen sind.
Nicht staatlich geförderte private Rentenversicherungen werden in der Regel der zweiten Kategorie, also der privaten Vermögensbildung, zugeordnet. Die Aufwendungen hierfür können daher grundsätzlich nicht vom für die PKH relevanten Einkommen abgezogen werden.
Mögliche Ausnahme: Dringend benötigte Altersabsicherung zur Vermeidung von Bedürftigkeit?
Das Gericht ließ eine grundsätzliche Frage offen: Können Beiträge zu einer nicht staatlich geförderten Rentenversicherung ausnahmsweise doch abzugsfähig sein? Dies könnte theoretisch der Fall sein, wenn die Versicherung nachweislich dazu dient, eine dringend benötigte ergänzende Altersabsicherung aufzubauen, um eine konkret absehbare Versorgungslücke zu schließen und dadurch zukünftige Bedürftigkeit (also den Bezug von Sozialhilfe) abzuwenden.
Allerdings musste das Landgericht Lübeck diese Frage im vorliegenden Fall nicht abschließend klären. Denn der Mann hatte weder dargelegt noch war sonst ersichtlich, dass bei ihm ein solches Risiko einer absehbaren Versorgungslücke bestand, die nur durch genau diese private Versicherung geschlossen werden könnte, um zukünftige Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden. Es fehlte also der Nachweis einer solchen Notwendigkeit.
Würdigung der persönlichen Umstände: Keine Anzeichen für drohende Altersarmut
Bei seiner Beurteilung berücksichtigte das Gericht auch die persönlichen und wirtschaftlichen Umstände des Mannes. Dabei fielen insbesondere folgende Punkte ins Gewicht:
- Sein junges Alter von aktuell 23 Jahren.
- Die Tatsache, dass er berufstätig ist und somit in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt.
- Der Umstand, dass er nach Aktenlage schuldenfrei ist.
Vor diesem Hintergrund konnte das Gericht keine konkreten Anhaltspunkte dafür erkennen, dass die monatlichen Beiträge zur privaten Rentenversicherung einem anderen Zweck als dem allgemeinen Vermögensaufbau dienten. Die Versicherung erschien nicht als zwingend notwendiges Instrument zur Abwendung drohender Altersarmut, sondern als eine Form der privaten Kapitalanlage.
Fazit: Keine Abzugsfähigkeit privater Rentenbeiträge – Ratenzahlung für PKH bleibt bestehen
Das Urteil des Landgerichts Lübeck stellt klar: Beiträge zu privaten, nicht staatlich geförderten Rentenversicherungen sind im Rahmen der Prozesskostenhilfe grundsätzlich nicht vom einzusetzenden Einkommen abziehbar. Sie werden als Teil der privaten Vermögensbildung betrachtet und nicht als notwendige Ausgabe zur Sicherung des Lebensunterhalts oder zur Abwendung zukünftiger Bedürftigkeit im Sinne des Sozialhilferechts gewertet. Abzugsfähig sind nach der gesetzlichen Regelung nur Beiträge zu staatlich geförderten Altersvorsorgeverträgen wie der Riester-Rente.
Für den Antragsteller bedeutet dies, dass er die vom Amtsgericht festgesetzten monatlichen Raten von 34 Euro für die Prozesskostenhilfe zahlen muss. Seine Beschwerde hatte keinen Erfolg. Das Gericht sah keine Gründe, eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Bei der Beantragung von Prozesskostenhilfe (PKH) werden Beiträge zu privaten, nicht staatlich geförderten Rentenversicherungen grundsätzlich nicht vom einzusetzenden Einkommen abgezogen, da sie als private Vermögensbildung und nicht als notwendige Grundversorgung eingestuft werden. Nur staatlich geförderte Altersvorsorgebeiträge wie Riester-Renten sind bei der PKH-Berechnung abzugsfähig, wie das Landgericht Lübeck bestätigt hat. Dies bedeutet für Rechtsuchende mit begrenzten finanziellen Mitteln, dass private Rentenversicherungen ihre Verpflichtung zur Ratenzahlung bei bewilligter PKH nicht reduzieren können, sofern sie nicht nachweislich einer drohenden Altersarmut vorbeugen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Prozesskostenhilfe und wer kann sie bekommen?
Prozesskostenhilfe ist eine staatliche Unterstützung, die es Menschen mit geringem Einkommen und Vermögen ermöglicht, die Kosten für einen Gerichtsprozess bezahlen zu können. Sie soll sicherstellen, dass auch Personen, die finanziell nicht gut gestellt sind, ihre Rechte vor Gericht verfolgen oder sich verteidigen können. Es geht darum, den Zugang zur Justiz für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.
Wofür ist Prozesskostenhilfe da?
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen wichtigen rechtlichen Streitfall, aber Sie können sich die Gerichtsgebühren und eventuelle Anwaltskosten nicht leisten. Genau hier setzt die Prozesskostenhilfe an. Sie deckt ganz oder teilweise die Kosten, die durch den Prozess entstehen. Dazu gehören zum Beispiel die Gebühren für das Gericht und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten für einen Rechtsanwalt.
Wer kann Prozesskostenhilfe bekommen?
Um Prozesskostenhilfe zu erhalten, müssen grundsätzlich zwei Hauptvoraussetzungen erfüllt sein, die das Gericht prüft:
- Bedürftigkeit: Ihre persönliche wirtschaftliche Lage muss so sein, dass Sie die Kosten des Prozesses nicht oder nur teilweise aufbringen können. Dabei wird geprüft, ob Ihr Einkommen und Vermögen ausreichen, um die Prozesskosten selbst zu tragen. Es werden bestimmte Freibeträge für Sie selbst und Ihre Familie berücksichtigt, ebenso wie notwendige Ausgaben wie Miete und andere Lebenshaltungskosten. Was nach Abzug dieser Beträge übrig bleibt, bestimmt, ob Sie bedürftig sind.
- Erfolgsaussichten: Ihre Klage oder Verteidigung muss nach einer vorläufigen Prüfung durch das Gericht Aussicht auf Erfolg haben und darf nicht mutwillig erscheinen. Das bedeutet, der Fall darf nicht von vornherein offensichtlich aussichtslos sein. Es muss eine realistische Möglichkeit bestehen, dass Sie den Prozess gewinnen oder zumindest ein für Sie positives Ergebnis erzielen können. Mutwilligkeit liegt vor, wenn eine Partei, die über ausreichende Mittel verfügt, den Prozess nicht oder zu diesem Zeitpunkt nicht führen würde.
Für Sie bedeutet das: Wenn Sie über geringes Einkommen verfügen und Ihre rechtliche Angelegenheit vor Gericht eine reale Chance auf Erfolg hat, könnten Sie Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben. Die Bewilligung erfolgt auf Antrag beim zuständigen Gericht.
Wie wird das „einzusetzendes Einkommen“ bei der Prozesskostenhilfe berechnet?
Wenn Sie Prozesskostenhilfe beantragen, prüft das Gericht Ihre finanzielle Situation. Dabei wird ein bestimmter Betrag ermittelt, den Sie monatlich für die Gerichts- und Anwaltskosten „einsetzen“ könnten, falls Sie dazu in der Lage sind. Dieser Betrag wird als einzusetzendes Einkommen bezeichnet. Die Berechnung folgt festen gesetzlichen Regeln und geht von Ihrem Bruttoeinkommen aus, von dem bestimmte Ausgaben und Freibeträge abgezogen werden.
Was zählt zum Einkommen? (Ihr Brutto)
Der erste Schritt ist die Ermittlung Ihres Bruttoeinkommens. Hierzu zählen grundsätzlich alle Einnahmen, die Sie regelmäßig erhalten. Das sind zum Beispiel:
- Ihr Gehalt oder Lohn aus unselbstständiger Arbeit
- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit
- Renten (wie Altersrente, Erwerbsminderungsrente)
- Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Bestimmte Lohnersatzleistungen (wie Arbeitslosengeld I, Krankengeld)
Einige Einnahmen, wie zum Beispiel das Kindergeld, werden bei der Ermittlung des Bruttoeinkommens meist nicht direkt hinzugerechnet. Sie werden stattdessen später im Rahmen der Freibeträge für Kinder berücksichtigt.
Welche Kosten werden abgezogen? (Ihre Belastungen)
Von Ihrem Bruttoeinkommen dürfen bestimmte notwendige Ausgaben und Belastungen abgezogen werden. Dazu gehören in der Regel:
- Die zu zahlende Lohn-, Einkommen- oder Kirchensteuer
- Die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (also Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung)
- Ein angemessener Betrag für Werbungskosten. Das sind Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit entstehen (z.B. Fahrtkosten). Oft wird eine feste Pauschale abgezogen, höhere tatsächliche Kosten können aber bei Nachweis ebenfalls berücksichtigt werden.
- Beiträge für bestimmte notwendige Versicherungen, zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung.
Wie viel Geld dürfen Sie behalten? (Ihre Freibeträge)
Nach Abzug dieser Ausgaben vom Bruttoeinkommen werden gesetzlich festgelegte Freibeträge berücksichtigt. Diese Freibeträge sollen sicherstellen, dass Ihnen und den Personen, für die Sie rechtlich sorgen müssen, genügend Geld zum Leben bleibt.
- Es gibt einen Grundfreibetrag für Sie selbst. Dieser Betrag steht Ihnen monatlich zur freien Verfügung.
- Für Ihren Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner wird ebenfalls ein Freibetrag abgezogen, wenn er oder sie selbst kein oder nur ein geringes eigenes Einkommen hat.
- Für jedes Kind, für das Sie Unterhalt leisten müssen und das bei Ihnen lebt, gibt es einen Freibetrag, dessen Höhe vom Alter des Kindes abhängt.
Zusätzlich zu diesen persönlichen Freibeträgen wird ein Freibetrag für Ihre notwendigen Wohnkosten gewährt. Dieser berücksichtigt Ihre Ausgaben für Miete und Heizung, allerdings nur bis zu einer bestimmten Höhe, die als angemessen gilt.
Unter bestimmten Umständen können auch weitere besondere, unumgängliche Belastungen zu zusätzlichen Freibeträgen führen.
Der Betrag, der für die Prozesskostenhilfe zählt, ergibt sich rechnerisch so:
Einzusetzendes Einkommen = Bruttoeinkommen – Abzüge – Freibeträge
Das Ergebnis dieser Berechnung ist Ihr einzusetzendes Einkommen. Dieser Betrag entscheidet darüber, ob Sie Prozesskostenhilfe ohne eigene Zahlungen erhalten (wenn das einzusetzende Einkommen null oder sehr gering ist) oder ob Sie monatliche Raten an die Gerichtskasse zahlen müssen.
Welche Ausgaben können vom Einkommen bei der Berechnung der Prozesskostenhilfe abgezogen werden?
Bei der Berechnung, ob jemand Prozesskostenhilfe erhält und in welcher Höhe, wird nicht das gesamte Bruttoeinkommen betrachtet. Stattdessen wird ermittelt, wie viel Geld nach Abzug bestimmter Ausgaben tatsächlich zur Verfügung steht. Dieses verbleibende Geld nennt man das „einzusetzende Einkommen“. Das Gesetz, insbesondere § 115 der Zivilprozessordnung (ZPO), legt fest, welche Ausgaben Ihr Einkommen mindern dürfen.
Um das einzusetzende Einkommen zu ermitteln, werden vom Bruttoeinkommen zunächst bestimmte, vom Gesetz vorgesehene Beträge abgezogen. Dazu gehören:
- Steuern: Die Beträge, die Sie für Einkommensteuer oder Lohnsteuer zahlen.
- Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung: Das sind die Beiträge für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Nach Abzug dieser grundlegenden Posten können weitere, individuelle und notwendige Ausgaben berücksichtigt werden, die Ihr tatsächlich verfügbares Einkommen mindern. Wichtige Beispiele hierfür sind:
- Berufsbedingte Aufwendungen: Das sind Kosten, die direkt mit Ihrer Arbeit zusammenhängen, wie zum Beispiel Fahrtkosten zur Arbeitsstätte. Oft wird hier ein pauschaler Betrag abgezogen, der Reisekosten, Kosten für Arbeitsmittel und ähnliches abdeckt. Wenn Ihre tatsächlichen berufsbedingten Kosten nachweislich höher sind als dieser Pauschalbetrag, können diese höheren Kosten abgezogen werden.
- Angemessene Kosten für die Unterkunft: Dazu gehören die Kaltmiete und die Heizkosten Ihrer Wohnung. Auch angemessene Nebenkosten können berücksichtigt werden. Es wird geprüft, ob die Wohnkosten im Verhältnis zum Einkommen und den örtlichen Verhältnissen angemessen sind.
- Unterhaltsleistungen: Wenn Sie gesetzlich verpflichtet sind, Unterhalt für Ihren Ehepartner, geschiedenen Ehepartner oder Ihre Kinder zu zahlen, werden diese tatsächlich geleisteten Unterhaltszahlungen von Ihrem Einkommen abgezogen.
- Angemessene Versicherungsbeiträge: Beiträge für bestimmte, notwendige Versicherungen können ebenfalls berücksichtigt werden, beispielsweise eine Haftpflichtversicherung oder eine Hausratversicherung. Es wird jedoch geprüft, ob die Höhe der Beiträge angemessen ist.
- Besondere Belastungen: Dies sind Ausgaben, die zwangsläufig anfallen und notwendig sind, aber nicht unter die anderen Kategorien fallen und die bei anderen Personen in vergleichbarer Situation nicht oder nicht in dieser Höhe anfallen. Beispiele können Kosten für eine notwendige medizinische Behandlung sein, die nicht oder nur teilweise von der Krankenkasse übernommen wird, oder Kosten für eine spezielle Diät aufgrund einer Krankheit.
Zusätzlich zu diesen abzugsfähigen Ausgaben gibt es noch sogenannte Freibeträge. Das sind feste Beträge, die vom Einkommen abgezogen werden, um den grundlegenden Lebensunterhalt zu sichern. Die Höhe dieser Freibeträge hängt von Ihrer persönlichen Situation ab, also davon, ob Sie alleinstehend sind, verheiratet und/oder unterhaltsberechtigte Kinder haben. Diese Freibeträge werden nachdem die oben genannten Ausgaben abgezogen wurden, weiter vom Einkommen abgezogen.
Erst das Einkommen, das nach Abzug all dieser Ausgaben und Freibeträge übrig bleibt, ist das maßgebliche „einzusetzende Einkommen“. Anhand der Höhe dieses Betrags wird entschieden, ob und inwieweit Sie Prozesskostenhilfe erhalten.
Warum werden private Rentenversicherungsbeiträge bei der Prozesskostenhilfe oft nicht berücksichtigt?
Bei der Berechnung, ob jemand Prozesskostenhilfe erhält, prüft das Gericht das Einkommen und zieht davon bestimmte notwendige Ausgaben ab. Nur das Geld, das nach Abzug dieser Ausgaben übrig bleibt und einen bestimmten Freibetrag übersteigt, zählt als verfügbares Einkommen.
Beiträge zu einer privaten Rentenversicherung, die nicht staatlich gefördert werden (wie z.B. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder unter bestimmten Umständen zu Riester/Rürup), werden von Gerichten oft nicht als notwendige Ausgaben im Sinne der Prozesskostenhilfe angesehen.
Der Grund dafür ist, dass diese Beiträge rechtlich häufig als Kapitalbildung oder Vermögensbildung für die Zukunft betrachtet werden. Die Prozesskostenhilfe soll aber Menschen helfen, die sich die aktuellen Kosten für einen Gerichtsprozess nicht leisten können, basierend auf ihrem derzeitigen verfügbaren Einkommen nach Abzug der für das aktuelle Leben notwendigen Ausgaben.
Aus Sicht des Gesetzes zur Prozesskostenhilfe gehören freiwillige Sparleistungen für die spätere Rente, die über die gesetzlich vorgeschriebene oder staatlich besonders geförderte Altersvorsorge hinausgehen, in der Regel nicht zu diesen notwendigen Ausgaben. Man spart hier für später an, statt die Ausgaben für das jetzige Leben zu decken.
Daher werden solche Beiträge bei der Einkommensberechnung für die Prozesskostenhilfe oft nicht vom Einkommen abgezogen. Dies bedeutet, dass das Einkommen für die Berechnung der Hilfe höher angesetzt wird, als wenn diese Beiträge berücksichtigt würden.
Was kann ich tun, wenn ich mit der Entscheidung zur Prozesskostenhilfe nicht einverstanden bin?
Wenn Sie eine Entscheidung zur Prozesskostenhilfe erhalten haben, mit der Sie nicht einverstanden sind, weil Ihr Antrag abgelehnt wurde oder Sie nur teilweise Prozesskostenhilfe erhalten haben, gibt es eine Möglichkeit, diese Entscheidung überprüfen zu lassen.
Wie kann ich gegen die Entscheidung vorgehen?
Gegen die Entscheidung des Gerichts über die Prozesskostenhilfe können Sie eine sogenannte Beschwerde einlegen. Stellen Sie sich das wie einen Antrag vor, mit dem Sie dem Gericht mitteilen, dass Sie mit seiner Entscheidung nicht einverstanden sind und warum. Sie legen dar, wieso die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe Ihrer Meinung nach doch vorliegen oder anders bewertet werden müssten.
Welche Formalitäten und Fristen sind zu beachten?
Die Beschwerde müssen Sie schriftlich bei dem Gericht einreichen, das die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat. Alternativ können Sie Ihre Erklärung auch mündlich im Büro der Rechtsantragstelle des Gerichts zu Protokoll geben. Es ist wichtig, dass Sie darin klar machen, dass Sie sich gegen die Entscheidung wehren wollen und begründen, warum Sie diese für falsch halten.
Für die Einlegung der Beschwerde gibt es eine Frist: Sie müssen die Beschwerde innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung (dem Erhalt) der Entscheidung beim Gericht einreichen. Wenn Sie diese Frist verpassen, kann die Entscheidung rechtskräftig werden und Sie können in der Regel nichts mehr dagegen unternehmen.
Wer entscheidet über die Beschwerde?
Zuerst prüft das Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, Ihre Beschwerde. Hält es Ihre Beschwerde für begründet, kann es seine eigene Entscheidung ändern. Ändert es seine Entscheidung nicht, legt es die Beschwerde dem nächsthöheren Gericht zur Entscheidung vor. Dieses Gericht prüft dann nochmals, ob die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe gegeben sind.
Unterstützung bei rechtlichen Fragen
Für die Klärung rechtlicher Fragen außerhalb eines Gerichtsverfahrens oder zur Vorbereitung bestimmter gerichtlicher Schritte, wie zum Beispiel der Einlegung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung zur Prozesskostenhilfe, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der Beratungshilfe. Mit Beratungshilfe kann man sich zu seinen rechtlichen Möglichkeiten beraten lassen, ohne die vollen Kosten tragen zu müssen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Prozesskostenhilfe (PKH)
Prozesskostenhilfe ist eine staatliche Unterstützung, die es Menschen mit geringem Einkommen und Vermögen ermöglicht, die Kosten eines Gerichtsverfahrens ganz oder teilweise vom Staat bezahlen zu lassen. Sie stellt sicher, dass jede Person ihre Rechte vor Gericht wahrnehmen oder sich verteidigen kann, auch wenn sie finanziell nicht selbst in der Lage ist, die Kosten für Anwalt und Gericht zu tragen. Die Gewährung der PKH hängt insbesondere von der wirtschaftlichen Situation und den Erfolgsaussichten des Verfahrens ab. Rechtsgrundlage ist vor allem die Zivilprozessordnung (ZPO), insbesondere § 114 ff., die die Voraussetzungen und Verfahren regelt.
Einzusetzendes Einkommen
Das einzusetzende Einkommen ist der Teil des monatlichen Einkommens, den eine Person für die Begleichung der Prozesskosten aufwenden kann, nachdem bestimmte notwendige Ausgaben und Freibeträge abgezogen wurden. Es wird bei der Prüfung der Prozesskostenhilfe ermittelt, um festzustellen, ob Antragssteller selbst finanzielle Beiträge (zum Beispiel Raten) leisten müssen. Die Berechnung folgt Vorgaben des § 115 ZPO, wobei vom Bruttoeinkommen Ausgaben wie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, angemessene Wohnkosten und Unterhaltszahlungen abgezogen werden. Beispiel: Von Ihrem Gehalt werden erst Steuern und Miete abgezogen; das verbleibende Geld ist Ihr „einzusetzendes Einkommen“ für PKH.
Sofortige Beschwerde
Die sofortige Beschwerde ist ein Rechtsmittel gegen Entscheidungen von Gerichten im Verfahren der Prozesskostenhilfe, etwa wenn ein Antrag auf PKH nur teilweise oder mit Auflagen bewilligt wird. Sie muss innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder mündlich bei dem Gericht eingelegt werden, das die Entscheidung getroffen hat. Dann überprüft das nächsthöhere Gericht (z.B. das Landgericht) die Entscheidung erneut. Die sofortige Beschwerde dient dazu, Eilentscheidungen rasch zu überprüfen, ohne lange Verfahrenswege abzuwarten.
Nichtabhilfebeschluss
Ein Nichtabhilfebeschluss ist eine gerichtliche Entscheidung, mit der ein Antrag, zum Beispiel auf Prozesskostenhilfe oder auf Abänderung einer PKH-Entscheidung, abgelehnt wird. Das Gericht bestätigt darin seine vorherige Entscheidung und weist das Begehren zurück, weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder das vorgebrachte Argument nicht überzeugt. Im dargestellten Fall lehnte das Amtsgericht die Berücksichtigung der privaten Rentenversicherungsbeiträge als abzugsfähige Ausgaben ab und bestätigte damit den ursprünglichen Beschluss.
Abzugsfähigkeit von Ausgaben bei der Prozesskostenhilfe
Abzugsfähigkeit bezeichnet hier die Frage, welche Ausgaben vom Einkommen abgezogen werden dürfen, um das einzusetzende Einkommen zu ermitteln. Nur notwendige und gesetzlich anerkannte Ausgaben mindern das Einkommen und können die Kostenlast für Prozesskostenhilfe verringern. Beiträge zu staatlich geförderten Altersvorsorgeverträgen (z. B. Riester-Rente) sind abzugsfähig (§ 115 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a ZPO in Verbindung mit § 82 SGB XII). Private Rentenversicherungsbeiträge ohne staatliche Förderung gelten hingegen meist als freiwillige Vermögensbildung und sind nicht abzugsfähig. Beispiel: Ihre Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden abgezogen, freiwillige Sparbeiträge für private Rentenversicherungen dagegen nicht.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 115 Zivilprozessordnung (ZPO): Regelt die Gewährung und Berechnung der Prozesskostenhilfe, insbesondere die Ermittlung des einzusetzenden Einkommens und die Möglichkeit von Ratenzahlungen bei überschreitetem Einkommen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht stützte seine Entscheidung zur Anordnung der Ratenzahlungen auf § 115 Abs. 4 ZPO und bestätigte die korrekte Berechnung des einzusetzenden Einkommens ohne Anrechnung der privaten Rentenversicherungsbeiträge.
- § 115 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1a ZPO i.V.m. § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 SGB XII: Verweist darauf, dass bei der Einkommensermittlung für Prozesskostenhilfe nur Beiträge zur Altersvorsorge abziehbar sind, die staatlich gefördert werden und unter die steuerliche Förderung nach dem Einkommensteuergesetz fallen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Führte zur Ablehnung des Abzugs der privaten, nicht staatlich geförderten Rentenversicherungsbeiträge als Abzugsposten im Rahmen der PKH.
- § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII): Sozialrechtliche Vorschrift, die definiert, welche Altersvorsorgebeiträge bei der Einkommensberechnung für Sozialleistungen und vergleichbare Unterstützungsleistungen anzuerkennen sind, nämlich nur staatlich geförderte Verträge. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Begründet die sozialrechtliche Grundlage für den Verzicht auf den Abzug der privaten Rentenversicherungsbeiträge bei der PKH.
- § 5 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG): Bestimmt die Anforderungen an staatlich geförderte Altersvorsorgeverträge, wie etwa die Riester-Rente, die für den steuerlichen und sozialrechtlichen Abzug zertifiziert sind. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die private Rentenversicherung des Mannes entsprach nicht den Anforderungen eines zertifizierten Vorsorgevertrags, weshalb ihre Beiträge nicht abziehbar sind.
- Art. 20 Absatz 3 Grundgesetz (GG) – Sozialstaatsprinzip: Verlangt eine sozialrechtliche Auslegung von Vorschriften, die den Zugang zu staatlichen Leistungen absichern sollen, um den gesellschaftlichen Ausgleich und den Schutz Bedürftiger zu gewährleisten. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die PKH-Regelungen wurden sozialrechtlich interpretiert, was dazu führt, dass nur notwendige und sozialrechtlich anerkannte Ausgaben Berücksichtigung finden, nicht jedoch private Vermögensbildungen.
- Grundsätze der Bedürftigkeitsprüfung bei Sozialleistungen: Differenzierung zwischen Ausgaben zur Sicherung des Lebensunterhalts und privaten Kapitalbildungen, wobei nur erstere bei der Ermittlung des verfügbaren Einkommens abgezogen werden dürfen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht wertete die Beiträge zur privaten Rentenversicherung als private Vermögensbildung und somit nicht als abzugsfähig, da keine konkrete Gefahr der Altersarmut oder Sozialhilfeabhängigkeit nachgewiesen wurde.
Das vorliegende Urteil
LG Lübeck – Az.: 14 T 2/22 – Beschluss vom 25.02.2022
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.