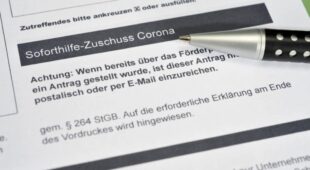1. Die Beklagten zu 1.) und 2.) werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 881,20 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB seit dem 27.03.2024 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagten der Klägerin jeden weitergehenden Schaden als Zukunftsschäden an dem Pkw mit amtlichem Kennzeichen … aus dem Verkehrsunfall vom 21.09.2023 in Höhe von 33,33 % zu ersetzen haben.
3. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 220,27 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB ab 07.06.2024 – dem Tag nach der Rechtshängigkeit der Klage – zu zahlen.
4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
5. Von den Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin 56 % zu tragen. Die Beklagten zu 1.) und 2.) haben als Gesamtschuldner von den Kosten des Rechtsstreits 44 % zu tragen.
6. Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Beschluss
Der Streitwert des Rechtsstreits wird auf insgesamt bis zu 2.500,00 € festgesetzt.
Tatbestand
Die rechtsschutzversicherte Klägerin verlangt von den Beklagten zu 1.) und 2.) als Gesamtschuldnern den Ersatz von 75 % des bei einem Verkehrsunfall vom 21.09.2023 auf der Bundesstraße B1 / Potsdamer Straße in … B… an ihrem Pkw vom Typ Opel Adam Open Air mit dem amtlichen Kennzeichen: … entstandenen Fahrzeugschadens und die Zahlung einer allgemeinen Unkostenpauschale sowie die Feststellung, dass die Beklagten ihr – der Klägerin – den weitergehenden Schaden als Zukunftsschäden an ihrem Pkw zu ersetzen haben.
An diesem Tag befuhren die Klägerin mit ihrem Pkw und der Beklagte zu 1.) mit seinem – bei der Beklagten zu 2.) haftpflichtversicherten – Kraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen: … gegen 15:40 Uhr nach passieren der Ampelkreuzung Berliner Straße / Potsdamer Straße die zunächst dort dann noch zweispurige Bundesstraße B1 / Potsdamer Straße stadteinwärts, wobei zunächst unstreitig der klägerische Pkw auf der linken und das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) auf der rechten der beiden Fahrspuren fuhren. Im weiteren Verlauf der Bundesstraße B1 / Potsdamer Straße verengte sich die stadteinwärts führende Fahrbahn kurz vor Beginn der Brücke über die Bahnschienen wegen einer Baustelle von zwei Fahrspuren auf eine Fahrspur, in dem die linke Fahrspur endete und nur noch die rechte Fahrspur weiter stadteinwärts führte. Vor dieser Verengung der stadteinwärts führenden Fahrbahn war die zulässige Geschwindigkeit im Übrigen auf 30 km/h herabgesetzt worden.
Im unmittelbaren Bereich vor dieser Fahrbahnverengung kam es dann unstreitig zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge während der Fahrt, wodurch der klägerische Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde.
Der Beklagte zu 1.) erklärte nach dem Verkehrsunfall gegenüber den Polizeibeamten zu Protokoll, dass er die weiblichen Personen im PKW 01 wahrnahm, aber es aus seiner Sicht notwendig war zu beschleunigen anstatt den PKW 01 vor sich einscheren zu lassen (Blatt 8 der Bußgeldakte des Zentraldienstes der Polizei, Zentrale Bußgeldstelle mit dem Az.: …).
Die Klägerin behauptet, dass das vom Beklagten zu 1.) geführte Kraftfahrzeug sich zunächst in einer Entfernung von ca. zwei Fahrzeuglängen hinter dem klägerischen Pkw auf der rechten der beiden Fahrtrichtungsspuren befunden habe. Da die Einengung auf eine Fahrspur es erforderlich gemacht habe auf die rechte der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren herüberzufahren, habe sie nach dem Passieren der Einmündung zur Potsdamer Landstraße den Fahrtrichtungsanzeiger ihres Pkws nach rechts gesetzt, um den beabsichtigten Fahrspurwechsel gegenüber dem nachfolgenden Beklagten zu 1.) anzuzeigen. Sie – die Klägerin – habe sich auch mehrfach nach hinten rechts davon vergewissert, dass der Beklagte zu 1.) mit seinem Kraftfahrzeug in einem ausreichenden Abstand für einen gefahrlosen Fahrspurwechsel hinter ihr gefahren sei, so dass sie ihrer Ansicht nach habe davon ausgehen dürfen, gefahrlos von der linken Fahrspur auf die rechte Fahrspur herüberwechseln zu dürfen.
Da sie den von ihr beabsichtigten Fahrspurwechsel somit rechtzeitig durch Setzung des Fahrtrichtungsanzeigers angekündigt habe, habe sie dann nach Vornahme der mehrfachen Rückversicherung mit dem Fahrspurwechsel kurz vor der Fahrbahneinengung begonnen; hierbei habe sie dann feststellen müssen, dass der Beklagte zu 1.) sein Kraftfahrzeug nunmehr beschleunigte und versuchte, noch rechts an ihre Pkw vorbeizufahren, obwohl sie – die Klägerin – bereits mit dem Fahrspurwechsel begonnen habe.
Das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.), welches sich entgegen den Ausführungen der Beklagtenseite zunächst nicht auf gleicher Höhe, sondern vielmehr in einem Abstand von etwa zwei Fahrzeuglängen hinter dem klägerischen Pkw befunden habe, sei ihrer Auffassung nach dazu verpflichtet gewesen, sie – die Klägerin – mit ihrem Pkw den Fahrspurwechsel auf die rechte Spur zu ermöglichen, was bei konstanter Fahrweise des Beklagten zu 1.) ihrer Meinung nach auch ohne weiteres möglich gewesen wäre, nachdem sie – die Klägerin – den Fahrstreifenwechsel durch Setzung ihres Fahrtrichtungsanzeigers auch rechtzeitig angezeigt habe.
Der Beklagte zu 1.) habe somit mehr als ausreichend Zeit gehabt, den angezeigten Fahrstreifenwechsel des klägerischen Pkws, welcher sich vor ihm befand, wahrzunehmen und dem klägerischen Pkw Fahrstreifenwechsel zu ermöglichen.
Den von der Beklagtenseite dargestellte Unfallverlauf würde sie insofern bestreiten. Der von der beklagten Seite dargestellte vermeintliche Unfallverlauf entspreche auch nicht den Angaben des Beklagten zu 1.) gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten nach dem Unfall.
Sie würde auch bestreiten, dass sich das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) im Augenblick der Einleitung des Fahrstreifenwechsels bereits etwas nach vorne versetzt rechts neben dem klägerischen Pkw befunden habe. In einem solchen Fall hätte sie – die Klägerin – das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) nämlich tatsächlich vor sich auch wahrnehmen können und hätte den Fahrstreifenwechsel selbstverständlich nicht vorgenommen.
Soweit der Beklagte zu 1.) dann vortragen lasse, dass er der Auffassung war, er müsse sein Kraftfahrzeug beschleunigen, um eine Kollision zu vermeiden, so sei dies nicht nur widersprüchlich gegenüber seinen Angaben gegenüber der Polizei vor Ort, sondern auch inhaltlich mehr als widersprüchlich.
Wenn ein Pkw angeblich mit deutlich höherer Geschwindigkeit an dem eigenen Kraftfahrzeug vorbeifahren will und sich der Überholende dann entschließt, sein Fahrzeug zu beschleunigen, um angeblich bei dem erkannten Spurwechsel des Überholenden eine Kollision zu vermeiden, dürfte klar sein, dass, sofern der Überholte nicht ein hoch motorisiertes Kraftfahrzeug fährt – was bei dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) nicht der Fall sei – dieses Verhalten nicht dazu geeignet ist, eine Kollision zu vermeiden.
Für den Beklagten zu 1.) habe tatsächlich überhaupt keine Notwendigkeit bestanden, sein Kraftfahrzeug zu beschleunigen. Auch habe sie – die Klägerin – mit einer Beschleunigung des Beklagtenfahrzeugs nicht rechnen müssen, da die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle auf 30 km/h begrenzt gewesen sei.
Entgegen der Auffassung der Beklagtenseite bestehe in den Fällen, in denen sich Kraftfahrzeuge mit einem Abstand von zwei Fahrzeuglängen hinter dem fahrstreifenwechselnden Fahrzeug befinden, keine Notwendigkeit, den Fahrstreifenwechsel zurückzustellen, da bei gleichbleibender Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge – insbesondere hier mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – ein gefahrloser Fahrstreifenwechsel ohne weiteres möglich sei.
Ob und inwieweit sich hinter dem Beklagtenfahrzeug eine Lücke befunden habe, spiele für den vorliegenden Fall insoweit auch keine Rolle, da der Beklagte zu 1.) aufgrund der Fahrzeugpositionen der betroffenen Fahrzeuge dazu verpflichtet gewesen sei, ihr – der Klägerin – das Einordnen auf den rechten Fahrstreifen zu ermöglichen.
Der Beklagte zu 1.) hat vorliegend aber sein Kraftfahrzeug beschleunigt, um einen Fahrspurwechsel des klägerischen Pkws auf die rechte Fahrspur vor seinem Kraftfahrzeug zu vereiteln.
Infolgedessen sei es dann zu der Kollision zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugen gekommen, wobei ihr Pkw im Bereich der vorderen Stoßstange rechts beschädigt wurde und das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) im hinteren linken Fahrzeugbereich.
Der Verkehrsunfall sei dann von der Polizei aufgenommen worden. Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten habe der Beklagte zu 1.) hierbei bestätigt, dass er den beabsichtigten Fahrspurwechsel der Klägerin entsprechend wahrgenommen habe. Er sei jedoch der Ansicht gewesen, sein Fahrzeug beschleunigen zu müssen, anstatt den Pkw der Klägerin vor sich einscheren zu lassen.
Allein der Umstand, dass der Beklagte, was er gegenüber der Polizei auch zugegeben habe, sein Kraftfahrzeug dann unvermittelt beschleunigt hatte, habe somit dazu geführt, dass es beim Spurwechsel zu der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.
Der ihr durch den Verkehrsunfall entstandene Schaden würde sich wie folgt beziffern:
Forderungsbetrag 25 % Mitverschulden
1. Reparaturkosten netto 2.618,61 € 1.963,96 €,
2. Allgemeine Unkostenpauschale 35,00 € 26,25 €,
Betrag 2.653,61 € 1.990,21 €.
Durch den Unfall sei ihr Pkw beschädigt worden. Zur Ermittlung der Schadenshöhe sei am 22.09.2023 ein Kostenvoranschlag vom Autohaus … – Anlage K1 (Blatt 7 bis 13 der Akte) – erstellt worden, wonach sich die Reparaturkosten voraussichtlich auf 2.618,61 € netto belaufen.
Ihr stehe darüber hinaus ein Anspruch auf Erstattung der unfallbedingt entstandenen notwendigen Aufwendungen, wie Fahrten ins Autohaus für die Erstellung des Kostenvoranschlages, Telefonate mit der Werkstatt und dem Prozessbevollmächtigten zu, welche im Rahmen der allgemeinen Unkostenpauschale mit 35,00 € zu erstatten wären.
Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände würde sie – die Klägerin – unter Abzug einer Mithaftung von 25 % den ihr entstandenen Schaden hier nunmehr geltend machen.
Darüber hinaus habe sie ein Feststellungsinteresse dahingehend, dass der weitergehende, zukünftig entstehende Schaden aus dem zuvor genannten Verkehrsunfall ihr von den Beklagten als Gesamtschuldner zu 75 % erstattet wird. Im Rahmen der Reparatur des Unfallschadens seien mögliche Reparaturweiterungen nämlich nicht ausgeschlossen, welche ebenso anteilig zu erstatten seien, wie die dazugehörige Mehrwertsteuer und der Nutzungsausfall bzw. die Mietwagenkosten für die Dauer der Reparatur. Sie – die Klägerin – habe dementsprechend ein entsprechendes Feststellungsinteresse.
Neben den geltend gemachten Klageforderungen habe sie bei einem Gegenstandswert von 1.990,21 € auch noch einen zusätzlichen Anspruch auf Ausgleich der außergerichtlich entstandenen Geschäftsgebühr ihres Rechtsanwalts. Die Beklagten seien daher auch zu verurteilen, ihr diese Kosten in Höhe von 280,60 € als Gesamtschuldner zu ersetzen.
Die Beklagten zu 1.) und 2.) seien daher als Gesamtschuldner entsprechend ihren Klageanträgen hier zu verurteilen.
Die Klägerin beantragt:
1. Die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie – die Klägerin – 1.990,21 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB seit dem 27.03.2024 zu zahlen.
2. Festzustellen, dass die Beklagten ihr – der Klägerin – jeden weitergehenden Schaden als Zukunftsschäden an dem Pkw mit amtlichem Kennzeichen … aus dem Verkehrsunfall vom 21.09.2023 zu ersetzen haben.
3. Die Beklagten als Gesamtschuldner weiterhin zu verurteilen, an sie – die Klägerin – 280,60 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB ab Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen.
Die Beklagten zu 1.) und 2.) beantragen: Die Klage abzuweisen.
Die Beklagten zu 1.) und 2.) tragen vor, dass sich der Unfall nicht ganz so ereignet habe, wie die Klägerin behauptet.
Tatsächlich habe der Beklagte zu 1.) zum angegebenen Zeitpunkt mit dem bei der Beklagten zu 2.) haftpflichtversicherten Kraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen … die Potsdamer Straße stadteinwärts auf der rechten der beiden für die Fahrtrichtung der Parteien zur Verfügung stehenden Fahrspuren befahren.
Unmittelbar vor der Brücke über die Bahngleise sei die linke Fahrspur weggefallen. Der Beklagte zu 1.) sei auf der rechten Fahrspur gefahren, wobei zwischen seinem und dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug eine große Lücke geklafft habe. Auf der linken Fahrspur habe der Beklagte zu 1.) zunächst kein Fahrzeug wahrnehmen können.
Erst unmittelbar an der Stelle, an der die linke Fahrspur geendet habe, habe der Beklagte zu 1.) den klägerischen Pkw wahrgenommen, welcher mit deutlich höherer Geschwindigkeit fahrend offensichtlich den Versuch unternehmen wollte, das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) noch vor dem Fahrspurende zu überholen. In diesem Augenblick hätten sich die beiden Fahrzeuge allerdings bereits auf gleicher Höhe befanden, wobei für ein Einscheren des klägerischen Pkws rechts nicht mehr ausreichend Platz gewesen sei.
Offensichtlich habe die Klägerin die Situation und auch ihre eigene Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Jedenfalls habe die Klägerin kurz vor dem Ende der linken Fahrspur noch eine Bremsung eingeleitet, ihren Pkw aber gleichzeitig nach rechts auf die rechte Fahrspur gezogen.
Der Beklagte zu 1.) habe in dieser Situation dann tatsächlich noch beschleunigt, um eine Kollision mit dem spurwechselnden Pkw der Klägerin zu vermeiden, was ihm aber nicht mehr gelungen sei.
Inwieweit die Angaben des Beklagten zu 1.) bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalls im Widerspruch zur Klageerwiderung stehen sollten, erschließe sich ihnen nicht. In der Tat habe es der Beklagte zu 1.) nämlich als notwendig angesehen, sein Kraftfahrzeug zu beschleunigen, um noch zu versuchen, dem nach rechts gelenkten Pkw der Klägerin zur Vermeidung einer Kollision auszuweichen. Dies sei dem Beklagten zu 1.) aber leider nicht mehr gelungen.
Es könne also keine Rede davon sein, dass der Beklagte zu 1.) sein Kraftfahrzeug beschleunigt hätte, um der Klägerin die Möglichkeit zu nehmen, die Spur nach rechts zu wechseln.
Falsch und zu bestreiten sei auch die Behauptung, dass sich das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) ca. 2 Fahrzeuglängen hinter dem klägerischen Pkw befunden habe, als die Klägerin das Ende der linken Fahrspur erreicht habe. Vielmehr seien die Fahrzeuge in dieser Situation etwa auf gleicher Höhe gewesen.
Bestreiten würden sie auch, dass die Klägerin ihren Fahrspurwechsel durch Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers rechtzeitig angezeigt habe. Des Weiteren würden sie bestreiten, dass sich die Klägerin mehrfach nach hinten rechts davon vergewissert hatte, dass der Beklagte zu 1.) mit seinem Kraftfahrzeug noch ausreichend weit entfernt sei, um den Fahrstreifen gefahrlos wechseln zu können.
Die Darstellung der Klägerin würde auch durch das Schadensbild an den beiden Fahrzeugen widerlegt, da der klägerische Pkw im Bereich vorne rechts und das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) im Bereich hinten links getroffen worden sei. Daher müsse sich das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) im Augenblick der Einleitung des Fahrstreifenwechsels bereits etwas nach vorne versetzt rechts neben dem Pkw der Klägerin befunden haben.
Selbst wenn sich das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) aber nur etwa 2 Fahrzeuglängen hinter dem klägerischen Pkw befunden hätte, hätte die Klägerin ihren Fahrspurwechsel zurückstellen müssen, da ein solcher nicht mehr gefahrlos durchzuführen war. Die Klägerin hätte den Beklagten zu 1.) vorbeifahren lassen müssen und die Fahrspur unter Ausnutzung der dahinter befindlichen Lücke wechseln können und müssen.
Bei der Regelung des § 7 Abs. 4 StVO handele es sich im Übrigen nur um ein Gebot, dass die Klägerin nicht von den Anforderungen des § 7 Abs. 5 StVO entbinde. Darüber hinaus wäre diese Vorschrift nur einschlägig, wenn sich der klägerische Pkw vor dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) befunden hätte, was aber nicht der Fall gewesen sei. Vielmehr hätte die Klägerin abwarten müssen, bis das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) weitergefahren ist, bevor sie die Spur wechselt.
Das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) habe sich auch nicht etwa 2 Fahrzeuglängen hinter dem Pkw der Klägerin befunden, so dass es dieser auch nicht möglich gewesen wäre, die Fahrspur bei konstanter Fahrweise zu wechseln.
Dass die Klägerin die Spur gewechselt habe, sei aber unstreitig, so dass gegen die Klägerin der Anscheinsbeweis aus § 7 Abs. 5 StVO streite. Die Klägerin hätte somit die Sorgfaltspflichten aus § 7 Abs. 5 StVO beachten müssen, die auch im Falle der Anwendung des Reißverschlussverfahrens gelten. Den gegen sie streitenden Anscheinsbeweis hätte die Klägerin somit entkräften müssen. Hierzu reiche jedoch nicht einmal der Vortrag in der Klageschrift aus, selbst wenn dessen Richtigkeit unterstellt würde.
Eine auch nur anteilige Haftung der Beklagten komme daher hier nicht in Betracht.
Nur hilfsweise würden sie – die Beklagten – auch Einwände zur Höhe des Schadens erhoben, und zwar hinsichtlich der Kostenpauschale. Diese sei mit 35,00 € erheblich übersetzt. Zu erstatten seien allenfalls 20,00 €.
Da sie – die Beklagten – schon dem Grunde nach hier nicht haften, habe die Klägerin auch keinen Anspruch auf Feststellung einer Ersatzpflicht hinsichtlich etwaiger künftiger Ansprüche oder auf Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten.
Das Gericht hat im Verhandlungstermin vom 25.03.2025 die Klägerin und den Beklagten zu 1.) persönlich angehört und nach Maßgabe des Beweisbeschlusses vom 25.03.2025 Beweis erhoben. Hinsichtlich der Vernehmung der Zeugin Jennifer Kühn wird auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls vom 25.03.2025 verwiesen. Zudem hat das Gericht die Bußgeldakte des Zentraldienstes der Polizei, Zentrale Bußgeldstelle zu dem Az.: 722/23/0003363/2 beigezogen.
Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird im Übrigen auf die unter Angabe der Blattzahl der Akte angeführten Schriftstücke ergänzend verwiesen. Zudem wird auf die zwischen den Prozessparteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. Im Übrigen wird auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls vom 25.03.2025 verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Amtsgerichts ergibt sich aus § 32 ZPO in Verbindung mit § 20 StVG und § 23 Nr. 1 GVG.
Die zulässige Klage ist im zuerkannten Umfang begründet. Der Klägerin steht gegenüber den Beklagten als Gesamtschuldnern ein Anspruch auf Zahlung in Höhe von 881,20 Euro (1/3 von 2.643,61 € [2.618,61 € + 25,00 €]) und ein Freistellungsanspruch zu 33,33 % in der Hauptsache zu (§§ 7 und 17 StVG in Verbindung mit § 249, § 251, § 254 und § 823 BGB und § 115 Abs. 1 VVG unter Beachtung von § 1, § 2, § 3, § 7 Abs. 4 und 5 sowie § 11 Abs. 3 StVO und §§ 286 und 287 ZPO). Im Übrigen ist die Klage jedoch abzuweisen.
Ein Haftungsausschluss gemäß § 7 Abs. 2 StVG liegt hier weder auf der Klägerseite noch auf Seiten der Beklagten vor. Ein derartiger Haftungsausschluss würde nämlich nur dann vorliegen, wenn ein Fall von „höherer Gewalt“ gegeben wäre. Höhere Gewalt im Sinne des § 7 StVG ist aber analog der zu § 1 Abs. 2 Nr. 1 HaftpflG entwickelten Definition als außergewöhnliches, betriebsfremdes, durch Naturkräfte oder Handlungen dritter (betriebsfremder) Personen herbeigeführtes und nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbares Ereignis, das mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch nach den Umständen äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet werden kann und das auch nicht im Hinblick auf seine Häufigkeit noch in Kauf genommen werden muss (BGH, Urteil vom 18.05.2004, Az.: VI ZR 267/03, u.a. in: NJW 2004, Seite 2086; BGH, Urteil vom 22.04.2004, Az.: III ZR 108/03, u.a. in: NZV 2004, Seiten 395 ff.; BGH, Urteil vom 15.03.1988, Az.: VI ZR 115/87, u.a. in: NJW-RR 1988, Seiten 986 f.; BGH, Urteil vom 17.10.1985, Az.: III ZR 99/84, u.a. in: NJW 1986, Seiten 2312 ff.; BGH, Urteil vom 30.05.1974, Az.: III ZR 190/71, u.a. in: NJW 1974, Seiten 1770 ff.; BGH, Urteil vom 15.11.1966, Az.: VI ZR 280/64, u.a. in: VersR 1967, Seiten 138 f.; BGH, Urteil vom 23.10.1952, Az.: III ZR 364/51, u.a. in: NJW 1953, Seite 184; OLG München, Urteil vom 27.07.2007, Az.: 10 U 2604/06, u.a. in: FD-StrVR 2007, Nr. 242486 = „juris“; OLG Hamburg, Urteil vom 19.12.1978, Az.: 7 U 62/78, u.a. in: VersR 1979, Seiten 549 f.; LG Bonn, Urteil vom 13.02.2007, Az.: 8 S 187/06, u.a. in: NZV 2007, Seiten 407 f.; LG Itzehoe, Urteil vom 11.07.2003, Az.: 7 O 130/03, u.a. in: NJW-RR 2003, Seiten 1465 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 18.07.2014, Az.: 31 C 147/12, u.a. in: FD-StrVR 2014, Nr. 360544 = „juris“; AG Bremen, Urteil vom 28.07.2006, Az.: 7 C 131/06, u.a. in: BeckRS 2007, Nr. 03859 = „juris“).
Höhere Gewalt hat nach den in der herrschenden Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 18.05.2004, Az.: VI ZR 267/03, u.a. in: NJW 2004, Seite 2086; BGH, Urteil vom 22.04.2004, Az.: III ZR 108/03, u.a. in: NZV 2004, Seiten 395 ff.; BGH, Urteil vom 15.03.1988, Az.: VI ZR 115/87, u.a. in: NJW-RR 1988, Seiten 986 f.; BGH, Urteil vom 17.10.1985, Az.: III ZR 99/84, u.a. in: NJW 1986, Seiten 2312 ff.; BGH, Urteil vom 30.05.1974, Az.: III ZR 190/71, u.a. in: NJW 1974, Seiten 1770 ff.; BGH, Urteil vom 15.11.1966, Az.: VI ZR 280/64, u.a. in: VersR 1967, Seiten 138 f.; BGH, Urteil vom 23.10.1952, Az.: III ZR 364/51, u.a. in: NJW 1953, Seite 184; OLG München, Urteil vom 27.07.2007, Az.: 10 U 2604/06, u.a. in: FD-StrVR 2007, Nr. 242486 = „juris“; OLG Hamburg, Urteil vom 19.12.1978, Az.: 7 U 62/78, u.a. in: VersR 1979, Seiten 549 f.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; LG Bonn, Urteil vom 13.02.2007, Az.: 8 S 187/06, u.a. in: NZV 2007, Seiten 407 f.; LG Itzehoe, Urteil vom 11.07.2003, Az.: 7 O 130/03, u.a. in: NJW-RR 2003, Seiten 1465 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 18.07.2014, Az.: 31 C 147/12, u.a. in: FD-StrVR 2014, Nr. 360544 = „juris“; AG Bremen, Urteil vom 28.07.2006, Az.: 7 C 131/06, u.a. in: BeckRS 2007, Nr. 03859 = „juris“) zu § 1 HaftpflG entwickelten Rechtsgrundsätzen somit die folgenden 3 Voraussetzungen, die alle zugleich erfüllt sein müssen:
7. das schädigende Ereignis muss von Außen her auf den Betrieb des Fahrzeuges eingewirkt haben;
8. es muss so außergewöhnlich sein, dass der Halter oder Fahrer damit nicht zu rechnen brauchte
und
9. es muss auch durch die äußerste Sorgfalt nicht abwendbar gewesen sein.
Einen Ausschluss einer Mithaftung nach § 7 Abs. 2 StVG wegen höherer Gewalt ist für den Kfz-Betrieb somit auf seltene Ausnahmefälle zu beschränken und immer dann, wenn sich – so wie hier – die spezifische Betriebsgefahr eines Kraftfahrzeugs noch ursächlich ausgewirkt hat, grundsätzlich zu verneinen.
Unstreitig lag eine solche Situation hier aber weder für den Beklagten zu 1.) noch für die Klägerin vor. Keine höhere Gewalt sind insofern nämlich regelmäßig – bereits wegen ihrer Häufigkeit – selbst grobe Regelverstöße. Die Kollision eines Kraftfahrzeugs mit einem anderen Fahrzeug ist auch alles andere als selten, wie schon die Opfer solcher Zusammenstöße auf den Straßen augenscheinlich belegen (BGH, Urteil vom 18.05.2004, Az.: VI ZR 267/03, u.a. in: NJW 2004, Seite 2086; BGH, Urteil vom 22.04.2004, Az.: III ZR 108/03, u.a. in: NZV 2004, Seiten 395 ff.; BGH, Urteil vom 15.03.1988, Az.: VI ZR 115/87, u.a. in: NJW-RR 1988, Seiten 986 f.; BGH, Urteil vom 17.10.1985, Az.: III ZR 99/84, u.a. in: NJW 1986, Seiten 2312 ff.; BGH, Urteil vom 30.05.1974, Az.: III ZR 190/71, u.a. in: NJW 1974, Seiten 1770 ff.; BGH, Urteil vom 15.11.1966, Az.: VI ZR 280/64, u.a. in: VersR 1967, Seiten 138 f.; BGH, Urteil vom 23.10.1952, Az.: III ZR 364/51, u.a. in: NJW 1953, Seite 184; OLG München, Urteil vom 27.07.2007, Az.: 10 U 2604/06, u.a. in: FD-StrVR 2007, Nr. 242486 = „juris“; OLG Hamburg, Urteil vom 19.12.1978, Az.: 7 U 62/78, u.a. in: VersR 1979, Seiten 549 f.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; LG Bonn, Urteil vom 13.02.2007, Az.: 8 S 187/06, u.a. in: NZV 2007, Seiten 407 f.; LG Itzehoe, Urteil vom 11.07.2003, Az.: 7 O 130/03, u.a. in: NJW-RR 2003, Seiten 1465 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 18.07.2014, Az.: 31 C 147/12, u.a. in: FD-StrVR 2014, Nr. 360544 = „juris“; AG Bremen, Urteil vom 28.07.2006, Az.: 7 C 131/06, u.a. in: BeckRS 2007, Nr. 03859 = „juris“). Eine „höhere Gewalt“ im Sinne dieser Regelung liegt hier dementsprechend weder auf Seiten der Beklagten noch auf der Klägerseite vor.
Bei § 17 Abs. 3 StVG handelt es sich hingegen dogmatisch um einen neben § 7 Abs. 2 StVG tretenden Ausschlusstatbestand, welcher als Grenze der nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 StVG möglichen Abwägung tritt. Die Fragen zur Unabwendbarkeit und zur Haftungsverteilung sind insofern aber streng voneinander zu trennen (OLG München, Urteil vom 28.02.2014, Az.: 10 U 3878/13, u.a. in: r + s 2014, Seiten 471 f.; OLG München, Urteil vom 02.02.2007, Az.: 10 U 4976/06, u.a. in: DAR 2007, Seiten 465 f.; OLG Hamm, Urteil vom 15.03.2002, Az.: 9 U 188/01, u.a. in: NZV 2002, Seiten 373 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Beide Prozessparteien haben hier aber nach Überzeugung des erkennenden Gerichts auch nicht den Nachweis geführt, dass der Unfall für den Beklagten zu 1.) und/oder die Klägerin ein „unabwendbares Ereignis“ im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG gewesen ist. Es lässt sich vorliegend nämlich nicht ausschließen und ist hier sogar mehr als nur wahrscheinlich, dass ein besonders umsichtiger und gewissenhafter („Ideal“-) Fahrer anstelle der hiesigen Kraftfahrzeugführer in der konkreten Verkehrslage durch Einleitung geeigneter Abwehrmaßnahmen bzw. Unterlassung bestimmter Handlungen den Unfall noch vermieden hätte. Der Begriff des „unabwendbaren Ereignis“ in diesem Sinne meint nämlich ein schadensstiftendes Ereignis, das auch bei der äußersten möglichen Sorgfalt nicht mehr abgewendet werden kann, wozu ein sachgemäßes, geistesgegenwärtiges Handeln über den gewöhnlichen und persönlichen Maßstab hinaus gehört (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; OLG Celle, Urteil vom 15.05.2018, Az.: 14 U 175/17, u.a. in: NJW-Spezial 2018, Seite 426; OLG München, Urteil vom 09.03.2018, Az.: 10 U 3204/17, u.a. in: FD-StrVR 2018, Nr. 405159 = „juris“; OLG Hamm, Urteil vom 16.01.2018, Az.: I-9 U 198/16, u.a. in: FD-StrVR 2018, Nr. 407171 = „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 14.07.2016, Az.: 12 U 121/15, u.a. in: r + s 2016, Seiten 636 f.; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 01.07.2010, Az.: 12 U 15/10, u.a. in: VRR 2010, Seite 465; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Schleswig, OLG-Report 2008, Seite 314; OLG Celle, OLG-Report 2007, Seite 854; OLG München, Urteil vom 02.02.2007, Az.: 10 U 4976/06, u.a. in: DAR 2007, Seiten 465 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Celle, Urteil vom 17.03.2005, Az.: 14 U 192/04, u.a. in: MDR 2005, Seiten 984 f.; KG Berlin, NZV 2004, Seiten 579 ff.; OLG Köln, Urteil vom 24.04.1996, Az.: 13 U 146/95, u.a. in: Schaden-Praxis 1996, Seiten 307 ff.; OLG Köln, DAR 1995, Seite 484; OLG Hamm, Urteil vom 17.03.1992, Az.: 27 U 12/92, u.a. in: VersR 1993, Seiten 711 f.; OLG Köln, Urteil vom 20.03.1991, Az.: 2 U 206/89, u.a. in: NZV 1992, Seiten 233 f.; OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.05.1982, Az.: 10 U 244/81, u.a. in: VersR 1983, Seite 252; KG Berlin, Urteil vom 02.02.1981, Az.: 12 U 2830/80, u.a. in: VersR 1981, Seite 885; OLG München, VersR 1976, Seiten 1143 f.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Unabwendbarkeit bedeutet zwar nicht eine absolute Unvermeidbarkeit. Unabwendbar ist ein Unfall aber nur dann, wenn sicher anzunehmen ist, dass er auch einem besonders besonnenen und erfahrenen Fahrzeugführer bei sachgerechter Reaktion unterlaufen wäre. Dazu gehören erheblich über den Maßstab der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hinausgehende Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit und Umsicht sowie ein sachgemäßes, geistesgegenwärtiges Handeln im Augenblick der Gefahr im Rahmen des Menschen möglichen, also das Verhalten eines so genannten „Idealfahrers“. Unabwendbar ist somit nur ein solches Ereignis, das durch äußerst mögliche Sorgfalt nicht mehr abgewendet werden kann (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG Celle, Urteil vom 15.05.2018, Az.: 14 U 175/17, u.a. in: NJW-Spezial 2018, Seite 426; OLG München, Urteil vom 09.03.2018, Az.: 10 U 3204/17, u.a. in: FD-StrVR 2018, Nr. 405159 = „juris“; OLG Hamm, Urteil vom 16.01.2018, Az.: I-9 U 198/16, u.a. in: FD-StrVR 2018, Nr. 407171 = „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 14.07.2016, Az.: 12 U 121/15, u.a. in: r + s 2016, Seiten 636 f.; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 01.07.2010, Az.: 12 U 15/10, u.a. in: VRR 2010, Seite 465; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Schleswig, OLG-Report 2008, Seite 314; OLG Celle, OLG-Report 2007, Seite 854; OLG München, Urteil vom 02.02.2007, Az.: 10 U 4976/06, u.a. in: DAR 2007, Seiten 465 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Celle, Urteil vom 17.03.2005, Az.: 14 U 192/04, u.a. in: MDR 2005, Seiten 984 f.; KG Berlin, NZV 2004, Seiten 579 ff.; OLG Köln, Urteil vom 24.04.1996, Az.: 13 U 146/95, u.a. in: Schaden-Praxis 1996, Seiten 307 ff.; OLG Köln, DAR 1995, Seite 484; OLG Hamm, Urteil vom 17.03.1992, Az.: 27 U 12/92, u.a. in: VersR 1993, Seiten 711 f.; OLG Köln, Urteil vom 20.03.1991, Az.: 2 U 206/89, u.a. in: NZV 1992, Seiten 233 f.; OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.05.1982, Az.: 10 U 244/81, u.a. in: VersR 1983, Seite 252; KG Berlin, Urteil vom 02.02.1981, Az.: 12 U 2830/80, u.a. in: VersR 1981, Seite 885; OLG München, VersR 1976, Seiten 1143 f.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Dazu gehört sachgemäßes, geistesgegenwärtiges Handeln über den gewöhnlichen und persönlichen Maßstab hinaus; zwar nicht das Verhalten eines gedachten „Superfahrers“, jedoch gemessen an durchschnittlichen Verkehrsanforderungen das Verhalten eines „Idealfahrers“. Zu dieser äußersten Sorgfalt gehört insbesondere die Berücksichtigung aller möglichen Gefahrenmomente (OLG Brandenburg, Urteil vom 01.07.2010, Az.: 12 U 15/10, u.a. in: VRR 2010, Seite 465; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Stuttgart, VersR 1983, Seite 252).
Erforderlich sind besonders sorgfältige Reaktionen (OLG Brandenburg, Urteil vom 01.07.2010, Az.: 12 U 15/10, u.a. in: VRR 2010, Seite 465; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Oldenburg, VersR 1980, Seite 340), wobei der jeweilige Fahrer auch erhebliche fremde Fehler mit berücksichtigen muss (OLG Brandenburg, Urteil vom 01.07.2010, Az.: 12 U 15/10, u.a. in: VRR 2010, Seite 465; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Hamm, Urteil vom 25.11.1996, Az.: 6 U 79/96, u.a. in: NJWE-VHR 1997, Seite 108; KG Berlin, Betrieb 1974, Seite 1569; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Die Prüfung nach § 17 Abs. 3 StVG hat sich insoweit aber auch darauf zu erstrecken, ob ein „Idealfahrer“ überhaupt in diese Gefahrensituation geraten wäre und ob der Verkehrsteilnehmer in der konkreten Unfallsituation wie ein „Idealfahrer“ reagiert hat (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG Köln, Urteil vom 24. April 1996, Az.: 13 U 146/95; OLG Köln, NZV 1992, Seite 233; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.). Die Straßenverkehrsordnung verlangt nämlich gerade auch von einem „Idealfahrer“ eine defensive und vorausschauende Fahrweise (§ 1 StVO; OLG Rostock, Urteil vom 23.02.2007, Az.: 8 U 39/06, u.a. in: MDR 2007, Seite 1014).
Wenn aber z.B. ein Fahrer eine überzogene Brems- oder Lenk-Reaktion verursacht, war er in der eigentlichen Kollisionslage auch nicht mehr in der Situation eines „Idealfahrers“ (OLG Koblenz, NJW-RR 2006, Seiten 94 f.). Ein unabwendbares Ereignis liegt gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 StVG nämlich nur dann vor, wenn der Fahrer jede nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beobachtet hat und auch durch diese das Unfallereignis nicht mehr hätte abgewendet werden können. Hierzu gehört sachgemäßes, geistesgegenwärtiges Handeln, dass über den gewöhnlichen und persönlichen Maßstab hinausgeht und alle möglichen Gefahrenmomente berücksichtigt (KG Berlin, KG-Report 2006, Seite 352). Nach der Legaldefinition des § 17 Abs. 3 StVG gilt ein Ereignis somit nur dann als „unabwendbar“, wenn der Fahrer des jeweiligen Fahrzeugs die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt vollständig wie ein „Idealfahrer“ beobachtet hätte (LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; LG Limburg, Urteil vom 16.12.2008, Az.: 2 O 313/06).
Ein schuldhaftes Fehlverhalten eines Kraftfahrers schließt insofern aber bereits ein „unabwendbares Ereignis“ aus. Schon bloße Zweifel am unfallursächlichen Fahrverhalten schließen sogar die Feststellung der Unabwendbarkeit aus (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Darlegungs- und beweisbelastet für die „Unabwendbarkeit“ des Unfalles in diesem Sinne ist im Übrigen grundsätzlich immer derjenige, der sich jeweils entlasten will (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, DAR 1976, Seite 246; BGH, Urteil vom 10.10.1972, Az.: VI ZR 104/71, u.a. in: NJW 1973, Seiten 44 f.; BGH, Urteil vom 17.02.1970, Az.: VI ZR 135/68, u.a. in: VersR 1970, Seiten 423 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Schleswig, OLG-Report 2008, Seite 314; OLG Celle, OLG-Report 2007, Seite 854; KG Berlin, NZV 2004, Seiten 579 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Köln, DAR 1995, Seite 484; OLG Köln, NZV 1994, Seiten 230 f.; OLG München, VersR 1976, Seiten 1143 f.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 30.03.2017, Az.: 2 S 2191/16, u.a. in: NJW-RR 2017, Seiten 730 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.; AG Essen, Urteil vom 13.01.2016, Az.: 20 C 254/15, u.a. in: SVR 2016, Seiten 108 ff.).
Wenn also eine Partei für den Fahrer ihres Kraftfahrzeuges ein „unabwendbares Ereignis“ im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG behauptet ist diese Prozesspartei dann auch dafür beweispflichtig, dass der Fahrer ihres Kraftfahrzeugs die oben näher dargelegte gesteigerte Sorgfalt eines „Idealfahrers“ tatsächlich so eingehalten hat (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, DAR 1976, Seite 246; BGH, Urteil vom 10.10.1972, Az.: VI ZR 104/71, u.a. in: NJW 1973, Seiten 44 f.; BGH, Urteil vom 17.02.1970, Az.: VI ZR 135/68, u.a. in: VersR 1970, Seiten 423 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG Brandenburg, Urteil vom 14.07.2016, Az.: 12 U 121/15, u.a. in: r + s 2016, Seiten 636 f.; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: „juris“; OLG Schleswig, OLG-Report 2008, Seite 314; OLG Celle, OLG-Report 2007, Seite 854; KG Berlin, NZV 2004, Seiten 579 ff.; OLG Brandenburg, VRS Band 106, Seiten 99 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 14 U 123/02, u.a. in: VRS Band 106 [2004], Seiten 18 ff.; OLG Köln, DAR 1995, Seite 484; OLG Köln, NZV 1994, Seiten 230 f.; OLG Schleswig, OLG-Report 2008, Seite 314; OLG Celle, OLG-Report 2007, Seite 854; KG Berlin, NZV 2004, Seiten 579 ff.; OLG Köln, DAR 1995, Seite 484; OLG Köln, NZV 1994, Seiten 230 f.; OLG München, VersR 1976, Seiten 1143 f.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Insofern ist es also stets Sache der Partei im Einzelnen vorzutragen und ggf. auch zu beweisen, dass auch ein Idealfahrer den Unfall an Stelle ihres Fahrers nicht mehr hätte verhindern können (OLG Brandenburg, Urteil vom 01.07.2010, Az.: 12 U 15/10, u.a. in: VRR 2010, Seite 465).
Dabei können jedoch nur solche Umstände der Beurteilung zugrunde gelegt werden, die zur Überzeugung des Gerichts feststehen; eine Unaufklärbarkeit von Umständen geht dann zu Lasten derjenigen Prozesspartei, die sich auf ein „unabwendbares Ereignis“ im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG beruft (BGH, NJW 1982, Seiten 1149 f.; BGH, NJW 1973, Seiten 44 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 14.07.2016, Az.: 12 U 121/15, u.a. in: r + s 2016, Seiten 636 f.; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: „juris“; OLG Celle, OLG-Report 2007, Seite 854; KG Berlin, NZV 2004, Seiten 579 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Unzutreffend wäre deshalb ein Vortrag einer Prozesspartei, dass die von der Gegenseite aufgezeigten Möglichkeiten zur Vermeidung des Unfalls durch den Fahrer ihres Kraftfahrzeugs nicht geeignet gewesen wären, den Unfall doch noch zu verhindern (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, DAR 1976, Seite 246; BGH, Urteil vom 10.10.1972, Az.: VI ZR 104/71, u.a. in: NJW 1973, Seiten 44 f.; BGH, Urteil vom 17.02.1970, Az.: VI ZR 135/68, u.a. in: VersR 1970, Seiten 423 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954;).
Diese Prüfung darf sich im Übrigen auch nicht allein auf die Frage beschränken, ob der Fahrer des jeweiligen Kraftfahrzeugs in der konkreten Gefahrensituation wie ein „Idealfahrer“ reagiert hat. Vielmehr ist sie auf die weitere Frage zu erstrecken, ob ein „Idealfahrer“ überhaupt in eine solche Gefahrenlage geraten wäre; denn der sich aus einer abwendbaren Gefahrenlage entwickelnde Unfall wird nicht dadurch unabwendbar, dass sich der Fahrer des jeweiligen Kraftfahrzeugs in der Gefahr nunmehr ggf. (aber zu spät) „ideal“ verhält (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, DAR 1976, Seite 246; BGH, Urteil vom 10.10.1972, Az.: VI ZR 104/71, u.a. in: NJW 1973, Seiten 44 f.; BGH, Urteil vom 17.02.1970, Az.: VI ZR 135/68, u.a. in: VersR 1970, Seiten 423 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG Brandenburg, Urteil vom 14.07.2016, Az.: 12 U 121/15, u.a. in: r + s 2016, Seiten 636 f.; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954).
Vor diesem Hintergrund ist aber weder der Klägerin noch der Beklagtenseite hier der Nachweis gelungen, dass der Unfall für die Klägerin oder den Beklagten zu 1.) ein „unabwendbares Ereignis“ in diesem Sinne war. Das erkennende Gericht konnte hier nämlich nicht den nach § 286 ZPO erforderlichen Überzeugungsgrad gewinnen, das der Unfall unter Berücksichtigung des gebotenen, vorausschauenden Verhaltens auch für einen sogenannten „Idealfahrer“ an Stelle der Klägerin oder des Beklagten zu 1.) nicht doch noch vermeidbar gewesen wäre.
Es kann vorliegend nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass erste Anzeichen für eine Gefahrensituation schon so rechtzeitig für die Klägerin und den Beklagten zu 1.) erkennbar waren, so dass ein sogenannte „Idealfahrer“ unter Beachtung des oben genannten Sorgfältigkeitsmaßstabs schon früher als die Klägerin oder der Beklagte zu 1.) reagiert hätte und zu diesem Zeitpunkt noch ein Handlungsspielraum gegeben war, der einem besonders umsichtigen und gewissenhaften („Ideal“-)Fahrer(-in) anstelle der Klägerin oder des Beklagten zu 1.) in der konkreten Verkehrslage noch die Möglichkeit eröffnet hätte den Unfall ggf. doch noch zu vermeiden, zumindest aber dessen Folgen zu verringern (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, DAR 1976, Seite 246; BGH, Urteil vom 10.10.1972, Az.: VI ZR 104/71, u.a. in: NJW 1973, Seiten 44 f.; BGH, Urteil vom 17.02.1970, Az.: VI ZR 135/68, u.a. in: VersR 1970, Seiten 423 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954).
Damit scheidet aber allein schon wegen der Nichtaufklärbarkeit dieser Unfallphase die Bejahung eines „unabwendbaren Ereignisses“ im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG hier zugunsten der Klägerin oder der Beklagtenseite aus, so dass es auf die Beantwortung der Frage, ob ein „Idealfahrer“ mit einer geringeren Geschwindigkeit und/oder einer kontrollierten Ausweichreaktion und/oder einem rechtzeitigen Bremsmanöver des jeweiligen Kraftfahrzeugs den Unfall noch hätte verhindern können, vorliegend nicht mehr ankommt (BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az.: VI ZR 199/06, u.a. in: NJW 2007, Seiten 3120 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.2005, Az.: VI ZR 68/04, u.a. in: NJW 2006, Seiten 896 ff.; BGH, Urteil vom 17.03.1992, Az.: VI ZR 62/91, u.a. in: NJW 1992, Seiten 1684 ff.; BGH, Urteil vom 13.12.1990, Az.: III ZR 14/90, u.a. in: NJW 1991, Seiten 1171 f.; BGH, Urteil vom 28.05.1985, Az.: VI ZR 258/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 183 f.; BGH, DAR 1976, Seite 246; BGH, Urteil vom 10.10.1972, Az.: VI ZR 104/71, u.a. in: NJW 1973, Seiten 44 f.; BGH, Urteil vom 17.02.1970, Az.: VI ZR 135/68, u.a. in: VersR 1970, Seiten 423 f.; BGH, Urteil vom 13.05.1969, Az.: VI ZR 270/67, u.a. in: VersR 1969, Seite 827; OLG München, Urteil vom 12.08.2011, Az.: 10 U 3150/10, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22231 = „juris“; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954), da weder die Klägerseite noch die Beklagtenseite insofern hier zu beweisen vermochten, dass es sich bei dem Unfall für die Klägerin oder den Beklagten zu 1.) um ein derartiges „unabwendbares Ereignis“ gehandelt hat.
Dies sieht die Klägerseite vorliegend im Übrigen wohl auch so, da die Klägerin hier lediglich 75 % der ihr entstandenen Schäden dem Grunde nach geltend macht und sich somit ein Mitverschulden in Höhe von 25 % anrechnen lässt.
Da ein diesem Maßstab gerecht werdendes Handeln des am Unfall beteiligten Erstbeklagten vorliegend die Beklagtenseite jedoch auch nicht zu beweisen vermochte – wie noch ausgeführt werden wird –, muss sich insofern die Beklagtenseite dann aber auch grundsätzlich schon die allgemeine (einfache) Betriebsgefahr des Kraftfahrzeugs des Beklagten zu 2.) mit 20 % anrechnen lassen (OLG München, Urteil vom 19.05.2017, Az.: 10 U 4256/16, u.a. in: NJW 2017, Seiten 2838 ff.; OLG München, Urteil vom 24.02.2017, Az.: 10 U 4448/16, u.a. in: NJW-RR 2017, Seiten 1059 f.; OLG Schleswig, Urteil vom 25.10.2012, Az.: 7 U 156/11, u.a. in: SchlHA 2013, Seite 280; LG Hannover, Beschluss vom 06.08.2015, Az.: 4 S 37/15, u.a. in: DV 2015, Seite 286; LG Saarbrücken, Urteil vom 07.06.2013, Az.: 13 S 31/13, u.a. in: NJW-RR 2013, Seiten 1249 ff.; LG Hamburg, Urteil vom 04.12.2009, Az.: 306 O 221/08, u.a. in: BeckRS 2009, Nr. 89227 = „juris“; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 21.02.2019, Az.: 31 C 211/17, u.a. in: NJOZ 2019, Seiten 923 ff. = „juris“ = BeckRS 2019, Nr. 1954; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Ein diesem Maßstab gerecht werdendes Handeln des Beklagten zu 1.) hat nämlich auch die Beklagtenseite vorliegend hier nicht behauptet bzw. zu beweisen vermocht, so dass die Beklagtenseite den Unabwendbarkeitsbeweis im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG vorliegend ebenso nicht geführt hat und dem entsprechend bereits beide Parteien grundsätzlich in dieser Sache schon mit einer Haftungsquote von jeweils 20 % belastet sind.
Da somit hier auch die Ersatzpflicht der Beklagten weder nach § 7 Abs. 2 StVG noch nach § 17 Abs. 3 StVG ausgeschlossen ist, weil der Unfall weder durch „höhere Gewalt“ verursacht wurde noch die Beklagten Tatsachen vortragen und beweisen, aus denen sich das Vorliegen eines „unabwendbaren Ereignisses“ ergibt, ist vorliegend dementsprechend die vorzunehmende Abwägung der Verursachungsbeiträge auch nach § 17 Abs. 1 StVG durchzuführen ist. Insofern belastet hier aber auch die Beklagtenseite grundsätzlich schon die allgemeine Betriebsgefahr des Kraftfahrzeugs des Beklagten zu 1.), welche allein schon in der Regel mit 20 % anzusetzen ist (OLG München, Urteil vom 19.05.2017, Az.: 10 U 4256/16, u.a. in: NJW 2017, Seiten 2838 ff.; OLG München, Urteil vom 24.02.2017, Az.: 10 U 4448/16, u.a. in: NJW-RR 2017, Seiten 1059 f.; OLG Schleswig, Urteil vom 25.10.2012, Az.: 7 U 156/11, u.a. in: SchlHA 2013, Seite 280; LG Hannover, Beschluss vom 06.08.2015, Az.: 4 S 37/15, u.a. in: DV 2015, Seite 286; LG Saarbrücken, Urteil vom 07.06.2013, Az.: 13 S 31/13, u.a. in: NJW-RR 2013, Seiten 1249 ff.; LG Hamburg, Urteil vom 04.12.2009, Az.: 306 O 221/08, u.a. in: BeckRS 2009, Nr. 89227 = „juris“; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.), wie bereits dargelegt.
Im Rahmen der Abwägung der Verursachungsbeiträge nach § 17 Abs. 1 StVG ist zwar immer auch auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen, insbesondere darauf inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verursacht worden ist. Bei der Abwägung der Verursachungs- und Verschuldensanteile der Fahrer der beteiligten Kraftfahrzeuge sind unter Berücksichtigung der von beiden Fahrzeugen ausgehenden Betriebsgefahr aber nur unstreitige bzw. zugestandene und bewiesene Umstände einzustellen, so dass für Verschuldens-Vermutungen dabei kein Raum ist (BGH, Urteil vom 20.02.2013, Az.: VIII ZR 339/11, u.a. in: NJW 2013, Seiten 2018 ff.; BGH, Urteil vom 20.03.2012, Az.: VI ZR 3/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2425 ff.; BGH, Urteil vom 21.11.2006, Az.: VI ZR 115/05, u.a. in: NJW 2007, Seiten 506 ff.; BGH, Urteil vom 13.02.1996, Az.: VI ZR 126/95, u.a. in: NJW 1996, Seiten 1405 ff.; BGH, Urteil vom 10.01.1995, Az.: VI ZR 247/94, u.a. in: NJW 1995, Seiten 1029 f.; BGH, Urteil vom 19.01.1962, Az.: VI ZR 78/61, u.a. in: VersR 1962, Seite 374; BGH, Urteil vom 16.10.1956, Az.: VI ZR 162/55, u.a. in: NJW 1957, Seiten 99 f.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 15.04.2014, Az.: 16 U 213/13, u.a. in: VersR 2014, Seiten 1471 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: VRS Band 117 [2009], Nr. 91, Seiten 340 ff.; KG Berlin, Urteil vom 11.02.2002, Az.: 12 U 117/01, u.a. in: NZV 2003, Seite 291; KG Berlin, Urteil vom 10.05.1999, Az.: 12 U 9612/97, u.a. in: NZV 1999, Seiten 512 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Daraus folgt nach den allgemeinen Beweisgrundsätzen, das im Rahmen der nach § 17 StVG vorzunehmenden Abwägung jeweils der eine Halter die Umstände zu beweisen hat die dem anderen Halter zum Verschulden gereichen sollen. Jeder Halter hat also die Umstände zu beweisen, die dem anderen zum Verschulden gereichen und aus denen er für die nach § 17 Abs. 1 StVG vorzunehmende Abwägung für sich günstige Rechtsfolgen herleiten will (BGH, Urteil vom 20.02.2013, Az.: VIII ZR 339/11, u.a. in: NJW 2013, Seiten 2018 ff.; BGH, Urteil vom 20.03.2012, Az.: VI ZR 3/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2425 ff.; BGH, Urteil vom 21.11.2006, Az.: VI ZR 115/05, u.a. in: NJW 2007, Seiten 506 ff.; BGH, Urteil vom 13.02.1996, Az.: VI ZR 126/95, u.a. in: NJW 1996, Seiten 1405 ff.; BGH, Urteil vom 10.01.1995, Az.: VI ZR 247/94, u.a. in: NJW 1995, Seiten 1029 f.; BGH, Urteil vom 19.01.1962, Az.: VI ZR 78/61, u.a. in: VersR 1962, Seite 374; BGH, Urteil vom 16.10.1956, Az.: VI ZR 162/55, u.a. in: NJW 1957, Seiten 99 f.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 15.04.2014, Az.: 16 U 213/13, u.a. in: VersR 2014, Seiten 1471 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: VRS Band 117 [2009], Nr. 91, Seiten 340 ff.; OLG Oldenburg, VersR 1990, Seiten 1406 f.; OLG Frankfurt/Main, VersR 1981, Seite 841; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Ein Anspruch der Klägerseite wäre insofern aber auch dann ausgeschlossen, wenn der Unfallschaden ganz überwiegend von der Klägerin verursacht bzw. verschuldet worden wäre, so dass der Verursachungsbeitrag des Beklagten zu 1.) ggf. sogar vernachlässigt werden könnte (§ 17 Abs. 1 StVG, § 254 Abs. 1 BGB). Hier hat das Gericht aber die Überzeugung gewonnen, dass beide Fahrer schuldhaft den Verkehrsunfall verursacht haben, wie noch ausgeführt werden wird.
Da der Schaden somit hier durch zwei Kraftfahrzeuge verursacht worden ist und die grundsätzliche Haftung der Parteien hierfür nach Überzeugung des Gerichts feststeht, hängt in ihrem Verhältnis zueinander die Verpflichtung zum Schadenersatz sowie der Umfang des jeweils zu leistenden Ersatzes gemäß § 17 Abs. 1 und 2 StVG von den Umständen und insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verursacht worden ist. Die Schadensverteilung richtet sich dabei jedoch auch nach dem Gewicht einer etwaigen Schuld der jeweils Beteiligten. Für das Maß der Verursachung ist somit stets ausschlaggebend, mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit ein Umstand allgemein geeignet ist, einen solchen Schaden herbeizuführen. Jedoch können im Rahmen dieser Abwägung zu Lasten einer Partei nur solche unfallursächlichen Tatsachen berücksichtigt werden, auf die diese Partei sich beruft oder die anderweitig feststehen bzw. unstreitig oder erwiesen sind (BGH, Urteil vom 20.02.2013, Az.: VIII ZR 339/11, u.a. in: NJW 2013, Seiten 2018 ff.; BGH, Urteil vom 20.03.2012, Az.: VI ZR 3/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2425 ff.; BGH, Urteil vom 21.11.2006, Az.: VI ZR 115/05, u.a. in: NJW 2007, Seiten 506 ff.; BGH, Urteil vom 13.02.1996, Az.: VI ZR 126/95, u.a. in: NJW 1996, Seiten 1405 ff.; BGH, Urteil vom 10.01.1995, Az.: VI ZR 247/94, u.a. in: NJW 1995, Seiten 1029 f.; BGH, Urteil vom 19.01.1962, Az.: VI ZR 78/61, u.a. in: VersR 1962, Seite 374; BGH, Urteil vom 16.10.1956, Az.: VI ZR 162/55, u.a. in: NJW 1957, Seiten 99 f.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 15.04.2014, Az.: 16 U 213/13, u.a. in: VersR 2014, Seiten 1471 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 02.04.2009, Az.: 12 U 214/08, u.a. in: VRS Band 117 [2009], Nr. 91, Seiten 340 ff.; OLG Oldenburg, VersR 1990, Seiten 1406 f.; OLG Frankfurt/Main, VersR 1981, Seite 841; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Die danach vorzunehmende Abwägung der Verursachungsbeiträge gemäß § 17 Abs. 1 StVG bzw. § 254 Abs. 1 BGB, in die nur bewiesene, zugestandene oder unstreitige Tatsachen einzustellen sind, führt in dem hier zu entscheidenden Fall dann aber dazu, dass die Klägerin von den Beklagten zu 1.) und 2.) als Gesamtschuldner dem Grunde nach 1/3 der ihr entstandenen Schäden ersetzt verlangen kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird die allgemeine Betriebsgefahr nämlich durch besondere Umstände erhöht, was bei der Schadensteilung mitzuberücksichtigen ist. Hierfür kommt namentlich eine fehlerhafte oder verkehrswidrige Fahrweise der bei dem Betrieb des jeweiligen Kraftfahrzeugs tätigen Personen in Betracht (BGH, Urteil vom 26.04.2005, Az.: VI ZR 228/03, u.a. in: NJW 2005, Seiten 1940 ff.; BGH, Urteil vom 18.11.2003, Az.: VI ZR 31/02, u.a. in: NJW 2004, Seiten 772 ff.; BGH, VersR 2000, Seiten 1294 ff.; LG Flensburg, Urteil vom 05.01.2018, Az.: 2 O 228/13, u.a. in: NZV 2018, Seite 239; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Dafür, dass die Betriebsgefahr eines am Unfall beteiligten Fahrzeugs durch die – ggf. schuldhafte – Fahrweise des Fahrers gegenüber der dem anderen Fahrzeug wesentlich erhöht war und dass den Fahrer eines Fahrzeugs an dem Unfall ein Verschulden trifft, ist aber grundsätzlich die insofern behauptende Prozesspartei auch darlegungs- und beweispflichtig (BGH, Urteil vom 13.02.2007, Az.: VI ZR 58/06, u.a. in: NJW-RR 2007, Seiten 1077 ff.; OLG München, Urteil vom 29.10.2010, Az.: 10 U 2996/10, u.a. in: FD-StrVR 2010, Nr. 311107 = „juris“; OLG München, Urteil vom 01.12.2006, Az.: 10 U 4707/06, u.a. in: BeckRS 2006, Nr. 14437 = „juris“; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Auch die Neufassung von § 7 Abs. 2 StVG führt somit weder zu einer Änderung der Beweislastverteilung hinsichtlich des Mitverschuldens noch zu einer anderen Bewertung der Betriebsgefahr (OLG Nürnberg, Urteil vom 23.11.2004, Az.: 3 U 2818/04, u.a. in: NZV 2005, Seiten 422 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 13.01.2017, Az.: 31 C 71/16, u.a. in: DAR 2017, Seiten 322 ff.).
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und dem unstreitigen Vortrag der Prozessparteien hat die Klägerin aber nicht in dem gebotenem Maße auf den rechts – zunächst wohl noch seitlich etwas nach hinten versetzt – fahrende Beklagten zu 1.) bei ihrem Fahrstreifenwechsel nach rechts geachtet und hierbei den Beklagten zu 1.) gefährdet (§ 7 Abs. 5 StVO).
Unstreitig wurde der klägerische Pkw während der Kollision der beiden Fahrzeuge dann aber im Bereich vorne rechts und das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) im Bereich hinten links getroffen, so dass sich das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) im Augenblick der Kollision bereits etwas nach vorne versetzt rechts neben dem Pkw der Klägerin befunden haben muss.
Die Zeugin Jennifer Kühn hat im Übrigen ausgesagt, dass die Klägerin mit ihrem Pkw links an dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) vorbeigefahren sei. In Höhe des Schildes, wo die Einfädelung angezeigt worden sei, habe die Klägerin dann zum Einfädeln nach rechts mit ihrem Pkw geblinkt. Zudem bekundete die Zeugin Kühn, dass sie hierbei auch gesehen habe, dass die Klägerin dann mehrmals in den Rückspiegel und auch in den Seitenspiegel geschaut habe und sie – die Zeugin – dann gefragt hätte, ob noch jemand neben dem klägerischen Pkw sei. Sie – die Zeugin – habe daraufhin dann gesagt, dass noch genügend Platz sei. Als die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt worden sei, habe die Klägerin ihren Pkw das erste Mal abgebremst. Als dann das Ende der linken Fahrspur gekommen sei und die Klägerin nach rechts mit ihrem Pkw habe rüber ziehen wollen, habe das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) jedoch beschleunigt. Sie – die Zeugin – habe dann gesehen, dass das Beklagtenfahrzeug plötzlich rechts neben dem klägerischen Pkw gewesen sei. Als sie – die Zeugin – das Beklagtenfahrzeug das erste Mal rechts neben sich sah, sei die Front des Kraftfahrzeugs des Beklagten zu 1.) etwa auf der Höhe der Hälfte des klägerischen Pkws gewesen. Die Klägerin habe ihren Pkw dann zwar dann auch noch ein zweites Mal kurz vor der Kollision abgebremst, jedoch sei die Klägerin dann auch noch nach rechts mit ihrem Pkw rüber gezogen, da vorne dann die Baustelle vielleicht nur noch 0,5 m bis 1 m entfernt gewesen sei.
Das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) befand sich somit zum Zeitpunkt unmittelbar vor der Kollision der beiden Fahrzeuge – entsprechend dem Ergebnis der Beweisaufnahme und dem unstreitigen Vortrag der Prozessparteien – noch etwas seitlich versetzt hinter dem klägerischen Pkw und dann zum Zeitpunkt der Kollision der beiden Fahrzeuge schon etwas seitlich versetzt vor dem klägerischen Pkw in paralleler Richtung mit diesem. Dies ergibt sich nicht nur aufgrund der vorliegenden Beschädigungen an beiden Fahrzeugen, sondern auch aus der Aussage der Zeugin Jennifer Kühn.
Ein Pflichtverstoß des Beklagten zu 1.) liegt insofern aber nicht bereits schon darin, dass er den rechten Fahrstreifen der beiden ursprünglichen Fahrstreifen der Potsdamer Straße benutzt hatte. Der § 2 Abs. 2 StVO gebietet vielmehr jedem Verkehrsteilnehmer möglichst weit rechts zu fahren. Diesem Gebot ist der Beklagte zu 1.) hier aber unstreitig nachgekommen. Die Klägerin hingegen nicht.
Bei dieser Lage hatte die Klägerin dann aber auch die Vorschrift des § 7 Abs. 5 StVO zu beachten, wonach ein Fahrstreifen – auch wenn er wie hier wegfällt – nur dann wechseln darf, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Beim Wegfall des linken Fahrstreifens hat der auf der durchgehenden rechten Fahrspur fahrende Fahrer – hier der Beklagte zu 1.) – aber den Vortritt, da mit ihm der „Reißverschluss“ des § 7 Abs. 4 StVO beginnt, auch wenn der auf der durchgehenden Fahrspur fahrende Beklagte zu 1.) ein Einordnen des klägerischen Pkws grundsätzlich ermöglichen musste und seinen Vortritt nicht erzwingen durfte (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Da hier insofern die linke von 2 Fahrspuren endete, hatte somit aber zunächst grundsätzlich der auf der durchgehenden rechten Fahrspur fahrende Beklagte zu 1.) den Vorrang vor dem klägerischen Pkw, welcher unstreitig auf der endenden linken Fahrspur fuhr. Das Gefährdungsverbot des StVO § 7 Abs. 5 StVO gilt nämlich auch bei einem Fahrstreifenwechsel im Zusammenhang mit dem Reißverschlussverfahren nach § 7 Abs. 4 StVO. Die auf dem nicht durchgehenden Fahrstreifen fahrende Klägerin durfte dem entsprechend nicht ohne weiteres darauf vertrauen, dass ihr der Spurwechsel von dem bevorrechtigten Beklagten zu 1.) auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen unter Verzicht auf sein Vorrecht ermöglicht wird (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Die Klägerin hätte sich somit hier nur unter besonderer Rücksichtnahme und mit angemessener Geschwindigkeit – unter Beachtung der hier bestehenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – im Wechsel 1:1 nach rechts auf die durchgehende Fahrspur einordnen dürfen (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Dabei musste die Klägerin den Fahrstreifenwechsel zwar im Übrigen rechtzeitig und deutlich ankündigen, jedoch hat die Zeugin Jennifer Kühn ausgesagt, dass die Klägerin ab dem Schild, wo die Einfädelung angezeigt wurde, dann zum Einfädeln bereits nach rechts mit ihrem Pkw geblinkt habe. Auch habe die Klägerin dann mehrmals in den Rückspiegel und auch in den Seitenspiegel geschaut, so dass das erkennende Gericht davon ausgeht, dass die Klägerin diese Anforderungen an einen Fahrstreifenwechsel auch erfüllt hatte.
Wer aber – wie hier die Klägerin – bei einer „Reisverschlussbildung“ die Spur wechseln will, darf nicht darauf vertrauen, dass ihm dies auch ermöglicht wird. Vielmehr muss er den Spurwechsel nicht nur rechtzeitig anzeigen und zurück schauen sondern darf er dann auch nur allmählich auf den anderen Fahrstreifen hinüberfahren (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.), welches sich unstreitig auf dem durchgehenden (hier rechten) Fahrstreifen befunden hatte, genoss nämlich anerkanntermaßen den Vorrang vor dem klägerischen Pkw, der unstreitig auf dem endenden (linken) Fahrstreifen fuhr (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Der Beklagte zu 1.) durfte auch darauf vertrauen, dass die Klägerin nicht in riskanter Weise auf den von ihnen benutzten Fahrstreifen wechselt (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Zur Vermeidung einer Gefährdung hätte die Klägerin deshalb hier grundsätzlich zurückbleiben und sich erst hinter dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) nach rechts einordnen dürfen. Dass die Klägerin dies nicht getan hat, ist ihr somit dann auch als ein nicht unerhebliches Verschulden hier mit anzulasten (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Etwas anderes kommt dann in Betracht, wenn die beiden Fahrzeuge in einem Abstand an den durchgehenden rechten Fahrstreifen angekommen wären, der den Anforderungen des § 4 Abs. 1 StVO genügt und der Klägerin dort ein dementsprechendes einordnen wiederum unter Berücksichtigung des § 4 Abs. 1 StVO ermöglicht hätte. Insofern ist hier aber unstreitig, dass weder vor dem klägerischen Pkw noch vor dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) andere Fahrzeuge gefahren sind. Im Hinblick darauf, dass beim Reisverschlussverfahren den am weiter fahren gehinderten Fahrzeugen der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen ist, dass sich diese Fahrzeuge jeweils im Wechsel nach einem auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug einordnen können, ist vorliegend dann aber hier somit zu beachten, dass unstreitig unmittelbar vor dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) kein anderes im rechten Fahrstreifen fahrendes Fahrzeug durch die Engstelle gefahren ist und vor dem Pkw der Klägerin auch kein auf dem linken Fahrstreifen fahrendes Fahrzeug bereits nach rechts fuhr, so dass – gemäß dem o.g. Reisverschlussprinzip – das Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.), welches sich unstreitig auf dem durchgehenden (hier rechten) Fahrstreifen befunden hatte, auch insofern den Vorrang vor dem klägerischen Pkw genoss. Jedenfalls spricht der Umstand, dass beide Fahrzeuge sich unmittelbar vor der Kollision nahezu parallel nebeneinander befanden eher dagegen, dass der Beklagte zu 1.) zum Zeitpunkt der Kollision überhaupt in einer Position war, bei der er der Klägerin das Einordnen nach rechts hätte ermöglichen können oder gar müssen (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Ein solch großer „Vorsprung“ des Pkws der Klägerin war hier somit entsprechend dem Ergebnis der Beweisaufnahme und dem unstreitigen Vortrag der Prozessparteien zum Zeitpunkt des Fahrstreifenwechsels durch die Klägerin und der sich unmittelbar hieran anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge dem entsprechend gerade nicht [zumindest nicht mehr] gegeben (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Entgegen ihrer Ansicht kann sich die Klägerseite hier somit gerade nicht auf ein Vorfahrtsrecht der Klägerin berufen, welches zu ihren Gunsten wirken würde, da die Klägerseite die Voraussetzungen dafür, dass die Klägerin im Rahmen des sogenannten „Reisschlussverfahrens“ (§ 7 Abs. 4 StVO) noch rechtzeitig vor dem Kraftfahrzeug des Beklagten zu 1.) von der linken auf die rechte Fahrspur mit ihrem Pkw wechseln konnte, weder ausreichend dargelegt noch bewiesen hat.
Gemäß § 1 und § 7 Abs. 4 StVO ist beim Wegfall eines Fahrstreifens den am weiter fahren gehinderten Fahrzeugen jedoch grundsätzlich der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass sich diese Fahrzeuge jeweils im Wechsel nach einem auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug einordnen können. Dieser „Reisverschluss“ beginnt jedoch auf dem durchgehenden Fahrstreifen (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
In der Rechtsprechung ist nunmehr auch klargestellt, dass das Gefährdungsverbot bei Fahrstreifenwechsel gemäß § 7 Abs. 5 StVO auch im Zusammenhang mit dem „Reisverschlussverfahren“ gemäß § 7 Abs. 4 StVO gilt (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Bei dem von ihr durchgeführten Fahrstreifenwechsel von links nach rechts unterlag die Klägerin damit aber auch den besonderen Sorgfaltspflichten des § 7 Abs. 5 StVO. Äußerste Sorgfalt setzt aber ausreichende Rückschau auf den nachfolgenden Verkehr und einen ausreichenden Abstand zu ihm auf den angestrebten Fahrstreifen voraus (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Wegen der mit einem Fahrstreifenwechsel innerhalb des mehrspurigen Verkehrs verbundenen typischen Gefahren und der besonders gesteigerten Sorgfaltspflicht des Fahrstreifenwechslers spricht somit der Beweis des ersten Anscheins hier für ein Verschulden der Klägerin. Dies gilt auch für das Reißverschlussverfahren nach § 7 Abs. 4 StVO. Grundsätzlich trifft den Verkehrsteilnehmer, der unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer den Fahrstreifen wechselt, somit ggf. sogar die volle Haftung (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Eine Mithaftung der Beklagten kommt aber dann in Betracht, wenn eine überhöhte Geschwindigkeit des Beklagten zu 1.) vorlag und/oder feststeht, dass der Beklagte zu 1.) die Gefahr der Kollision auf sich hätte zukommen sehen müssen; er also hätte erkennen müssen, dass die Klägerin ihm – trotz der Verengung des Verkehrsraums im linken Bereich – den Vortritt nicht gewähren würde (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
In derartigen Fällen liegt dann nämlich eine Sorgfaltspflichtverletzung des bevorrechtigten Beklagten zu 1.) vor (Verstoß gegen § 3 StVO und/oder § 1 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 StVO), der nicht mit überhöhte Geschwindigkeit hätte fahren dürfen und/oder auf seinen Vorrang hätte verzichten müssen, so dass dann auch eine Mithaftungsquote zuzusprechen ist (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Wegen der im Reißverschlussverfahren gemäß § 7 Abs. 4 StVO dem spurhaltenden Verkehrsteilnehmer obliegenden Sorgfaltspflichten kann diesen beim Zusammenstoß mit einem Spurwechsler grundsätzlich somit auch eine Mithaftung treffen, deren Quote sich nach den Umständen des Einzelfalls richtet.
Vermindert der an sich bevorrechtigte Fahrer z.B. nicht rechtzeitig seine Geschwindigkeit und verzichtet er auch nicht auf seinen Vorrang, obwohl er erkannt hat, dass sein Vorrang nicht von der anderen Verkehrsteilnehmerin beachtet wird, kommt ggf. sogar eine Mithaftung bis zu einer Quote von 50 % – nicht aber wie von der Klägerseite hier mit einer Quote von 75 % begehrt – in Betracht (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Wegen der im Reißverschlussverfahren nämlich auch den spurhaltenden Verkehrsteilnehmer – hier dem Beklagten zu 1.) – treffenden Sorgfaltspflichten gemäß § 1, § 3 StVO und § 11 Abs. 3 StVO trifft diesen bei einem Zusammenstoß mit einer Spurwechslerin grundsätzlich auch eine gewisse Mithaftung, wobei sich die jeweilige Quote nach den Umständen des Einzelfalls richtet (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Entsprechend dem Vortrag der Prozessparteien sowie aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme hätte der Beklagte zu 1.) hier aber wohl bei gehöriger Vorsicht und einer ggf. möglichen, aber unterbliebenen Ausweichreaktion sowie bei einer Abbremsung (anstatt einer Beschleunigung) seines Kraftfahrzeugs den Unfall ggf. wohl noch vermeiden können (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]), so dass eine Mithaftung des bevorrechtigten Beklagten zu 1.) von lediglich 1/3 nach Abwägung der beiderseitigen Verursachungsbeiträge hier im konkreten Fall gerechtfertigt erscheint.
Vorliegend scheidet eine über 33,33 % liegende Mithaftung der Beklagten aber nach Überzeugung des erkennenden Gerichts (auch unter Berücksichtigung der vom Pkw der Klägerin ausgehenden Betriebsgefahr) aus, da auch die Klägerin verschuldensbegründend die ihr auch im Reißverschlussverfahren obliegenden gesteigerten Pflichten aus § 7 Abs. 5 StVO hier nicht beachtet hat (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Die Abwägung der beiderseitigen Verursachungsbeiträge ergibt hier somit, dass die durch ein erhebliches Fehlverhalten der Klägerin und des Fehlverhalten des Beklagten zu 1.) jeweils erhöhte Betriebsgefahr ihres jeweiligen Fahrzeugs eine Haftungsverteilung im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zu Lasten der Klägerin danach hier angemessen erscheint.
Das erkennende Gericht berücksichtigt dabei, dass der Klägerin ein erheblicher Verkehrsverstoß zur Last fällt. Ihr ist nämlich ein Verstoß nach § 7 Abs. 5 StVO zur Last zu legen, da sie nach dieser Vorschrift in jeden Fall zunächst ein Fahrzeug des durchgehenden rechten Fahrstreifens – d.h. heißt hier des Beklagten zu 1.) – hätte passieren lassen müssen.
Jedoch ist dem Beklagten zu 1.) vorliegend ein Verstoß gegen § 3 StVO und gegen § 11 Abs. 3 StVO zur Last zu legen.
Beide Prozessparteien haben im Übrigen aber auch die Vorsichtsregeln des § 1 StVO nicht in dem gebotenen Maße beachtet, da beide die Verengung der Fahrbahn bereits unstreitig von weitem aus erkannt hatten und in diesem Bereich zudem auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h galt. Dies hätten aber beide Verkehrsteilnehmer bei Tageslicht (der Unfall ereignete sich am 21.09.2023 gegen 15:40 Uhr) wohl augenscheinlich wahrnehmen müssen.
Auch hätte der Beklagte zu 1.) den links von ihm fahrenden Pkw der Klägerin wohl ohne weiteres noch rechtzeitig wahrnehmen können und sich auch auf einen Spurwechsel der Klägerin von links nach rechts einstellen müssen, wenn der Beklagte zu 1.) wie ein „Idealfahrer“ im o.g. Sinne gefahren wäre. Dies hat der Beklagte zu 1.) aber nicht getan, sondern sogar noch sein Kraftfahrzeug unmittelbar vor der Kollision unstreitig beschleunigt.
Bei der Abwägung der von beiden Fahrzeugen in die Kollision eingebrachten Verursachungsbeiträge nach § 17 StVG wiegt der Anteil des Pkws der Klägerin jedoch schwerer als der Beitrag des Kraftfahrzeugs der Beklagtenseite, so dass hier auch eine Quote von 1/3 zu 2/3 zu Lasten der Klägerin als angemessen anzusehen ist. Das Gefährdungsverbot bei Vornahme eines Fahrstreifenwechsels (§ 7 Abs. 5 StVO) stellt nämlich auch beim Reißverschlussverfahren (§ 7 Abs. 4 StVO) eine Kernregel dar, deren Beachtung für den Straßenverkehr von grundliegender Bedeutung ist und deren Missachtung die Betriebsgefahr des betreffenden Fahrzeugs daher ganz entscheidend erhöht. Es kommt hinzu, dass die Klägerin durch einen Fahrfehler die kritische Situation überhaupt erst geschaffen hat.
Dem Beklagten zu 1.) ist jedoch vorzuwerfen, dass er in dieser von ihm vorgefundene Situation nicht nur nicht angemessen handelte, sondern sogar noch beschleunigte. Diese Kausalbeiträge rechtfertigen somit eine derartige Verantwortlichkeit.
Kommt es somit im konkreten Fall an einer Stelle der Fahrbahn, wo sich diese von 2 auf 1 Fahrstreifen verengt, zu einer derartigen Kollision, ist grundsätzlich von einer quotenmäßigen Haftungsteilung auszugehen (BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.: VI ZR 47/21; BGH, Urteil vom 08.10.1965, Az.: 4 StR 466/65; OLG Brandenburg, Urteil vom 25.07.2024, Az.: 12 U 8/24; OLG Hamm, Urteil vom 19.09.2023, Az.: 7 U 99/22; OLG Celle, Urteil vom 20.05.2020, Az.: 14 U 193/19; OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.08.2019, Az.: 4 U 18/19; OLG Köln, Beschluss vom 29.06.2017, Az.: 19 U 56/17; OLG München, Urteil vom 21.04.2017, Az.: 10 U 4565/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az.: I-1 U 152/13; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2010, Az.: 3 U 3/10; KG Berlin, Beschluss vom 19.10.2009, Az.: 12 U 227/08; KG Berlin, Beschluss vom 03.09.2009, Az.: 12 U 136/09; OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2004, Az.: 9 U 110/04; OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 08.12.2003, Az.: 16 U 173/03; KG Berlin, Urteil vom 23.10.1995, Az.: 12 U 1861/94; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.1991, Az.: 15 U 133/90; KG Berlin, Urteil vom 14.01.1991, Az.: 12 U 7816/89; KG Berlin, Urteil vom 07.06.1990, Az.: 12 U 4191/89; KG Berlin, Urteil vom 12.11.1987, Az.: 12 U 5147/86; KG Berlin, Urteil vom 08.01.1987, Az.: 12 U 2618/87; KG Berlin, Urteil vom 01.07.1985, Az.: 12 U 3939/84; KG Berlin, Urteil vom 10.01.1985, Az.: 12 U 2227/84; KG Berlin, Urteil vom 29.09.1983, Az.: 12 U 3546/82; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28.12.1982, Az.: 1 Ss 826/82; OLG Schleswig, Urteil vom 27.06.1979, Az.: 9 U 124/78; KG Berlin, Urteil vom 17.05.1979, Az.: 22 U 702/79; LG Potsdam, Urteil vom 09.01.2024, Az.: 11 O 290/22; LG Hamburg, Urteil vom 03.03.2023, Az.: 337 O 50/22; LG Verden, Urteil vom 15.10.2019, Az.: 5 O 139/18; LG Hamburg, Urteil vom 07.05.2019, Az.: 323 O 218/18; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 09.04.2018, Az.: 13 O 302/17; LG München II, Urteil vom 14.10.2016, Az.: 12 O 3303/16; LG Dortmund, Urteil vom 07.01.2014, Az.: 21 O 359/12; LG München I, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 19 O 3476/08; LG Berlin, Urteil vom 27.08.2007, Az.: 59 O 56/07; LG Hanau, Urteil vom 29.09.2003, Az.: 4 O 545/03; LG Berlin, Urteil vom 07.05.2003, Az.: 24 O 34/03; LG München I, Urteil vom 07.06.2002, Az.: 17 S 22537/01; LG Erfurt, Urteil vom 13.07.2001, Az.: 2 S 475/00; LG Halle/Saale, Urteil vom 11.09.1998, Az.: 5 O 396/97; LG Bielefeld, Urteil vom 05.07.1995, Az.: 1 S 252/94; AG Hamburg, Urteil vom 30.07.2015, Az.: 32 C 4/15; AG Rüdesheim, Beschluss vom 04.09.2014, Az.: 3 C 208/14; AG Dinslaken, Urteil vom 15.02.2013, Az.: 32 C 239/11; AG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.12.2012, Az.: 29 C 2270/11 [46]; AG Dortmund, Urteil vom 23.02.2010, Az.: 423 C 12873/09; AG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2007, Az.: 52 C 3472/06; AG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2006, Az.: 41 C 3418/06; AG Hamburg, Urteil vom 07.07.2005, Az.: 50A C 102/05; AG Rüsselsheim, Urteil vom 06.11.2000, Az.: 3 C 743/00 [33]).
Hinsichtlich der hier geltend gemachten Unkostenpauschale in Höhe von 35,00 Euro ist zwar korrekt, dass es eine generelle Anerkennung einer Unkostenpauschale für sämtliche Schadensfälle ohne nähere Darlegung der getätigten Aufwendungen – etwa auch im Rahmen der vertraglichen Haftung – in der Rechtsprechung nicht gibt (BGH, Urteil vom 26.06.2019, Az.: VIII ZR 95/18, u.a. in: MDR 2019, Seiten 1118 f.; BGH, Urteil vom 08.05.2012, Az.: VI ZR 37/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2267 f.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.12.2005, Az.: I-15 U 44/05 AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.) und dies auch angesichts der unterschiedlichen Abläufe bei der jeweiligen Schadensabwicklung wohl nicht gerechtfertigt wäre (BGH, Urteil vom 26.06.2019, Az.: VIII ZR 95/18, u.a. in: MDR 2019, Seiten 1118 f.; BGH, Urteil vom 08.05.2012, Az.: VI ZR 37/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2267 f.).
Jedoch wird insoweit hinsichtlich solcher Kosten bei der Abwicklung von Verkehrsunfallschäden – so wie hier – regelmäßig von näherem Vortrag abgesehen und erkennt die Rechtsprechung dem Geschädigten eine Auslagenpauschale zu, auch wenn Anknüpfungstatsachen hierfür im konkreten Einzelfall nicht dargetan sind, da dies dem Umstand geschuldet ist, dass es sich bei der Regulierung von Verkehrsunfällen um ein „Massengeschäft“ handelt (BGH, Urteil vom 26.06.2019, Az.: VIII ZR 95/18, u.a. in: MDR 2019, Seiten 1118 f.; BGH, Urteil vom 08.05.2012, Az.: VI ZR 37/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2267 f.; BGH, Beschluss vom 18.11.2008, Az.: VI ZB 22/08, u.a. in: BGHZ Band 178, Seite 338; BGH, VersR 1978, Seiten 278 ff.; OLG Hamm, Urteil vom 18.08.2015, Az.: I-9 U 169/14, u.a. in: NJW 2016, Seiten 505 ff.), bei dem der Gesichtspunkt der Praktikabilität besonderes Gewicht zukommt (BGH, Urteil vom 08.05.2012, Az.: VI ZR 37/11, u.a. in: NJW 2012, Seiten 2267 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.).
Deshalb geht das erkennende Gericht seit der Entscheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 16.06.1998 (Aktenzeichen: 2 U 012/97) in ständiger Rechtsprechung (vgl. u.a.: AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Beschluss vom 22.09.2011, Az.: 31 C 1241/11, u.a. in: NZV 2012, Seite 339 = BeckRS 2011, Nr.: 23216 = ADAJUR Dok.Nr.: 98744 = „juris“) davon aus, dass ein Geschädigter dem Grunde nach bei derartigen „Massengeschäften“ – wie hier – eine allgemeine Unkostenpauschale in Höhe von 25,00 Euro begehren kann (ebenso: Grüneberg, in: Grüneberg, 83. Auflage 2024, § 286 BGB, Rn. 45; Böhme/Biela/Tomson, in: Böhme/Biela/Tomson, Kraftverkehrs-Haftpflicht-Schäden, 26. Aufl. 2018, 10. Kapitel Kosten, Abschnitt III, 2. Kostenpauschale, Rn. 19; Freymann/Rüßmann, in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl. 2016, § 249 BGB, Rn. 243; Kappus, NJW 2008, Seiten 891 f.; und vor allem die hierzu ergangene, umfassende herrschende Rechtsprechung: BGH, Urteil vom 02.06.2015, Az.: VI ZR 387/14, u.a. in: NJW 2015, Seite 2958; BGH, Urteil vom 04.05.2011, Az.: VIII ZR 171/10, u.a. in: NJW 2011, Seiten 2871 f.; BGH, Beschluss vom 11.03.2008, Az.: VI ZB 9/06, u.a. in: NJW-RR 2008, Seite 898; OLG Hamm, Urteil vom 07.11.2023, Az.: 7 U 131/22, u.a. in: NZV 2024, Seite 398; OLG Saarbrücken, Urteil vom 24.03.2023, Az.: 3 U 9/23, u.a. in: NJOZ 2023, 596; OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.02.2023, Az.: 12 U 177/22, u.a. in: NJOZ 2023, 1158; OLG Celle, Urteil vom 16.06.2021, Az.: 14 U 152/20, u.a. in: „juris“; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 09.03.2021, Az.: 23 U 120/20, u.a. in: NJW-RR 2021, Seite 753; OLG München, Urteil vom 24.02.2021, Az.: 10 U 5726/20, u.a. in: NJOZ 2021, Seite 651; OLG Saarbrücken, Urteil vom 10.12.2020, Az.: 4 U 9/20, u.a. in: NJW-RR 2021, Seite 417; OLG Koblenz, Urteil vom 16.11.2020, Az.: 12 U 207/19, u.a. in: NJW-RR 2021, Seite 280; OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.06.2018, Az.: I-1 U 164/17, u.a. in: BeckRS 2018, Nr. 16046 = juris; OLG Celle, Urteil vom 15.05.2018, Az.: 14 U 175/17, u.a. in: NJW-Spezial 2018, Seite 426; OLG Saarbrücken, Urteil vom 29.03.2018, Az.: 4 U 56/17, u.a. in: SVR 2018, Seiten 255 f.; OLG München, Urteil vom 23.03.2018, Az.: 10 U 2647/17, u.a. in: MDR 2018, Seiten 667 f.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.03.2018, Az.: 1 U 55/17, u.a. in: Verkehrsrecht aktuell 2018, Seiten 132 f.; OLG München, Urteil vom 09.03.2018, Az.: 10 U 3204/17, u.a. in: BeckRS 2018, Nr. 4501 = „juris“; KG Berlin, Beschluss vom 22.01.2018, Az.: 22 U 65/16, u.a. in: BeckRS 2018, Nr. 7286 = „juris“; OLG Karlsruhe, Urteil vom 01.06.2017, Az.: 9 U 194/15, u.a. in: VersR 2018, Seiten 244 f.; OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.04.2017, Az.: 9 U 189/15, u.a. in: NJW 2017, Seiten 2626 ff.; OLG Nürnberg, Urteil vom 19.04.2017, Az.: 4 U 2292/16, u.a. in: NJW-RR 2017, Seiten 1106 ff.; OLG Köln, Urteil vom 10.11.2016, Az.: I-7 U 91/16, u.a. in: VersR 2017, Seiten 774 f.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 25.10.2016, Az.: 16 U 167/15, u.a. in: SVR 2017, Seiten 27 ff.; OLG Hamm, Urteil vom 06.09.2016, Az.: I-9 U 118/15, u.a. in: BeckRS 2016, Nr. 18084 = „juris“; OLG Celle, Urteil vom 13.07.2016, Az.: 14 U 64/16, u.a. in: MDR 2016, Seiten 1262 f.; OLG Hamm, Urteil vom 18.03.2016, Az.: I-9 U 142/15, u.a. in: NZV 2016, Seiten 336 ff.; OLG München, Urteil vom 26.02.2016, Az.: 10 U 579/15, u.a. in: BauR 2016, Seite 1812; OLG Celle, Urteil vom 26.01.2016, Az.: 14 U 148/15, u.a. in: DAR 2016, Seiten 463 f.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 10.09.2015, Az.: 22 U 73/14, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 731 ff.; OLG Karlsruhe, Urteil vom 24.06.2015, Az.: 9 U 29/14, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 146 ff.; OLG Saarbrücken, Urteil vom 09.10.2014, Az.: 4 U 46/14, u.a. in: NJW-RR 2015, Seiten 223 ff.; OLG Saarbrücken, Urteil vom 08.05.2014, Az.: 4 U 61/13, u.a. in: Schaden-Praxis 2015, Seiten 49 f.; OLG Saarbrücken, Urteil vom 16.05.2013, Az.: 4 U 461/11; OLG München, Urteil vom 26.04.2013, Az.: 10 U 4938/12, u.a. in: SVR 2013, Seite 463; OLG Frankfurt/Main, NJW-RR 2013, Seiten 664 ff.; OLG Köln, Urteil vom 26.02.2013, Az.: 3 U 141/12, u.a. in: „juris“; OLG Koblenz, DAR 2012, Seiten 704 ff.; OLG Saarbrücken, Urteil vom 10.05.2011, Az.: 4 U 261/10; OLG München, Urteil vom 08.04.2011, Az.: 10 U 5122/10; OLG Hamm, NJW-RR 2011, Seiten 464 f.; OLG Saarbrücken, Schaden-Praxis 2011, Seiten 446 ff.; OLG Stuttgart, Urteil vom 07.04.2010, Az.: 3 U 216/09, u.a. in: BeckRS 2010, Nr.: 13003; OLG München, NJW 2010, Seiten 1462 ff.; OLG München, Urteil vom 10.07.2009, Az.: 10 U 5609/08, u.a. in: „juris“; OLG München, Urteil vom 10.07.2009, Az.: 10 U 5609/08, u.a. in: „juris“; OLG München, VRR 2009, Seite 162 = ZAP EN-Nr. 463/2009; OLG Saarbrücken, NJW-Spezial 2009, Seite 267; OLG Zweibrücken, VersR 2009, Seiten 541 f.; OLG Bamberg, Schaden-Praxis 2009, Seiten 19 ff.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2008, Az.: I-1 U 246/07; OLG München, Urteil vom 18.01.2008, Az.: 10 U 4156/07, teilw. in: NJW-Spezial 2008, Seite 201; OLG Zweibrücken, VRR 2007, Seiten 442 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 05.06.2007, Az.: 2 U 42/06; OLG Celle, ZMR 2008, Seiten 119 f.; OLG Saarbrücken, Urteil vom 19.12.2006, Az.: 4 U 318/06; OLG München, Urteil vom 24.11.2006, Az.: 10 U 2555/06; OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.10.2006, Az.: 1 U 110/06, u.a. in: Verkehrsrecht aktuell 2007, Seite 135; OLG Köln, Verkehrsrecht aktuell 2006, Seiten 183 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.09.2006, Az.: 12 U 61/06; OLG München, NZV 2006, Seiten 261 f.; OLG Celle, Schaden-Praxis 2007, Seiten 278 f.; OLG Koblenz, Schaden-Praxis 2006, Seiten 6 f.; OLG Düsseldorf, DAR 2005, Seiten 217 ff.; KG Berlin, NZV 2005, Seiten 39 f.; OLG Celle, NJW-RR 2004, Seiten 1673 ff.; OLG Saarbrücken, OLG-Report 2005, Seiten 936 ff.; OLG München, NZV 2001, Seite 220; LG Saarbrücken, Urteil vom 20.06.2024, Az.: 13 S 77/23, u.a. in: NJW-RR 2024, 1289; LG Potsdam, Urteil vom 05.07.2017, Az.: 7 S 146/16; LG Saarbrücken, Urteil vom 07.06.2013, Az.: 13 S 34/13; LG Rostock, SP 2013, Seite 81; LG Potsdam, Urteil vom 28.08.2012, Az.: 3 O 250/10, u.a. in: BeckRS 2012, Nr. 210765 = „juris“; LG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2010, Az.: 2b O 159/07, u.a. in: „juris“; LG Karlsruhe, Urteil vom 18.04.2008, Az.: 3 O 335/07, u.a. in: „juris“; LG Wiesbaden, Schaden-Praxis 2008, Seiten 155 f.; LG Potsdam, Urteil vom 20.02.2006, Az.: 2 O 418/05, u.a. in: SVR 2006, Seiten 307 f.; LG Braunschweig, VersR 2006, Seite 1139; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 13.05.2004, Az.: 15 S 309/03, u.a. in: DAR 2004, Seiten 453 f.; LG Berlin, Urteil vom 20.08.2007, Az.: 24 O 751/05, u.a. in: BeckRS 2008, Nr.: 01597; LG Bochum, Urteil vom 21.11.2006, Az.: 9 S 108/06, u.a. in: „juris“; LG Aachen, Schaden-Praxis 2006, Seiten 249 f.; LG Bonn, Schaden-Praxis 2004, Seiten 328 f.; LG Stade, NZV 2004, Seiten 254 f.; LG Aachen, VersR 2002, Seite 1387; LG Braunschweig, NJW-RR 2001, Seite 1682; LG Mainz, DAR 2000, Seite 273; LG Lübeck, SP 1997, Seite 285; LG Verden, SP 1992, Seite 44; LG Augsburg, ZfSch 1991, Seite 48; LG Köln, VersR 1989, Seite 636; LG München I, ZfSch 1985, Seite 200; LG Zweibrücken, ZfSch 1989, Seite 303; LG Hagen/Westfalen, Urteil vom 14.11.2007, Az.: 10 S 35/07; AG Düsseldorf, Schaden-Praxis 2009, Seite 303; AG Gelsenkirchen, Urteil vom 05.02.2009, Az.: 32 C 92/08, u.a. in: „juris“; AG Amberg, AGS 2009, Seite 412; AG Erkelenz, Schaden-Praxis 2009, Seite 221; AG Hildesheim, NJW 2008, Seiten 3365 f.; AG Eilenburg, Urteil vom 20.04.2007, Az.: 4 C 54/07, u.a. in: BeckRS 2008, Nr.: 05970; AG Hamm, Urteil vom 10.04.2007, Az.: 17 C 409/06, u.a. in: „juris“; AG Jena, Schaden-Praxis 2006, Seite 427; AG Aachen, Urteil vom 21.04.2006, Az.: 4 C 328/05, u.a. in: ADAJUR Dok.Nr. 73801 = „juris“; AG Hagen, Urteil vom 29.06.2005, Az.: 16 C 20/05; AG Borna, Schaden-Praxis 2005, Seite 224; AG Dinslaken, Schaden-Praxis 2005, Seite 167; AG Augsburg, SVR 2005, Seiten 348 f.; AG Waiblingen, Urteil vom 05.11.2004, Az.: 14 C 1066/04; AG Stralsund, NZV 2003, Seiten 290 f.; AG Esslingen, DAR 2001, Seiten 36 f.; AG Gronau, DAR 2000, Seite 37).
Für eine Anhebung der vor der Währungsumstellung zuletzt angenommenen 50,00 DM auf nunmehr 30,00 Euro besteht jedoch wohl derzeitig noch kein Anlass (OLG München, Urteil vom 26.04.2013, Az.: 10 U 4938/12; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.).
Die gegenteilige Argumentation, wonach die Preissteigerung seit der letzten Anhebung eine solche Anhebung gebiete, übersieht wohl dabei, dass dem schon die Anhebung auf 50,00 DM diente (OLG München, Urteil vom 26.04.2013, Az.: 10 U 4938/12; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.; AG Brandenburg an der Havel, NZV 2012, Seite 339BeckRS 2011, Nr.: 23216), auch wenn sich die Fahrt- und Postkosten zwischenzeitlich erhöht haben, weil insbesondere die „Flatrate-Tarife“ der Telefon-, Internet- und E-Mail-Verbindungen in den letzten Jahren gesunken sind und gerade derartige Aufwendungen des Geschädigten mehr und mehr im Mittelpunkt seiner vorprozessualen Bemühungen stehen.
Die des weiteren jetzt wohl nur noch von zwei Senaten des Kammergerichts Berlin (vgl. u.a.: Urteil vom 05.04.2018, Az.: 22 U 47/16: Urteil vom 14.12.2017, Az.: 22 U 177/15; Beschluss vom 20.12.2010, Az.: 12 U 70/10; Urteil vom 16.08.2010, Az.: 22 U 15/10; Urteil vom 10.09.2007, Az.: 22 U 224/06 und Urteil vom 04.12.2006, Az.: 12 U 206/05) vertretene Auffassung, dass eine Unkostenpauschale gegenwärtig lediglich in Höhe von 20,00 Euro angemessen sei, orientiert sich nach hiesiger – und wohl auch der überwiegenden, oben näher aufgeführten – Rechtsprechung jedoch auch nicht mehr an der allgemeinen Preisentwicklung (AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.; AG Brandenburg an der Havel, NZV 2012, Seite 339).
Auch vertritt das Brandenburgische Oberlandesgericht hierzu – soweit ersichtlich – keine einheitliche Rechtsauffassung, auch wenn wohl überwiegend beim Brandenburgischen Oberlandesgericht auch von einer Höhe von 25,00 Euro ausgegangen wird (vgl. u.a.: Beschluss vom 06.02.2023, Az.: 12 U 177/22; Urteil vom 17.06.2019, Az.: 12 U 179/18; Beschluss vom 13.06.2019, Az.: 12 W 20/19; Beschluss vom 29.11.2018, Az.: 12 U 92/18; Urteil vom 05.06.2007, Az.: 2 U 42/06; Urteil vom 28.09.2006, Az.: 12 U 61/06).
Im Übrigen besteht insoweit aber auch kein Anlass zu einer mit § 287 ZPO unvereinbaren Pseudogenauigkeit in Form einer Umrechnung auf 25,56 Euro oder 26,00 Euro (OLG München, Urteil vom 26.04.2013, Az.: 10 U 4938/12, u.a. in: SVR 2013, Seite 463; OLG München, NZV 2006, Seiten 261 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.; AG Brandenburg an der Havel, NZV 2012, Seite 339).
Pro Unfallereignis kann darüber hinaus aber nur eine Pauschale erstattet werden, ohne dass es auf die Anzahl der bei dem Unfall beschädigten Gegenstände ankommt, da auch in Fällen, wo mehrere Schadensgruppen betroffen sind, keine gesonderten Unkostenpauschalen erstattet werden. Sofern tatsächlich höhere Kosten entstanden sein sollten, ist es der Klägerseite aber auch unbenommen, ihre Unkosten konkret zu belegen und abzurechnen (OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 08.02.2011, Az.: 22 U 162/08, u.a. in: Schaden-Praxis 2011, Seite 291; OLG Celle, NJW 2008, Seiten 446 ff. = NZV 2008, Seiten 145 ff. = DAR 2008, Seiten 205 ff.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 08.01.2016, Az.: 31 C 111/15, u.a. in: NJW-RR 2016, Seiten 283 ff.; AG Brandenburg an der Havel, NZV 2012, Seite 339).
Der Klägerin steht daher – da die im Übrigen geltend gemachten Reparaturkosten in Höhe von netto 2.618,61 € unstreitig sind – gegenüber den Beklagten als Gesamtschuldnern ein Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 1/3 des Gesamtschadens von 2.643,61 Euro (2.618,61 € Reparaturkosten sowie 25,00 € allgemeine Unkostenpauschale), mithin ein Zahlungsanspruch von 881,20 Euro zu. Da die Beklagten hierauf unstreitig vor Rechtshängigkeit des Verfahrens nichts an die Klägerseite gezahlt haben, ist somit noch ein Anspruch der Klägerin gegenüber den Beklagten in Höhe von 881,20 Euro offen. Im Übrigen ist der Klageantrag zu Ziffer 1. aber aus o.g. Gründen abzuweisen.
Grundsätzlich kann gemäß § 256 ZPO auch eine durch einen Verkehrsunfall Geschädigte auf Feststellung des Bestehens eines Rechtsverhältnisses bzw. der Feststellung einer Verpflichtung der Beklagten ihr gegenüber Klage erheben, jedoch nur dann, wenn die Klägerin auch ein rechtliches Interesse daran hat, dass dieses Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt wird. Weitere Schäden der Klägerin müssen insofern wenigstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch immer zu erwarten sein (BGH, NJW 1952, Seite 539; BGH, ZZP 85 (1972), Seite 245; BGH, NJW 1993, Seiten 648 ff.).
Das somit hier erforderliche besondere Feststellungsinteresse ist eine Prozessvoraussetzung und eine qualifizierte Form des sonst erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses. Dieses Feststellungsinteresse muss zudem bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorliegen (Reichsgericht, RGZ Band 71, Seite 73; BGH, NJW 1955, Seite 1513; BGH, NJW 2006, Seiten 2780 ff.; BAG, NJW 2000, Seite 3226), da sonst die Klage ex nunc unzulässig wird. Nur wenn das Feststellungsinteresse zum Schluss der mündlichen Verhandlung fehlt, so würde dies grundsätzlich auch zur Klageabweisung in diesem Punkt durch Prozessurteil führen.
Bei Beschädigung eines Kraftfahrzeugs kann insofern aber grundsätzlich ein Anspruch auf Feststellung der Ersatzpflicht für künftige materielle Schäden (wie die fällig werdende Umsatzsteuer bei einer noch durchzuführenden Kfz-Reparatur und/oder eine Nutzungsausfallentschädigung für den Zeitraum der Kfz-Reparatur) bestehen. Das rechtliche Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO ergab sich hier daraus, dass sich der anspruchsbegründende Sachverhalt zur Zeit der Klageerhebung noch (immer) in der Entwicklung befand. Bei Klageerhebung war erst ein Teil des Schadens entstanden. Die Entstehung weiteren Schadens – nämlich der Umsatzsteuer und des Nutzungsausfallschadens bei Reparatur des Fahrzeuges – war nach dem Vorbringen der Klägerseite hier immer noch zu erwarten. In einer derartigen Fallgestaltung ist die Feststellungsklage nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber zulässig.
Es besteht nämlich keine allgemeine Subsidiarität der Feststellungsklage gegenüber der Leistungsklage. Vielmehr ist eine Feststellungsklage trotz der Möglichkeit, Leistungsklage zu erheben, zulässig, wenn die Durchführung des Feststellungsverfahrens unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit zu einer sinnvollen und sachgemäßen Erledigung der aufgetretenen Streitpunkte führt (BGH, Beschluss vom 01.12.2022, Az.: VII ZR 278/20, u.a. in: BeckRS 2022, Nr. 42610; BGH, Urteil vom 02.06.2022, Az.: VII ZR 340/20, u.a. in: BeckRS 2022, Nr. 16872; BGH, Urteil vom 05.10.2021, Az.: VI ZR 136/20, u.a. in: NJW-RR 2022, Seiten 23 f.; BGH, Beschluss vom 06.03.2012, Az.: VI ZR 167/11, u.a. in: r + s 2012, Seiten 461 f.; BGH, Urteil vom 08.07.2003, Az.: VI ZR 304/02, u.a. in: NJW 2003, Seiten 2827 f.; BGH, Urteil vom 28.09.1999, Az.: VI ZR 195/98, u.a. in: NJW 1999, Seiten 3774 f.; BGH, Urteil vom 21.02.1991, Az.: III ZR 204/89, u.a. in: VersR 1991, Seite 788).
Wenn eine Schadensentwicklung noch nicht abgeschlossen, ein Teil des Schadens bei Klageerhebung also schon entstanden, die Entstehung weiterer Schäden aber noch zu erwarten ist, kann der Kläger in vollem Umfang Feststellung der Ersatzpflicht begehren. Der Kläger kann in einem solchen Falle nicht hinsichtlich des bereits entstandenen Schadens auf eine Leistungsklage verwiesen werden. Er ist also nicht gehalten, sein Klagebegehren in einen Leistungs- und einen Feststellungsantrag aufzuspalten. Der Kläger muss dann auch nicht nachträglich seinen Feststellungsantrag in einen Leistungsantrag abändern, wenn dies aufgrund der Schadensentwicklung im Laufe des Rechtsstreits möglich würde, weil sich der Anspruch beziffern ließe (BGH, Beschluss vom 01.12.2022, Az.: VII ZR 278/20, u.a. in: BeckRS 2022, Nr. 42610; BGH, Urteil vom 02.06.2022, Az.: VII ZR 340/20, u.a. in: BeckRS 2022, Nr. 16872; BGH, Urteil vom 05.10.2021, Az.: VI ZR 136/20, u.a. in: NJW-RR 2022, Seiten 23 f.; BGH, Beschluss vom 06.03.2012, Az.: VI ZR 167/11, u.a. in: r + s 2012, Seiten 461 f.; BGH, Urteil vom 08.07.2003, Az.: VI ZR 304/02, u.a. in: NJW 2003, Seiten 2827 f.; BGH, Urteil vom 28.09.1999, Az.: VI ZR 195/98, u.a. in: NJW 1999, Seiten 3774 f.; BGH, Urteil vom 21.02.1991, Az.: III ZR 204/89, u.a. in: VersR 1991, Seite 788).
De hiesige Klägerin war somit vorliegend auch immer (noch) nicht gehalten, ihren Feststellungsantrag zurückzunehmen (BGH, Beschluss vom 01.12.2022, Az.: VII ZR 278/20, u.a. in: BeckRS 2022, Nr. 42610; BGH, Urteil vom 02.06.2022, Az.: VII ZR 340/20, u.a. in: BeckRS 2022, Nr. 16872; BGH, Urteil vom 05.10.2021, Az.: VI ZR 136/20, u.a. in: NJW-RR 2022, Seiten 23 f.; BGH, Beschluss vom 06.03.2012, Az.: VI ZR 167/11, u.a. in: r + s 2012, Seiten 461 f.; BGH, Urteil vom 08.07.2003, Az.: VI ZR 304/02, u.a. in: NJW 2003, Seiten 2827 f.; BGH, Urteil vom 28.09.1999, Az.: VI ZR 195/98, u.a. in: NJW 1999, Seiten 3774 f.; BGH, Urteil vom 21.02.1991, Az.: III ZR 204/89, u.a. in: VersR 1991, Seite 788), selbst wenn sich der Unfall bereits am 21.09.2023 ereignet hat.
Dieser Anspruch wäre nur dann zu verneinen, wenn auch aus der Sicht der geschädigten Klägerin bei verständiger Beurteilung zum Zeitpunkts des Schlusses der mündlichen Verhandlung kein Grund mehr bestehen kann, mit diesen Spätfolgen immer noch zu rechnen (BGH, Urteil vom 15.07.1997, Az.: VI ZR 184/96, u.a. in: NJW 1998, Seiten 160 f.; LG Berlin, Urteil vom 30.01.2019, Az.: 42 O 216/18).
Hier kommt hinzu, dass die Klägerin aufgrund der nicht erfolgten vorprozessualen Zahlung der Beklagtenseite auch nicht verpflichtet war eine Reparatur mit einem Kostenaufwand von 2.618,61 Euro netto bzw. 3.116,15 Euro brutto schon vor einer Zahlung durch die Beklagten gegenüber der Kfz-Werkstatt in Auftrag zu geben.
Dem entsprechend ist hier nunmehr auch durch das erkennende Gericht noch festzustellen gewesen, dass die Beklagten zu 1.) und 2.) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin – entsprechend der oben genannten Quote – 33,33 % aller weiteren materiellen Schäden aufgrund des hier streitgegenständlichen Schadensereignisses vom 21.09.2023 ebenso noch zu ersetzen, soweit sie noch nach dem Schluss der letzten mündlichen Verhandlung ggf. entstehen werden.
Bei dem hier durch die Klägerseite u.a. noch geltend gemachten Zahlungsanspruch gegenüber der Beklagtenseite bezüglich der vorprozessualen/außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von insgesamt 280,60 Euro, die nach der Vorbemerkung 3 Abs. 4 Satz 1 des Vergütungsverzeichnisses (Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG) nicht in voller Höhe auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens angerechnet werden, handelte es sich um eine Nebenforderung im Sinne des § 4 ZPO, die bei der Streitwertberechnung unberücksichtigt zu bleiben hat (Steenbuck, MDR 2006, Seiten 423 ff.; Enders, JurBüro 2004, 57, 58; Heinrich, in: Musielak, § 4 ZPO, Rn. 8; Zöller-Herget, Zivilprozessordnung, § 4 ZPO, Rn. 13; Hansens, ZfSch 2007, Seiten 284 f.; BGH, FamRZ 2007, Seiten 808 f.; BGH, NJW 2006, Seiten 2560 f.; BGH, BB 2006, Seite 127; OLG Celle, AGS 2007, Seite 321 = RVGreport 2007, Seite 157; OLG Frankfurt/Main, RVGreport 2006, Seiten 156 f. ; OLG Oldenburg, NdsRpfl. 2006, Seite 132; OLG Celle, OLG-Report 2006, Seite 630; OLG Köln, RVG-Report 2005, Seite 76; LG Berlin, MDR 2005, Seite 1318; AG Hamburg, Urteil vom 18.09.2006, Az.: 644 C 188/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Dies entspricht der ständigen herrschenden Rechtsprechung. Nach § 4 Abs. 1 ZPO, § 43 Abs. 1 GKG und § 23 Abs. 1 Satz 1 RVG bleiben Früchte, Nutzungen, Zinsen und Kosten bei der Wertberechnung nämlich unberücksichtigt, wenn sie als Nebenforderungen geltend gemacht werden. Wie bei Zinsen besteht auch bezüglich der Kosten das Wesen einer Nebenforderung darin, dass sie vom Bestehen einer Hauptforderung abhängig ist. Einem allgemeinen Grundsatz entsprechend sind die Kosten des laufenden Prozesses bei der Wertbemessung nicht zu berücksichtigen, solange die Hauptsache Gegenstand des Rechtsstreits ist (§ 4 ZPO; BGH, BGHZ Band 128, Seiten 85 ff.).
Zu den Prozesskosten rechnen aber nicht nur die durch die Einleitung und Führung eines Prozesses ausgelösten Kosten, sondern grundsätzlich auch diejenigen Kosten, die der Vorbereitung eines konkret bevorstehenden Rechtsstreits dienen (BGH, NJW-RR 2006, Seite 501). Soweit derartige Kosten nicht im Kostenfestsetzungsverfahren nach den §§ 103, 104 ZPO, § 11 Abs. 1 Satz 1 RVG – wie hier – festgesetzt werden können (BGH, NJW 2006, Seite 2560), können sie auf der Grundlage eines materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs Gegenstand einer unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzbedürfnisses zulässigen Klage auf Erstattung dieser Kosten sein.
Anspruchsvoraussetzung des materiell-rechtlichen Kostenersatzbegehrens ist das Bestehen einer sachlich-rechtlichen Anspruchsgrundlage, nämlich dass der Schuldner wegen einer Vertragsverletzung, Verzugs oder sonstigen Rechtsverletzung für den adäquat verursachten Schaden einzustehen hat. Wird der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch neben der Hauptforderung, aus der er sich herleitet, geltend gemacht, ist er von dem Bestehen der Hauptforderung abhängig, so dass es sich bei den zur Durchsetzung eines Anspruchs vorprozessual aufgewendeten und unter dem Gesichtspunkt des materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch geltend gemachten Geschäftsgebühren um Nebenforderungen im Sinne von § 4 ZPO handelt, solange die Hauptsache Gegenstand des Rechtsstreits ist. Die geltend gemachten Beträge wirken deshalb nicht werterhöhend, solange das Abhängigkeitsverhältnis zur Hauptforderung besteht. Durch das Inkrafttreten des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes hat sich daran nichts geändert, da die einschlägigen Wertvorschriften inhaltlich unverändert geblieben sind.
Diese Berechnung gilt unabhängig davon, ob die Kosten der Hauptforderung hinzugerechnet werden oder neben der im Klagewege geltend gemachten Hauptforderung Gegenstand eines eigenen Antrags sind (BGH, NJW-RR 1995, Seiten 706 f.; BGH, NJW 1998, Seiten 2060 f.; BGH, FamRZ 2007, Seiten 808 f.). Dass es sich bei der Gebührenforderung um eine getrennt von der Hauptsache zu berechnende Forderung handelt, hat auf ihren Charakter als Nebenforderung im Sinne von § 4 ZPO somit keinen Einfluss, weil sie als Kosten von der eingeklagten Hauptsache und deren „Schicksal“ abhängig sind. Ein Anspruch auf Erstattung der anteiligen Geschäftsgebühr – ob aus § 249 BGB oder Verzug – ergibt sich somit nur dann, wenn die Klägerseite überhaupt in der Hauptsache obsiegt (BGH, FamRZ 2007, Seiten 808 f.; OLG Celle, Beschluss vom 06.02.2007, Az.: 14 W 76/06; Tomson, NJW 2007, Seiten 267 f.).
Rechtsanwaltskosten, die für die außergerichtliche Geltendmachung neben dem Hauptanspruch eingeklagt werden, sind dementsprechend als Nebenforderungen streitwertmäßig nicht zu berücksichtigen, selbst wenn sie betragsmäßig ausgerechnet und dem Hauptanspruch zugeschlagen werden (BGH, FamRZ 2007, Seiten 808 f.; OLG Frankfurt/Main, AGS 2006, Seite 251). Das Wesen dieser Nebenforderung besteht nämlich darin, dass sie von dem Bestehen der Hauptforderung abhängig war (BGH, FamRZ 2007, Seiten 808 f.; BGH, BGHZ Band 26, Seite 174; BGH, NJW 1962, Seite 2252; BGH, WM 1981, Seite 1092; OLG Hamburg, JurBüro 1969, Seite 556; OLG Düsseldorf, JurBüro 1981, Seite 920; OLG Frankfurt/Main, JurBüro 1978, Seite 590; OLG Karlsruhe, JurBüro 1988, Seite 1723; LG Wuppertal, AnwBl. 1978, Seite 108; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Für diese außergerichtliche Vertretung in einer zivilrechtlichen Angelegenheit steht dem Rechtsanwalt nach Nr. 2400 VV RVG in Verbindung mit §§ 13, 14 RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe von 0,5 bis 2,5 des Gebührensatzes zu, wobei die Regelgebühr 1,3 beträgt (BGH, GRUR 2014, Seiten 206 ff. = MDR 2014, Seiten 184 f.; BGH, NJW-RR 2013, Seiten 1020 f.; BGH, NJW 2012, Seiten 2813 f.; BGH, NJW 2011, Seite 1603; BGH, NJW-RR 2007, Seiten 420 ff.; OLG München, DAR 2006, Seite 718; LG Potsdam, Urteil vom 05.07.2017, Az.: 7 S 146/16; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 01.06.2006, Az.: 31 C 333/05, u.a. in: DAR 2006, Seiten 597 ff. = beck-online, LSK 2007, Nr.: 170311 mit vielen weiteren Rechtsprechungshinweisen).
Gemäß Anlage 1 Teil 3, Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG ist die Gebühr nach Nr. 2400 ist die Gebühr aber nur zur Hälfte, höchstens mit einem Gebührensatz von 0,75, auf die wegen desselben Gegenstandes angefallene Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens anzurechnen (BGH, Urteil vom 11.07.2007, Az.: VIII ZR 310/06, u.a. in: WuM 2007, Seiten 633 f.; BGH, NJW 2007, Seiten 2049 ff. = WuM 2007, Seiten 330 ff.; LG Potsdam, Urteil vom 05.07.2017, Az.: 7 S 146/16). Insofern handelt es sich hierbei um die hälftige Geschäftsgebühr für die vorgerichtlichen Beitreibungsbemühungen der Prozessbevollmächtigten der Klägerseite und die Auslagenpauschale nach VV 7002 (20 % einer Gebühr).
Das angefallene Anwaltshonorar für die vorprozessuale Tätigkeit der Prozessbevollmächtigten der Klägerseite ist hier auch auf die in dem vorliegenden Rechtsstreit dann entstandene Verfahrensgebühr mit anzurechnen. Anzurechnen ist das Honorar für die vorprozessuale Tätigkeit nach dieser Regelung nämlich dann, wenn es „wegen desselben Gegenstandes“ angefallen ist. Auch ist die Geschäftsgebühr dann nicht zur Hälfte auf die Verfahrensgebühr eines gerichtlichen Verfahrens anzurechnen, wenn mit der Klage nicht mehr die ursprüngliche Hauptforderung sondern nur noch die Zinsen und außergerichtlichen Kosten verfolgt werden (AG Duisburg, JurBüro 2006, Seiten 420 ff.). Die vorprozessuale Tätigkeit der Prozessbevollmächtigten der Kläger und die nunmehr anschließende Klage betreffen insofern aber hier „denselben“ Gegenstand in diesem Sinne (BGH, WuM 2007, Seiten 633 f. = Grundeigentum 2007, Seiten 1480 f.; BayVerwGH, JurBüro 2005, Seiten 642 f.; LG Potsdam, Urteil vom 05.07.2017, Az.: 7 S 146/16; LG Bonn, NJW 2006, Seiten 2640 ff.; LG Duisburg, RVGreport 2005, Seiten 308 f.; LG Mönchengladbach, NZM 2006, Seiten 174 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Anders könnte ggf. somit der Fall grundsätzlich nur dann liegen, wenn die bei einer vorprozessuale Tätigkeit anfallende Verfahrensgebühr nicht auf die Klage angerechnet wird, weil sie nicht „denselben Gegenstand“ im Sinne dieser Vorschrift betrifft (vgl. hierzu u.a. folgende Entscheidungen: LG Bonn, NJW 2006, Seiten 2640 ff.; LG Mönchengladbach, ZMR 2005, Seite 957 = NJW 2006, Seiten 705 f. = NZM 2006, Seiten 174 f. = MDR 2006, Seite 598; AG Lübeck, Urteil vom 27.09.2006, Az.: 31 C 2023/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Die in Anlage 1, Teil 2, Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG angeordnete Anrechnung der Geschäftsgebühr bewirkt aber nicht eine entsprechende Reduzierung dieser Gebühr. Ist somit nach der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Nr. 3100 VV RVG eine wegen desselben Gegenstands entstandene Geschäftsgebühr anteilig auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens anzurechnen, so vermindert sich nicht die bereits entstandene Geschäftsgebühr, sondern die in dem anschließenden gerichtlichen Verfahren anfallende Verfahrensgebühr. Nach dem eindeutigen Wortlaut dieser Bestimmung erfolgt die Anrechnung nämlich auf die Verfahrensgebühr des nachfolgenden gerichtlichen Verfahrens, so dass sich die letztgenannte Gebühr, nicht dagegen die Geschäftsgebühr, im Umfang der Anrechnung reduziert (BGH, WuM 2007, Seiten 633 f. = Grundeigentum 2007, Seiten 1480 f.; BGH, NJW 2007, Seiten 2049 f. = WuM 2007, Seiten 329 f.; BGH, NJW 2007, Seiten 2050 f. = WuM 2007, Seiten 330 ff.; OVG Münster, NJW 2006, Seiten 1991 f.; LG Baden-Baden, JurBüro 2007, Seiten 205 f.; AG Nürtingen, JurBüro 2007, Seite 206; N. Schneider, NJW 2007, Seiten 2001 ff.). Die nunmehr herrschende Rechtsprechung hat insofern folgende (wohl) zutreffende Schlussfolgerungen gezogen:
3. Auch bei nachfolgender gerichtlicher Tätigkeit des zuvor außergerichtlich tätig gewesenen Prozessbevollmächtigten der Klägerseite besteht der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch der Klägerseite trotz der Gebührenanrechnung in Vorbemerkungen 3 Abs. 4 VV RVG in Höhe der vollen Geschäftsgebühr nebst Auslagen.
4. Wird der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch im gerichtlichen Verfahren geltend gemacht, ist somit die volle – und nicht nur die halbe – Geschäftsgebühr einzuklagen.
Wird diesem Anspruch stattgegeben und obsiegt die Klägerseite auch im Kostenpunkt, kann sie im Kostenfestsetzungsverfahren die für die gerichtliche Tätigkeit ihres Prozessbevollmächtigten angefallenen Gebühren und Auslagen erstattet verlangen (§ 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO). An sich ist der Umstand, dass der Prozessbevollmächtigte auch vorgerichtlich tätig gewesen ist, im Kostenfestsetzungsverfahren zwar nicht zu berücksichtigen, so dass grundsätzlich die unverminderte Verfahrensgebühr festzusetzen ist (so: KG Berlin, AGS 2005, Seite 515 = RVGreport 2005, Seite 392; OLG Hamm, RVGreport 2005, Seite 433; OVG Nordrhein-Westfalen, RVGreport 2006, Seite 311).
Dies gilt ausnahmsweise dann aber nicht, wenn in demselben Rechtsstreit der auf materiellem Recht bestehende Anspruch auf Erstattung der vollen Geschäftsgebühr bereits im Urteil tituliert worden ist. In einem solchen Fall würde nämlich der Kläger hinsichtlich eines Teils des Vergütungsanspruchs (Anrechnungsbetrag der Geschäftsgebühr ggf. nebst anteiliger Postentgeltpauschale und Umsatzsteuer) im Kostenfestsetzungsverfahren tituliert erhalten, obwohl er seinem Rechtsanwalt insoweit einen Vergütungsanspruch wegen der Anrechnungsbestimmung in Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG nicht schuldet. In diesem Ausnahmefall ist deshalb im Kostenfestsetzungsverfahren lediglich die um den Anrechnungsbetrag verminderte Verfahrensgebühr geltend zu machen. Diese Anrechnung ist somit hier erst im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens zu berücksichtigen (BGH, WuM 2007, Seiten 329 f. = AGS 2007, Seiten 283 f.; BGH, WuM 2007, Seiten 330 ff. = AGS 2007, Seiten 289 ff.; LG Baden-Baden, JurBüro 2007, Seiten 205 f.; AG Nürtingen, JurBüro 2007, Seite 206; Heinz Hansens, ZfSch 2007, Seiten 344 und RVGreport 2007, Seiten 121 ff.; Norbert Schneider, NJW 2007, Seiten 201 ff.; Hans-Jochem Mayer, RVG-Letter 2007, Seite 53).
Für die Frage der Erforderlichkeit der Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts kommt es aber zunächst immer darauf an, wie sich die voraussichtliche Abwicklung des Falles aus der Sicht des Gläubigers darstellt (BGH, BGHZ Band 127, Seiten 348 ff.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom: 09.02.2006, Az.: 6 U 94/05; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.). Ist die Verantwortlichkeit des Gegners derart klar, dass aus der Sicht des Gläubigers kein vernünftiger Zweifel daran bestehen kann, dass dieser ohne weiteres seiner Verpflichtung nachkommen werde, ist es grundsätzlich schon nicht erforderlich, für die Abmahnung einen Rechtsanwalt hinzuziehen (BGH, NJW 2005, Seite 1112; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom: 09.02.2006, Az.: 6 U 94/05, u.a. in: ITRB 2006, Seite 198).
In der Regel liegt die Annahme, der Schuldner werde ohne weiteres seiner Pflicht nachkommen, um so näher, je einfacher und rechtlich klarer der Sachverhalt gelagert ist, mit der Folge, dass die Heranziehung eines Rechtsanwalts in so einfach gelagerten Fällen in der Regel zu verneinen sein wird (BGH, WRP 2004, Seiten 903 f.; OLG Frankfurt/Main, Urteil vom: 09.02.2006, Az.: 6 U 94/05, teilw. veröffentlicht in: ITRB 2006, Seite 198; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Für den Erstattungsanspruch ist darüber hinaus maßgeblich, inwieweit sich die Tätigkeit der Rechtsanwälte auf die Geltendmachung und Durchsetzung tatsächlich bestehender Forderungen bezog; denn dem Schuldner sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass der Gläubiger seine Rechtsanwälte mit der Durchsetzung eines unbegründeten Anspruchs beauftragt, ebenso nicht zuzurechnen (BGH, NJW 2005, Seite 1112; OLG Saarbrücken, OLG-Report 2004, Seite 530; OLG Saarbrücken, NJW-RR 2007, Seiten 112 ff. = OLG-Report 2006, Seiten 992 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Von der Einholung eines Gutachtens des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer sieht das Gericht hier ab, da § 14 II Satz 1 RVG, der die Einholung eines solchen Gutachtens im Rechtsstreit anordnet, nur für den Honorarstreit zwischen dem Anwalt und seinem Mandanten gilt (BGH, BGHZ Band 77, Seite 250 = NJW 1980, Seite 1962; OLG Saarbrücken, NJW-RR 2007, Seiten 112 ff. = OLG-Report 2006, Seiten 992 f.).
Der Klägerseite steht hier insofern ein Anspruch auf Erstattung von außergerichtlichen Kosten in o.g. Höhe zu, weil auch dem Prozessbevollmächtigten der Klägerseite ein entsprechender Anspruch gegen die Klägerseite in dieser Höhe zusteht. Das vorprozessuale Schreiben des Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 15.03.2024 diente nämlich noch nicht der Vorbereitung der Klage vom 13.05.2024 und gehörte deshalb gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 RVG auch noch nicht zu diesem Rechtszug (BGH, Beschluss vom 10.07.2012, Az.: VI ZB 7/12; BGH, NJW 2006, Seiten 1523 ff.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.06.2011, Az.: 12 U 156/10; OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; LG Berlin, Urteil vom 08.03.2007, Az.: 21 O 332/06, u. a. in: „juris“; LG Dortmund, JurBüro 2012, Seiten 151 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.; Gerold/Schmidt/v. Eicken, RVG, § 19 RVG Rn. 10; Gerold/Schmidt/Madert, RVG VV 2400-2403 Rn. 19-22; Bischoff/Jungbauer/Podlech-Trappmann, § 19 RVG Rn. 17; Mayer/Kroiß, § 19 RVG Rn. 7; Hartmann, KostG, RVG VV 3100 Rn. 32).
Das erkennende Gericht teilt insofern zwar die in der Rechtsprechung vertretene Auffassung, dass der Zweck dieser Anrechnungsvorschrift darin besteht, die doppelte Honorierung für die gleiche oder doch annähernd gleiche Tätigkeit zu verhindern, wenn die Angelegenheit zunächst als außergerichtliche und später als gerichtliche betrieben wird (OLG Schleswig, Entscheidung vom 23.07.2008, Az.: 9 U 53/07; VGH Kassel, NJW 2006, Seite 1992; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; so auch Gerold/Schmidt/v. Eiken/Madert/Müller-Raabe, RVG, VV 2400-2403 Rn. 183). Dieser Gedanke greift hier aber nicht durch.
Vorzugswürdig ist insoweit hier nämlich die Rechtsauffassung, die danach differenziert, ob der Rechtsanwalt zunächst nur mit der außergerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche beauftragt und der Prozessauftrag allenfalls bedingt erteilt worden ist oder ob ein unbedingter Klageauftrag erteilt worden ist (BGH, NJW 2006, Seiten 1523 ff. = Rpfleger 2006, Seiten 436 f. = DAR 2006, Seiten 418 f.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.06.2011, Az.: 12 U 156/10; OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; OLG Koblenz, JurBüro 2006, Seiten 191 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.; Göttlich/Mümmler/Rehberg/Xanke, RVG, Gerold/Schmidt/v.Eicken, § 19 RVG Rn. 10; zur entsprechenden Abgrenzung von § 118 BRAGO von §§ 31 Abs. 1 Nr. 1, 32, 37 Nr. 1 BRAGO; ebenso: BGH, NJW 1968, Seiten 52 f.; BGH, NJW 1968, Seite 2334).
Maßgeblich für den Anfall einer Gebühr ist dabei der dem Rechtsanwalt vom Mandanten erteilte Auftrag (BGH, NJW 1983, Seite 2451). Insoweit ist aber erheblich, ob die Klägerseite ihre Prozessbevollmächtigten auf Basis eines bedingten Klageauftrages umfassend mit der Beitreibung der gegen die beklagte Partei bestehenden Forderung beauftragte. Nur hierin liegt nämlich ein unbedingter Auftrag zu einer Angelegenheit nach Nr. 2300 VV RVG und – aufschiebend bedingt – ein Klageauftrag (Madert, in: Gerold/Schmidt/v.Eicken/Madert/Müller-Rabe, RVG-Kommentar, VV 2300 bis 2303, Rn. 23). Die Abgrenzung hat somit danach zu erfolgen, ob der Anwalt bereits einen (unbedingten) Klageauftrag erhalten hat oder nicht (BGH, NJW-RR 2007, Seite 720; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.06.2011, Az.: 12 U 156/10; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06).
Die Beauftragung eines Rechtsanwalts dient aber nicht zwingend der Vorbereitung eines Prozesses (BGH, BB 2006, Seite 127; AG Hamburg, Urteil vom 18.09.2006, Az.: 644 C 188/06). Nur wenn somit der Rechtsanwalt bereits einen Prozessauftrag erhalten hat, ist für die Entstehung der Gebühren gemäß Nr. 2300 RVG VV n. F. dann auch kein Raum mehr (BGH, NJW 2006, Seiten 1523 ff. = Rpfleger 2006, Seiten 436 f. = DAR 2006, Seiten 418 f.; OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.; Gerold/Schmidt/v. Eicken, § 19 RVG, Rn. 10). Gerade wenn es um rechtliche Fragestellungen geht, die zu erörtern sind, erfolgt die Beauftragung eines Rechtsanwalts nämlich mit der Abwicklung der Sache regelmäßig (noch) nicht zu dem Zweck, bereits einen Rechtsstreit zu führen. Vielmehr soll durch die Beauftragung häufig ein Rechtsstreit gerade vermieden werden. Jedenfalls kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beauftragung eines Rechtsanwalts immer der Vorbereitung eines konkret bevorstehenden Rechtsstreits dient (vgl. zu diesem Merkmal: BGH, WM 1987, Seiten 247 f.; AG Hamburg, Urteil vom 18.09.2006, Az.: 644 C 188/06; Stein/Jonas/Bork, ZPO, § 91 ZPO, Rn. 39).
Hat der Anwalt andererseits aber bereits einen unbedingten Klageauftrag erhalten, kann aber auch eine Terminsgebühr selbst dann entstehen, wenn der Rechtsstreit oder das Verfahren noch nicht anhängig ist (BGH, AGS 2007, Seiten 166 f. = FamRZ 2007, Seiten 721 f.).
Der gebührenrechtliche Rechtszug i.S. des § 19 RVG stimmt mit dem prozessualen Rechtszug nämlich nicht überein (OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.; Gerold/Schmidt/v. Eicken, § 19 RVG, Rn. 2; Bischoff/Jungbauer/Podlech-Trappmann, § 19 RVG, Rn. 11). Der Gebührenrechtszug beginnt insoweit bereits mit dem Auftrag gemäß § 15 Abs. 1 RVG, also schon vor der Inanspruchnahme des Gerichts; die Gebühren entgelten, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, aber die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts vom Auftrag bis zur Erledigung der Angelegenheit. Der Rechtsanwalt kann die Gebühren in derselben Angelegenheit somit nur einmal fordern (BGH, NJW 2006, Seiten 1523 ff. = Rpfleger 2006, Seiten 436 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023 f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.).
Diese Geschäftsgebühr fällt damit nur dann an, wenn der Gläubiger den Rechtsanwalt zunächst allein mit der außer-gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs beauftragt hat (Steenbuck, MDR 2006, Seiten 423 ff. mit weiteren Nachweisen). Ein unbedingtes Mandat, im gerichtlichen Verfahren tätig zu werden, lässt somit keinen Platz für das Entstehen einer Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 RVG VV, auch wenn der Anwalt zunächst nur außergerichtlich tätig wird (BGH, Urteil vom 15.08.2019, Az.: III ZR 205/17, u.a. in: NJW-RR 2019, Seite 1332; BGH, Urteil vom 26.02.2013, Az.: XI ZR 345/10).
Nur wenn ein Rechtsanwalt zunächst einen unbedingten Auftrag erhält und erst danach dann einen unbedingten Auftrag für die Hauptsache, so liegen dementsprechend auch erst dann zwei Angelegenheiten vor (OLG München, OLG-Report 2006, Seiten 494 f. = AGS 2006, Seiten 345 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.).
Bezüglich der Frage, ob sich der Rechtsanwalt insoweit nur einen bedingten oder einen unbedingten Klageauftrag erteilen lässt, ist im Übrigen zu berücksichtigen, dass der Rechtsanwalt die Erfolgsaussichten der Durchsetzung eines Anspruchs prüfen und insofern den sichersten Weg wählen muss (OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; OLG Karlsruhe, Justiz 1989, Seiten 21 f; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2010, Seiten 2023f.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Seiten 3254 ff.; Grüneberg/Grüneberg, § 280 BGB, Rn. 70 ff.). Die Pflicht zur interessengemäßen Beratung eines Mandanten bei der Auftragserteilung gebietet es dem Anwalt somit, sich grundsätzlich nur dann einen bedingten Auftrag vom Mandanten erteilen zu lassen, wenn er unter Würdigung aller Umstände Grund zu der Annahme hat, dass eine Klageerhebung nicht erforderlich sein werde, was eine umfassende Würdigung aller Umstände des Einzelfalls erfordert (BGH, NJW 1968, Seite 2334; OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; OLG Karlsruhe, Justiz 1989, Seiten 21 f; OLG Brandenburg, Beschluss vom 15.08.2002, Az.: Verg W 10/01).
Es muss insofern zu erwarten sein, dass der Versuch einer außergerichtlichen Regulierung mit Hilfe eines Anwalts Aussicht auf Erfolg bietet (OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; OLG Karlsruhe, Justiz 1989, Seiten 21 f; Gerold/Schmidt/Madert, RVG VV 2400-2403 Rn. 20-22). Gegebenenfalls ist es dementsprechend sogar erforderlich, die (eingeschränkten) Erfolgsaussichten des Versuchs einer außergerichtlichen Streitbeilegung mit dem Mandanten unter Hinweis auf die möglicherweise anfallenden zusätzlichen Kosten vorab zu erörtern (zur grundsätzlichen Verpflichtung zu einem Bedenkenhinweis und zum Aufzeigen des richtigen Wegs: BGH, NJW 1985, Seite 42; Grüneberg/Grüneberg, § 280 BGB, Rn. 70 ff.). Diese Auffassung steht im Einklang mit der sehr umfangreichen Rechtsprechung bezüglich der Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten (vgl. dazu u.a.: OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.; Grüneberg/Grüneberg, § 286 BGB, Rn. 46).
Die ganz herrschende Meinung in der Rechtsprechung (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f. = NZBau 2006, Seiten 516 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff. und die Nachw. bei: Grüneberg/Grüneberg, § 286 BGB, Rn. 46) verneint aber eine Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten grundsätzlich bereits dann, wenn der Gegner erkennbar unwillig ist und daher voraussehbar ist, dass später ohnehin ein Rechtsanwalt mit einer Klageerhebung beauftragt werden muss und bei dem Abmahnschreiben etc. pp. sowieso der Vorbereitung des Rechtsstreits gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 RVG dienen und somit auch keine zusätzlichen Kosten verursachen. Das erkennende Gericht bejaht in Übereinstimmung mit dem OLG Brandenburg (Beschluss vom 15.08.2002, Az.: Verg W 10/01) und dem OLG Hamm (NJW-RR 2006, Seiten 242 f. = NZBau 2006, Seiten 516 f.) sowie dem LG Potsdam (Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06) und Grüneberg (in: Grüneberg, § 286 BGB, Rn. 46) die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten unter Berücksichtigung der Obersätze des RVG dementsprechend nämlich auch nur dann, wenn die Klägerseite aus besonderen Gründen darauf vertrauen durfte, dass die Beklagtenseite ohne gerichtliche Hilfe den Anspruch anerkennen wird, weil das Verhalten der Klägerseite in diesem Fall demjenigen eines wirtschaftlich vernünftig Denkenden entspricht, der sich selbst vor Schaden bewahren will. Es ist nämlich nicht ersichtlich, dass durch die Neuregelung der Nr. 2300 RVG VV eine Änderung dieser herrschenden Rechtsprechung bezweckt werden sollte.
Insofern hat ein Gegner nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch nur jene Rechtsanwaltskosten zu ersetzen, die aus der Sicht des Klägers zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren (BGH, Urteil vom 26.02.2013, Az.: XI ZR 345/10; BGH, Urteil vom 10.01.2006, Az.: VI ZR 43/05; BGH, Urteil vom 23.10.2003, Az.: IX ZR 249/02). Ist der Schuldner bekanntermaßen zahlungsunwillig und erscheint der Versuch einer außergerichtlichen Forderungsdurchsetzung auch nicht aus sonstigen Gründen erfolgversprechend, sind die dadurch verursachten Kosten somit auch nicht zweckmäßig (BGH, Urteil vom 26.02.2013, Az.: XI ZR 345/10; OLG Celle, JurBüro 2008, 319; OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; OLG München, WM 2010, 1622, Seite 1623).
Wenn ein späterer Kläger dementsprechend einen Rechtsanwalt beauftragt, den späteren Beklagten zunächst außergerichtlich anzuschreiben, kann der Kläger die hierdurch entstehenden Kosten (insbesondere die anwaltliche Geschäftsgebühr) auch nur dann vom Beklagten ersetzt verlangen, wenn er bereits bei der Mandatserteilung aufgrund konkreter Umstände davon ausgehen durfte, der von ihm geltend gemachte Anspruch werde außergerichtlich von der nunmehrigen Beklagtenseite vorprozessual anerkannt (BGH, Urteil vom 26.02.2013, Az.: XI ZR 345/10; OLG Celle, JurBüro 2008, 319; OLG Hamm, NJW-RR 2006, Seiten 242 f.; OLG München, WM 2010, 1622, Seite 1623; AG Geldern, JurBüro 2005, Seiten 363 f.; LG Potsdam, Urteil vom 04.06.2007, Az.: 7 S 174/06; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Der Rechtsanwalt der Klägerseite war somit auch hier verpflichtet, für das von der (nunmehrigen) Klägerseite erstrebte Ziel den kostengünstigsten Weg zu wählen. Neben den allgemeinen Hinweisen über die anfallenden Gebühren ist der Rechtsanwalt insoweit dann aber auch zu dem Hinweis verpflichtet, dass die sofortige Erteilung einer Prozessvollmacht auch beim Versuch einer außergerichtlichen Lösung vor der Klageerhebung zu einem geringeren Gebührenanfall führen würde, wenn die sofortige Erteilung einer Prozessvollmacht dem Interesse des Mandanten (nunmehrigen Klägers) an einer zunächst zu versuchenden außergerichtlichen Regelung nicht zuwider läuft und dadurch auch zwingend geringere Gebühren für ihn anfallen – wie bereits dargelegt -.
Dies ist regelmäßig aber nur dann nicht der Fall, wenn zum Zeitpunkt der Mandatserteilung (noch) davon ausgegangen werden konnte, dass zunächst eine außergerichtliche Einigung mit der späteren Beklagtenseite erzielt werden kann. Nach aller Voraussicht entstehen in einem solchen Fall bei der Beauftragung mit der außergerichtlichen Interessenvertretung nämlich geringere Gebühren, als bei sofortiger Erteilung eines Prozessauftrags. Wünscht der Mandant nach einer umfassenden Aufklärung über die voraussichtlich anfallenden Gebühren dann zunächst nur eine außergerichtliche Interessenvertretung, verstößt der Rechtsanwalt dann auch nicht gegen die ihm obliegende Schadensminderungspflicht, auch wenn der Rechtsanwalt nach Sinn und Zweck des neuen RVG gehalten, zunächst in der Regel eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen (AG Essen-Steele, JurBüro 2005, Seiten 585 ff. = Recht und Schaden 2006, Seiten 70 ff.; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.). Mangels abweichenden Vortrages kann das Gericht insofern ggf. auch davon ausgehen, dass die Klägerseite ihren Prozessbevollmächtigten von Anfang an beauftragt hat, ihr Begehren notfalls auch gerichtlich zu verfolgen, so dass die von dem Prozessbevollmächtigten vorprozessual abgefassten Schreiben nur als Vorbereitung der Klage gemäß § 19 Abs. 1 RVG zu werten wären (OLG Schleswig, Entscheidung vom 23.07.2008, Az.: 9 U 53/07; Feldmann, r + s 2016, Seiten 546 ff.).
Die Klägerseite hat hier aber schlüssig dargetan, ihren Prozessbevollmächtigten zunächst lediglich mit seiner außergerichtlichen Vertretung beauftragt oder ihm einen nur bedingten Prozessauftrag erteilt zu haben.
Im Übrigen kann aus der nach außen hin erkennbaren Tätigkeit eines Rechtsanwalts nicht ohne Weiteres darauf geschlossen werden, ob der Rechtsanwalt diese Tätigkeit im Rahmen eines ihm bereits erteilten – zumal unbedingten – Klageauftrags ausgeübt hat oder ob dem Anwalt im maßgeblichen Innenverhältnis bislang tatsächlich (lediglich) ein Vertretungsauftrag erteilt worden ist.
Unter Berücksichtigung dieser allgemeinen Rechtsgrundsätze hat die Klägerseite hier aber unstreitig zumindest schlüssig vorgetragen, dass
4. die Klägerin ihren nunmehrigen Prozessbevollmächtigten in der hier gegebenen Sache zum Zeitpunkt der Mandatserteilung nur einen bedingten Auftrag erteilt hat,
5. zum Zeitpunkt der Mandatserteilung die Klägerin (noch) davon ausgehen konnte, dass zunächst eine außergerichtliche Einigung mit der späteren Beklagtenseite erzielt werden kann
und auch,
6. dass die Klägerin nach einer umfassenden Aufklärung über die voraussichtlich anfallenden Gebühren dann zunächst nur eine außergerichtliche Interessenvertretung gewünscht hat,
so dass die Klägerseite hier nunmehr auch grundsätzlich eine Zahlung dieser außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten bzw. die Freistellung von diesen Kosten von der Beklagtenseite begehren kann.
Diese Rechtsanwaltskosten wurden somit hier berechtigterweise als Nebenforderung von der Klägerseite geltend gemacht. Der Klägerseite steht daher gegenüber der Beklagtenseite hier ein Anspruch auf Bezahlung bzw. Freistellung von der Kostenliquidation ihrer Rechtsanwälte auch für einen Geschäftswert von 1.051,13 Euro (881,20 € bezüglich des berechtigten Zahlungsantrags + 169,93 € hinsichtlich der begehrten Feststellung von 33,33 %) zu.
Zwar ist richtig, dass ein Honoraranspruch des Anwalts gemäß § 10 RVG erst dann einforderbar ist, wenn der Anwalt dem Mandanten eine Gebührenrechnung erteilt hat. Bei Honorarforderungen des Rechtsanwaltes setzt die Durchsetzbarkeit der Forderung nach § 10 Abs. 1 RVG nämlich eine von dem Anwalt unterzeichnete und dem Auftraggeber mitgeteilte Rechnung voraus. Voraussetzung für einen Zahlungs-Anspruch ist somit grundsätzlich nur, dass der Geschädigte im Innenverhältnis zur Zahlung der in Rechnung gestellten Rechtsanwaltskosten auch verpflichtet ist. Dies betrifft das Innenverhältnis zum Mandanten. Denn die Rechnungsstellung nach § 10 Abs. 1 RVG betrifft (nur) die Einforderbarkeit der Vergütung im Verhältnis zum Mandanten des Anwalts. Der § 10 Abs. 1 RVG gilt hingegen nicht im Bereich des materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs. Dem Gebührenanspruch fehlt insoweit auch nicht die Bestimmbarkeit der Höhe des Gebührenanspruchs. Denn jedenfalls unter den Umständen des Streitfalls, in welchem der mit der zu Grunde liegenden Angelegenheit beauftragte Rechtsanwalt den materiell-rechtlichen Gebührenanspruch für seinen Mandanten einklagt, hat er in der von ihm selbst verfassten Klageschrift von seinem Bestimmungsrecht im Sinne des § 14 RVG hinreichend Gebrauch gemacht (BGH, Urteil vom 24.09.2014, Az.: IV ZR 422/13, u.a. in: NJW-RR 2015, Seiten 189 ff.; BGH, Urteil vom 22.03.2011, Az.: VI ZR 63/10, u.a. in: NJW 2011, Seiten 2509 f.; BGH, Urteil vom 27.07.2010, Az.: VI ZR 261/09; BGH, Urteil vom 26.05.2009, Az.: VI ZR 174/08; BGH, Urteil vom 04.12.2007, Az.: VI ZR 277/06; OLG München, Urteil vom 23.05.2014, Az.: 10 U 5007/13, u.a. in: AGS 2014, Seiten 591 ff.; LG Kleve, Urteil vom 11.11.2009, Az.: 5 S 88/09; LG Bochum, Urteil vom 22.04.2009, Az.: 9 S 183/08; AG Köln, Urteil vom 10.12.2012, Az.: 142 C 348/12; AG Hamburg, Urteil vom 27.06.2011, Az.: 36A C 172/10, u.a. in: ZUM-RD 2011, Seiten 565 ff. = BeckRS 2011, Nr.: 17884).
Dass die Klägerin die Gebührenforderung ihres Rechtsanwalts tatsächlich schon beglichen hat, ist jedoch nicht Voraussetzung für das Vorliegen eines Zahlungsanspruchs. Wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, bestand zwar zunächst nur ein Anspruch auf Befreiung der Klägerin von ihrer Verbindlichkeit gegenüber ihrem Rechtsanwalt gemäß § 257 und § 249 BGB. Dieser Befreiungsanspruch hat sich jedoch gemäß § 250 BGB auch ohne Setzung einer Frist (BGH, Urteil vom 13.01.2004, Az.: XI ZR 355/02, u.a. in: NJW 2004, Seiten 1868 ff.) in einen Zahlungsanspruch verwandelt, da die Beklagtenseite eindeutig zu erkennen gegeben hat, dass sie eine Erfüllung ablehne (OLG Brandenburg, Urteil vom 16.08.2012, Az.: 12 U 176/11; OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2007, Az.: 7 U 93/05, u.a. in: AGS 2008, Seiten 151 f.).
Dies ergibt hier somit für einen Geschäftswert von 1.051,13 Euro folgenden Zahlungsanspruch:
eine 1,3 Geschäftsgebühr 165,10 Euro,
Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV) 20,00 Euro,
Zwischensumme 185,10 Euro,
19,00 % Umsatzsteuer (Nr. 7008 VV) 35,17 Euro,
Endsumme: 220,27 Euro.
In dieser Höhe von 220,27 Euro ist der Klage dementsprechend auch noch stattzugeben; im Übrigen aber insoweit auch abzuweisen.
Im Übrigen erlaubt sich das Gericht noch den Hinweis, dass auch bei einem von der Klägerseite angegebenen Gegenstandswert von 1.990,21 € keine vorprozessualen Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 280,60 €, sondern auch nur in Höhe von 220,27 Euro entstanden wären, da auch insofern die Wertgrenze von 2.000,00 € nicht überschritten worden wäre.
Ob die Beklagten dem entgegen halten könnten, dass der Klägerin ein Schaden insofern nicht entstanden sei, weil ihre Rechtsschutzversicherung (d.h. die …) eine Deckungszusage für die außergerichtliche Rechtsverfolgung erteilte und dann auch die Rechnung ihres Rechtsanwalts bezahlte, kann hier insoweit dahingestellt bleiben. Denn die Versicherungsprämien hat die Klägerin aufgebracht, um für sich vorzusorgen und nicht, um einen Schädiger zu entlasten. Demgemäß ist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Rechtsschutzversicherer die Rechnung des Rechtsanwalts bezahlt hat, die entsprechende Schadensersatzforderung der Klägerin zwar nicht untergegangen, jedoch gemäß § 67 Abs. 1 VVG auf den Rechtsschutzversicherer (d.h. die …) übergegangen (OLG Brandenburg, Urteil vom 25.10.2007, Az.: 12 U 131/06, u.a. in: ZfSch 2008, Seiten 107 f.).
Die Klägerin wäre hier insofern nach dem Anspruchsübergang zwar nicht mehr aktivlegitimiert. Dessen Voraussetzungen stehen aber zur Darlegungs- und Beweislast der Beklagten, so dass zunächst hier weiterhin – bis zum Nachweis der Bezahlung der Rechnung durch den Rechtsschutzversicherer (d.h. die …) – von der Aktivlegitimation der Klägerin hätte ausgegangen werden können (vgl. u.a.: OLG Hamm, Urteil vom 19.06.2008, Az.: 6 U 48/08, u.a. in: NZV 2008, Seiten 521 f.; LG Düsseldorf, Urteil vom 27.02.2008, Az.: 23 S 101/07, u.a. in: „juris“). Selbst wenn die Rechtschutzversicherung der Klägerin die vorgerichtliche Gebührenforderung ihres Prozessbevollmächtigten lediglich in einer bestimmten Höhe wegen des Selbstbehalts ausgeglichen hätte, könnte die Klägerin hinsichtlich des darüber hinaus gehenden Betrages im Übrigen auch noch weiterhin Anspruchsinhaber und damit aktivlegitimiert sein (LG Berlin, Urteil vom 09.12.2009, Az.: 42 O 162/09, u.a. in: „juris“).
Nur am Rande soll zudem darauf hingewiesen werden, dass diese Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG für ein Mahnschreiben – anders als die Verfahrensgebühr – auch nicht zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zählt und somit auch nicht im Kostenfestsetzungsverfahren nach §§ 103, 104 ZPO, § 11 Abs. 1 Satz 1 RVG – quasi nachträglich – berücksichtigt werden kann (BGH, WuM 2007, Seiten 329 f.; BGH, NJW 2006, 2560 f. = DAR 2006, Seiten 478 f. = FamRZ 2006, Seite 1114; BGH, NJW 2006, Seite 1065 = AnwBl. 2006, Seite 357; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Die auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens nach der Vorb. 3 IV der Anlage 1 zu § 2 II RVG nicht anrechenbare Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 RVG VV dieser Anlage für eine Abmahnung zählt somit nicht zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO und kann dementsprechend auch nicht im Kostenfestsetzungsverfahren nach §§ 103, 104 ZPO, § 11 I 1 RVG festgesetzt werden (BGH, WuM 2007, Seiten 329 f.; BGH, NJW-RR 2006, Seiten 501 f. = MDR 2006, Seiten 776 f. = Rpfleger 2006, Seite 165; OLG Frankfurt/Main, NJW 2005, Seite 759 = JurBüro 2005, Seite 202; BayVerwGH, Beschluss vom 10.07.2006, Az.: 4 C 06.1129; LAG Hamburg, AGS 2006, Seite 449) und regelmäßig auch nicht im Kostenfestsetzungsverfahren geltend gemacht werden (OLG Oldenburg, NdsRpfl 2006, Seite 132; BayVerwGH, Beschluss vom 10.07.2006, Az.: 4 C 06.1129; LAG Hamburg, AGS 2006, Seite 449; AG Brandenburg an der Havel, NJOZ 2006, Heft 35, Seiten 3254 ff.).
Die Verurteilung hinsichtlich der Zinsen hat in den § 247, § 286 und § 288 BGB sowie daneben auch in § 291 BGB ihre Grundlage.
Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits stützt sich auf § 91, § 92 und § 100 ZPO.
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 11 und § 711 ZPO.
Der Wert des Streitgegenstandes des Rechtsstreits ist hier zudem noch durch das Gericht auf insgesamt bis zu 2.500,00 € (1.990,21 € bezüglich des Zahlungsantrags + 509,79 €