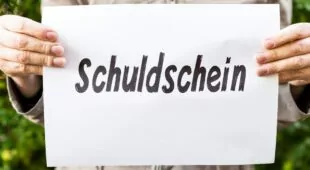Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- OLG Bremen: Anwalt scheitert mit Anträgen auf Urteilsergänzung und -berichtigung bezüglich Zwangsvollstreckung und Tatbestandsfeststellungen
- Der Ausgangspunkt des Rechtsstreits: Streit um Anwaltshonorar und Fremdgelder vor dem OLG Bremen
- Berufungsurteil des OLG Bremen: Anwalt verliert erneut, Zwangsvollstreckung droht nach Zurückweisung der Berufung
- Anwalt beantragt Urteilsergänzung: Zusätzliche Option der Hinterlegung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung nach § 711 ZPO gefordert
- OLG Bremen lehnt Urteilsergänzung ab: §§ 716, 321 ZPO nicht einschlägig für begehrte Änderung der Abwendungsbefugnis
- Anwalt fordert Urteilsberichtigung: Korrektur von angeblichen Tatbestandsfehlern aufgrund eigener unzutreffender Angaben in der Klageschrift
- OLG Bremen weist auch Urteilsberichtigung zurück: § 319 ZPO und § 320 ZPO greifen nicht bei Übernahme parteieigener Fehler
- Fazit: Anträge des Anwalts bleiben erfolglos – Keine Änderung des OLG-Urteils zu Zwangsvollstreckung und Tatbestand
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet „vorläufige Vollstreckbarkeit“ eines Urteils und welche Auswirkungen hat das für Betroffene?
- Welche Möglichkeiten gibt es, eine Zwangsvollstreckung abzuwenden, und was ist der Unterschied zwischen Sicherheitsleistung und Hinterlegung?
- Was ist eine Urteilsergänzung und wann kann man sie beantragen?
- Was bedeutet „Abwendungsbefugnis“ im Zusammenhang mit einer Zwangsvollstreckung?
- Welche Rolle spielt die Zivilprozessordnung (ZPO) bei einer Zwangsvollstreckung und inwiefern schützt sie Schuldner?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 1 U 12/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Bremen
- Datum: 23.04.2025
- Aktenzeichen: 1 U 12/24
- Verfahrensart: Beschluss
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Ein Rechtsanwalt, der ursprünglich seinen ehemaligen Mandanten (den Beklagten) auf Zahlung von Rechtsanwaltsvergütung verklagt hatte und in diesem Verfahren die Ergänzung und Berichtigung des Berufungsurteils beantragte.
- Beklagte: Ein ehemaliger Mandant, der Widerklage auf Auszahlung von Geldern auf dem Fremdgeldkonto des Klägers erhob und den Anträgen des Klägers auf Ergänzung und Berichtigung entgegentrat.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Nachdem das Berufungsgericht in einem Verfahren zwischen einem Rechtsanwalt und seinem ehemaligen Mandanten entschieden hatte, beantragte der Rechtsanwalt die Ergänzung des Urteils hinsichtlich der Abwendungsbefugnis bei der Zwangsvollstreckung und die Berichtigung von Sachverhaltsdarstellungen, die auf seinen eigenen fehlerhaften Angaben beruhten.
- Kern des Rechtsstreits: Das Gericht musste entscheiden, ob Anträge auf Ergänzung eines Urteils zulässig sind, um eine zusätzliche Art der Vollstreckungsabwendung zu ergänzen, und ob ein Urteil berichtigt werden kann, wenn der Tatbestand fehlerhafte Angaben einer Partei wiedergibt.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Oberlandesgericht Bremen wies die Anträge des Klägers auf Ergänzung und Berichtigung des Urteils vom 26.02.2025 vollständig zurück.
- Begründung: Der Antrag auf Ergänzung wurde zurückgewiesen, weil das Gericht bereits über die Abwendungsbefugnis entschieden hatte und die Hinterlegung von Geld als Sicherheitsleistung ohnehin möglich ist. Der Antrag auf Berichtigung wurde zurückgewiesen, weil die bemängelten Angaben des Urteils den eigenen schriftsätzlichen Angaben des Klägers entsprachen und keine vom Gericht gemachte Unrichtigkeit darstellten.
- Folgen: Die Anträge des Klägers, das Berufungsurteil nachträglich zu ändern, wurden abgelehnt. Das Urteil behält seine ursprüngliche Fassung hinsichtlich der Abwendungsbefugnis und der Darstellung des Sachverhalts basierend auf den Angaben der Partei.
Der Fall vor Gericht
OLG Bremen: Anwalt scheitert mit Anträgen auf Urteilsergänzung und -berichtigung bezüglich Zwangsvollstreckung und Tatbestandsfeststellungen
Das Oberlandesgericht (OLG) Bremen hat mit einem Beschluss vom 23. April 2025 (Az.: 1 U 12/24) die Anträge eines Rechtsanwalts auf Ergänzung und Berichtigung eines zuvor ergangenen Berufungsurteils vollumfänglich zurückgewiesen.

Der Anwalt hatte versucht, die Modalitäten zur Abwendung einer Zwangsvollstreckung zu seinen Gunsten erweitern zu lassen und vermeintliche Fehler in der Sachverhaltsdarstellung des Urteils korrigieren zu lassen. Diese Fehler stammten jedoch ursprünglich aus seinen eigenen Schriftsätzen.
Der Ausgangspunkt des Rechtsstreits: Streit um Anwaltshonorar und Fremdgelder vor dem OLG Bremen
Dem Beschluss des OLG Bremen lag eine Auseinandersetzung zwischen einem Rechtsanwalt und seinem ehemaligen Mandanten zugrunde. Der Anwalt hatte seinen früheren Klienten auf Zahlung noch ausstehender Anwaltsgebühren verklagt. Im Gegenzug forderte der ehemalige Mandant per Widerklage die Auszahlung von Geldern, die sich auf einem Fremdgeldkonto des Anwalts befanden.
In der ersten Instanz hatte das Landgericht Bremen mit Urteil vom 9. Februar 2024 die Klage des Anwalts abgewiesen. Stattdessen wurde der Anwalt auf die Widerklage hin verurteilt, an seinen ehemaligen Mandanten einen Betrag von 13.614,18 Euro nebst Zinsen zu zahlen. Dieses Urteil wollte der Anwalt nicht akzeptieren und legte Berufung beim Oberlandesgericht Bremen ein.
Berufungsurteil des OLG Bremen: Anwalt verliert erneut, Zwangsvollstreckung droht nach Zurückweisung der Berufung
Das Oberlandesgericht Bremen bestätigte jedoch in seinem Berufungsurteil vom 26. Februar 2025 die Entscheidung des Landgerichts und wies die Berufung des Anwalts zurück. Somit blieb es bei der Zahlungsverpflichtung des Anwalts gegenüber seinem ehemaligen Mandanten. Die Kosten für das Berufungsverfahren wurden ebenfalls dem Anwalt auferlegt.
Ein wichtiger Aspekt des Berufungsurteils betraf die vorläufige Vollstreckbarkeit. Das OLG erklärte sowohl sein eigenes Urteil als auch das bestätigte Urteil des Landgerichts für vorläufig vollstreckbar. Das bedeutet, der ehemalige Mandant konnte die Zwangsvollstreckung gegen den Anwalt betreiben, um die ihm zugesprochene Geldsumme zu erhalten, auch wenn das Urteil noch nicht endgültig rechtskräftig war. Für das landgerichtliche Urteil wurde die Vollstreckbarkeit zugunsten des ehemaligen Mandanten sogar ohne vorherige Sicherheitsleistung angeordnet.
Um dem Anwalt eine Möglichkeit zu geben, diese unmittelbare Zwangsvollstreckung abzuwenden, traf das OLG eine Regelung gemäß § 711 Satz 1 der Zivilprozessordnung (ZPO). Dem Anwalt wurde gestattet, die Vollstreckung durch das Leisten einer Sicherheitsleistung – einer Art Kaution – in Höhe von 110 Prozent des vollstreckbaren Betrags abzuwenden. Diese Abwendungsbefugnis bestand jedoch nur, wenn nicht der ehemalige Mandant seinerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistete. Die Möglichkeit, die Zwangsvollstreckung auch durch Hinterlegung des geschuldeten Betrags bei einer amtlichen Stelle abzuwenden, wurde in der Entscheidungsformel des OLG-Urteils nicht ausdrücklich genannt.
Anwalt beantragt Urteilsergänzung: Zusätzliche Option der Hinterlegung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung nach § 711 ZPO gefordert
Nachdem dem Anwalt das Berufungsurteil zugestellt worden war, reichte er am 10. März 2025 zwei Anträge beim OLG Bremen ein.
Erstens beantragte er eine Ergänzung der Urteilsformel. Konkret wollte er erreichen, dass ihm die Abwendung der Zwangsvollstreckung nicht nur durch Sicherheitsleistung, sondern ausdrücklich auch durch Hinterlegung des Betrags von 110 Prozent des vollstreckbaren Betrags gestattet wird.
OLG Bremen lehnt Urteilsergänzung ab: §§ 716, 321 ZPO nicht einschlägig für begehrte Änderung der Abwendungsbefugnis
Das OLG Bremen wies diesen Antrag auf Urteilsergänzung jedoch zurück. Zwar sei ein solcher Antrag gemäß §§ 716, 321 ZPO grundsätzlich zulässig, wenn es um Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit (§§ 708, 709 ZPO) oder eben um die Abwendungsbefugnis (§ 711 ZPO) und Schutzanträge (§ 712 ZPO) geht. Dies entspreche auch der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH).
Keine fehlende Entscheidung: Gericht hat über Abwendungsbefugnis entschieden, nur nicht im Sinne des Anwalts
Im vorliegenden Fall sei der Antrag aber nicht begründet. Es liege kein Fall einer fehlenden Entscheidung im Sinne des § 716 ZPO oder eines versehentlich übergangenen Nebenpunktes im Sinne des § 321 ZPO vor. Das Gericht habe nämlich sehr wohl über die Abwendungsbefugnis entschieden, indem es dem Anwalt die Möglichkeit der Abwendung durch Sicherheitsleistung nach § 711 Satz 1 Alternative 1 ZPO eingeräumt hatte. Es habe lediglich die alternative Möglichkeit der Abwendung durch Hinterlegung nach § 711 Satz 1 Alternative 2 ZPO nicht zusätzlich vorgesehen.
Falsches Rechtsmittel: Inhaltliche Fehler sind mit statthaften Rechtsmitteln anzufechten, nicht per Ergänzungsantrag
Wenn die behauptete Fehlerhaftigkeit einer gerichtlichen Entscheidung – hier die Nichtzulassung der Hinterlegung als weitere Alternative – nicht auf einem Übersehen des Punktes beruhe, sondern auf einer Entscheidung, die der Betroffene inhaltlich für falsch hält, sei ein Antrag auf Urteilsergänzung das falsche Mittel. Stattdessen müsse ein statthaftes Rechtsmittel (wie beispielsweise eine Anhörungsrüge oder, je nach Fall, eine Verfassungsbeschwerde) eingelegt werden. Dies sei ebenfalls ständige Praxis des BGH.
Hinterlegung von Geld bereits möglich: Sicherheitsleistung nach § 711 S. 1 Alt. 1 ZPO umfasst Geldhinterlegung gemäß § 108 Abs. 1 S. 2 ZPO
Darüber hinaus, so das OLG, sei die vom Anwalt begehrte ausdrückliche Erwähnung der Hinterlegung auch in der Sache nicht erforderlich gewesen. Die im Urteil bereits zugelassene Sicherheitsleistung nach § 711 Satz 1 Alternative 1 ZPO könne ohnehin gemäß § 108 Absatz 1 Satz 2 ZPO durch die Hinterlegung von Geld oder geeigneten Wertpapieren erbracht werden. Die vom Anwalt offenbar angestrebte spezielle Form der Hinterlegung nach § 711 Satz 1 Alternative 2 ZPO stelle hingegen eine Alternative zur Sicherheitsleistung dar, die sich auf die Hinterlegung des geschuldeten Gegenstands beziehe. Diese sei vor allem relevant, um die Zwangsvollstreckung von Herausgabe- oder Lieferansprüchen (z.B. die Übergabe einer bestimmten beweglichen Sache) abzuwenden.
Da es im konkreten Fall aber um die Verurteilung zur Zahlung eines Geldbetrags ging, komme eine solche Hinterlegung des geschuldeten Gegenstands im Sinne des § 711 Satz 1 Alternative 2 ZPO gar nicht in Betracht. Daher sei kein entsprechender zusätzlicher Ausspruch in der Urteilsformel nötig gewesen. Die Möglichkeit, Geld zu hinterlegen, um die Zwangsvollstreckung abzuwenden, sei bereits durch die getroffene Regelung zur Sicherheitsleistung in Verbindung mit § 108 Absatz 1 Satz 2 ZPO abgedeckt.
Anwalt fordert Urteilsberichtigung: Korrektur von angeblichen Tatbestandsfehlern aufgrund eigener unzutreffender Angaben in der Klageschrift
Der zweite Antrag des Anwalts zielte auf eine Berichtigung des Urteils hinsichtlich bestimmter Angaben im Tatbestand. Der Tatbestand ist der Teil eines Urteils, der den Sachverhalt und den bisherigen Streitverlauf zusammenfasst. Konkret ging es dem Anwalt um den Betrag einer von ihm selbst erstellten Rechtsanwaltsrechnung (Rechnung Nr. …) und um die Aktenzeichen zweier weiterer Rechnungen (Nr. … und …). Diese Angaben seien, so der Anwalt, aufgrund von „redaktionellen Fehlern“ in seiner ursprünglichen Klageschrift in der ersten Instanz falsch gewesen und vom Gericht dann so in den Tatbestand des Berufungsurteils übernommen worden.
OLG Bremen weist auch Urteilsberichtigung zurück: § 319 ZPO und § 320 ZPO greifen nicht bei Übernahme parteieigener Fehler
Auch diesen Antrag auf Urteilsberichtigung wies das OLG Bremen zurück. Eine Berichtigung sei weder nach § 319 ZPO (bei offensichtlichen Unrichtigkeiten wie Schreib- oder Rechenfehlern) noch nach § 320 ZPO (Berichtigung des Tatbestandes bei Unstimmigkeiten mit dem tatsächlichen Parteivortrag) begründet.
Keine Unrichtigkeit des Gerichts: Tatbestand gab korrekt die Angaben des Anwalts aus dessen Klageschrift wieder
Die vom Anwalt beanstandeten Angaben im Tatbestand des Berufungsurteils zum Rechnungsbetrag und zu den Aktenzeichen entsprachen exakt den Angaben, die der Anwalt selbst in seiner erstinstanzlichen Klageschrift gemacht hatte. Diese Angaben wurden im Berufungsverfahren vom ehemaligen Mandanten nicht bestritten, und der Anwalt selbst hatte sie bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz nicht korrigiert.
Es handle sich daher weder um offensichtliche Unrichtigkeiten im Sinne des § 319 ZPO noch überhaupt um Unrichtigkeiten im Sinne des § 320 ZPO. Eine Unrichtigkeit im Tatbestand liege juristisch nur dann vor, wenn das Gericht den Sach- oder Streitstand unzutreffend wiedergibt – also im Tatbestand etwas festhält, was die Parteien so nicht vorgetragen haben oder was vom Gericht nicht so festgestellt wurde. Das sei beispielsweise der Fall, wenn das Gericht etwas als streitig oder unstreitig darstellt, obwohl das Gegenteil der Fall war.
Wenn das Gericht jedoch, wie hier, die schriftsätzlichen Angaben einer Partei korrekt in den Tatbestand übernimmt, liege keine Unrichtigkeit des Gerichts vor – selbst dann nicht, wenn die ursprünglichen Angaben der Partei selbst fehlerhaft waren oder von den gleichzeitig eingereichten Anlagen (wie z.B. Kopien der Rechnungen) abwichen. Die Verantwortung für die Richtigkeit der eigenen schriftsätzlichen Angaben liegt primär bei der Partei.
Keine Hinweispflicht des Gerichts bei nicht entscheidungserheblichen Abweichungen in den Parteivorträgen
Das OLG Bremen sah sich auch nicht in der Pflicht, den Anwalt auf mögliche Abweichungen zwischen seinen schriftsätzlichen Angaben und den aus den beigefügten Anlagen ersichtlichen tatsächlichen Umständen hinzuweisen. Eine solche Aufklärungs- und Hinweispflicht nach §§ 139, 278 Absatz 3 ZPO habe nicht bestanden, da es auf diese spezifischen Details (korrekter Rechnungsbetrag, korrekte Aktenzeichen) für die eigentliche Entscheidung des Gerichts im Berufungsverfahren nicht angekommen sei. Die Fehler waren also nicht entscheidungserheblich.
Fazit: Anträge des Anwalts bleiben erfolglos – Keine Änderung des OLG-Urteils zu Zwangsvollstreckung und Tatbestand
Zusammenfassend lehnte das Oberlandesgericht Bremen beide Anträge des Anwalts ab. Die begehrte Ergänzung der Urteilsformel bezüglich der Hinterlegungsmöglichkeit war prozessual über den Weg der Urteilsergänzung nicht erreichbar und wäre inhaltlich auch nicht notwendig gewesen, da die Hinterlegung von Geld bereits als Form der Sicherheitsleistung möglich ist. Die begehrte Berichtigung des Tatbestandes scheiterte daran, dass die bemängelten Punkte keine juristisch relevanten Unrichtigkeiten des Gerichts darstellten, sondern lediglich die Wiedergabe der fehlerhaften Angaben des Anwalts aus seiner eigenen Klageschrift waren. Das Berufungsurteil vom 26. Februar 2025 bleibt somit unverändert bestehen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das OLG Bremen verdeutlicht, dass Anträge auf Urteilsergänzung und -berichtigung nur bei tatsächlich fehlenden Entscheidungen oder echten gerichtlichen Unrichtigkeiten zulässig sind, nicht jedoch zur nachträglichen Korrektur eigener Fehler oder als Ersatz für Rechtsmittel. Die Möglichkeit zur Geldhinterlegung war bereits in der zugelassenen Sicherheitsleistung enthalten, weshalb keine Urteilsergänzung nötig war. Fehler in Parteischriftsätzen, die vom Gericht korrekt wiedergegeben werden, rechtfertigen keine Tatbestandsberichtigung, selbst wenn sie auf eigenen „redaktionellen Fehlern“ beruhen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet „vorläufige Vollstreckbarkeit“ eines Urteils und welche Auswirkungen hat das für Betroffene?
Wenn ein Gericht ein Urteil fällt, ist es damit nicht immer sofort endgültig. Oft haben die Parteien die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung oder ein anderes Rechtsmittel einzulegen. Erst wenn keine solchen Rechtsmittel mehr möglich sind oder keine eingelegt wurden, wird ein Urteil „rechtskräftig“.
Die „vorläufige Vollstreckbarkeit“ bedeutet, dass die Partei, die das Urteil gewonnen hat, die darin festgestellten Forderungen – zum Beispiel die Zahlung eines Geldbetrages oder die Herausgabe einer Sache – schon durchsetzen darf, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das Gericht ordnet dies im Urteil ausdrücklich an.
Für Sie als Betroffener, gegen den ein solches Urteil ergangen ist, bedeutet das: Die Partei, die den Prozess gewonnen hat, kann bereits Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einleiten. Dies kann zum Beispiel die Pfändung von Konten oder Gegenständen sein, um die Geldforderung zu erfüllen. Dies ist möglich, obwohl Sie möglicherweise noch die Absicht haben, gegen das Urteil vorzugehen (z.B. durch Berufung).
Auswirkungen der vorläufigen Vollstreckbarkeit
Für die Partei, die das Urteil gewonnen hat, eröffnet die vorläufige Vollstreckbarkeit die Möglichkeit, schneller zu ihrem Recht zu kommen und die Forderungen durchzusetzen, ohne auf die Rechtskraft des Urteils warten zu müssen. Dies kann wichtig sein, um eine Verschleppung des Verfahrens zu verhindern oder um zu vermeiden, dass der Schuldner in der Zwischenzeit Vermögen beiseiteschafft.
Für die Partei, die das Urteil verloren hat, bedeutet die vorläufige Vollstreckbarkeit einen unmittelbaren Handlungsdruck. Obwohl das Urteil noch nicht endgültig ist und möglicherweise in einer höheren Instanz geändert wird, können bereits einschneidende Maßnahmen (wie Kontopfändung) ergriffen werden.
Welche Möglichkeiten haben Betroffene?
Als Partei, gegen die ein vorläufig vollstreckbares Urteil ergangen ist, sind Sie der Zwangsvollstreckung nicht schutzlos ausgeliefert, auch wenn diese möglich ist. Es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren oder die Vollstreckung zu verhindern oder vorläufig einzustellen. Dies kann zum Beispiel durch Anträge beim Gericht erreicht werden, die darauf abzielen, die Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen oder nur gegen Leistung einer Sicherheit durch die Gegenseite zuzulassen. Oftmals hängt dies davon ab, ob und wie das Gericht die vorläufige Vollstreckbarkeit im Urteil ausgestaltet hat (z.B. mit oder ohne Sicherheitsleistung der Gegenseite).
Das Risiko der vorläufigen Vollstreckung
Es ist wichtig zu wissen, dass die Partei, die ein vorläufig vollstreckbares Urteil vollstreckt, ein Risiko trägt. Sollte das Urteil in einer höheren Instanz (z.B. nach einer Berufung) aufgehoben oder zu Ihren Gunsten geändert werden, so war die vorherige Vollstreckung unrechtmäßig. In diesem Fall muss die Partei, die vollstreckt hat, alles zurückgewähren, was sie durch die Vollstreckung erhalten hat. Darüber hinaus kann sie zum Ersatz des Schadens verpflichtet sein, der Ihnen durch die unrechtmäßige Vollstreckung entstanden ist. –ENDE FAQ-FRAGE–
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Zwangsvollstreckung abzuwenden, und was ist der Unterschied zwischen Sicherheitsleistung und Hinterlegung?
Wenn Ihnen eine Zwangsvollstreckung droht, gibt es verschiedene Wege, darauf zu reagieren. Der einfachste und direkteste Weg ist natürlich, die Forderung zu begleichen, also die geschuldete Summe zu bezahlen.
Oft geht es aber darum, die Zwangsvollstreckung vorübergehend zu stoppen, weil Sie zum Beispiel rechtlich gegen die zugrundeliegende Forderung oder das Urteil vorgehen möchten. In solchen Fällen kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Gericht die Zwangsvollstreckung aussetzen oder einstweilen einstellen. Dies gibt Ihnen Zeit, Ihre rechtlichen Schritte zu verfolgen, ohne dass sofort Vermögenswerte gepfändet werden.
Eine häufige Bedingung, die das Gericht für eine solche Aussetzung stellt, ist die Leistung einer Sicherheit. Das bedeutet, Sie müssen einen bestimmten Wert, meistens Geld, zur Verfügung stellen, der dem Gläubiger als Absicherung dient.
Sicherheitsleistung ist ein allgemeiner Begriff dafür, dass jemandem eine Garantie gegeben wird. Diese Garantie soll sicherstellen, dass der Gläubiger nicht benachteiligt wird, falls sich später herausstellt, dass die Zwangsvollstreckung doch rechtmäßig ist. Die Sicherheitsleistung kann auf verschiedene Weise erbracht werden, oft durch Hinterlegung von Geld bei Gericht oder auch durch eine Bankbürgschaft. Sie wird typischerweise angeordnet, wenn die Vollstreckung gestoppt wird, während noch ein Rechtsmittelverfahren (wie Berufung oder Einspruch gegen ein Urteil) läuft.
Die Hinterlegung ist eine spezifische Art und Weise, wie Geld oder andere Werte offiziell bei einer staatlichen Stelle (der sogenannten Hinterlegungsstelle, oft beim Amtsgericht) abgegeben werden. Dies geschieht nach genauen gesetzlichen Regeln. Hinterlegung kann eine Form der Sicherheitsleistung sein, wenn das Gericht anordnet, dass die Sicherheit durch Einzahlung bei der Hinterlegungsstelle zu leisten ist. Sie wird aber auch in anderen Situationen genutzt, zum Beispiel wenn unklar ist, wer der richtige Empfänger einer Zahlung ist, oder wenn der Gläubiger die Annahme einer Zahlung verweigert.
Der entscheidende Unterschied liegt also darin: Sicherheitsleistung ist der Oberbegriff für eine Absicherung, die dem Gläubiger gewährt wird, um ihn vor Nachteilen zu schützen. Hinterlegung ist eine bestimmte Form der Verwahrung von Werten bei einer offiziellen Stelle, die unter anderem dazu dienen kann, eine Sicherheitsleistung zu erbringen, oder auch zur Erfüllung einer Zahlungspflicht genutzt wird. Wenn das Gericht eine Sicherheitsleistung verlangt, kann es vorschreiben, dass diese durch Hinterlegung zu erfolgen hat.
Die Höhe der geforderten Sicherheitsleistung oder des zu hinterlegenden Betrags wird in der Regel vom Gericht festgelegt. Sie orientiert sich meist an der Höhe der Forderung, die vollstreckt werden soll, zuzüglich geschätzter Kosten und Zinsen, um den Gläubiger umfassend abzusichern. Dies kann die volle Forderungssumme oder auch mehr betragen.
Die Hauptvorteile dieser Möglichkeiten liegen darin, dass sie Ihnen Zeit verschaffen und die unmittelbare Zwangsvollstreckung stoppen können, während Sie rechtliche Fragen klären. Der Nachteil ist, dass Sie den geforderten Betrag oder die Sicherheit aufbringen müssen, was Ihr Vermögen bindet. Bei der Hinterlegung sind die Gelder sicher bei einer neutralen Stelle verwahrt. –ENDE FAQ-FRAGE–
Was ist eine Urteilsergänzung und wann kann man sie beantragen?
Eine Urteilsergänzung ist ein rechtliches Mittel, um ein Gerichtsurteil zu vervollständigen, wenn das Gericht versehentlich nicht über alle im Prozess gestellten Anträge oder Klagepunkte entschieden hat. Stellen Sie sich ein Urteil wie eine Liste von Entscheidungen vor, die das Gericht treffen soll. Wenn ein Punkt auf dieser Liste vergessen wurde, kann eine Urteilsergänzung diesen fehlenden Punkt hinzufügen.
Das bedeutet: Eine Urteilsergänzung kommt nur in Frage, wenn ein Gericht bei seiner Entscheidung einen Teil des Streitgegenstandes – also einen der Punkte, über die gestritten wurde und über den das Gericht entscheiden musste – komplett übergangen hat. Es geht darum, eine Lücke im Urteil zu schließen.
Wann kann man eine Urteilsergänzung beantragen?
Sie können eine Urteilsergänzung beantragen, wenn Sie feststellen, dass das Gericht in seinem Urteil über einen Punkt, den Sie oder die Gegenseite klar und deutlich beantragt hatten, keine Entscheidung getroffen hat. Ein häufiges Beispiel ist, wenn über einen der mehreren im Rahmen einer Klage gestellten Anträge oder aber über die Kosten des Verfahrens nicht entschieden wurde.
Wann ist eine Urteilsergänzung nicht möglich?
Ganz wichtig: Eine Urteilsergänzung dient nicht dazu, ein Urteil zu korrigieren, nur weil Sie mit dem Inhalt der Entscheidung nicht einverstanden sind oder weil Sie der Meinung sind, dass das Gericht die Sache falsch beurteilt hat. Wenn das Gericht über einen Punkt entschieden hat, diese Entscheidung aber Ihrer Meinung nach falsch ist, ist eine Urteilsergänzung der falsche Weg. Dafür gibt es andere Rechtsmittel wie zum Beispiel die Berufung.
Eine Urteilsergänzung wird also abgelehnt, wenn das Gericht den betreffenden Punkt nicht vergessen hat, sondern bewusst oder unbewusst eine Entscheidung dazu getroffen hat – auch wenn diese Entscheidung vielleicht nur kurz erwähnt wurde oder Ihnen nicht gefällt. Sie wird auch abgelehnt, wenn der Punkt, der Ihrer Meinung nach fehlt, im Prozess nie wirksam beantragt oder zum Streitgegenstand gemacht wurde. Es muss sich wirklich um eine versehentlich übersehene Entscheidung über einen bereits gestellten Antrag handeln. –ENDE FAQ-FRAGE–
Was bedeutet „Abwendungsbefugnis“ im Zusammenhang mit einer Zwangsvollstreckung?
Die „Abwendungsbefugnis“ ist ein juristischer Begriff, der Ihnen als von einer Zwangsvollstreckung betroffene Person unter bestimmten Voraussetzungen eine wichtige Möglichkeit einräumt.
Stellen Sie sich vor, ein Gericht hat ein Urteil gefällt, das Sie zur Zahlung eines Geldbetrags verpflichtet. Dieses Urteil ist aber möglicherweise noch nicht endgültig, weil zum Beispiel noch ein Berufungsverfahren möglich oder anhängig ist. Trotzdem darf die andere Partei, der Gläubiger, unter Umständen bereits mit der Zwangsvollstreckung beginnen. Man spricht dann von einem „vorläufig vollstreckbaren Urteil“.
In solchen Fällen kann die Abwendungsbefugnis greifen. Sie bedeutet, dass Sie als Person, gegen die vollstreckt werden soll (Schuldner), die laufende oder drohende Zwangsvollstreckung vorläufig verhindern oder stoppen können.
Wie funktioniert das? Indem Sie als Schuldner dem Gläubiger eine Sicherheit leisten. Diese Sicherheit kann in der Regel ein Geldbetrag sein, der beim Gericht hinterlegt wird, oder eine Bürgschaft einer Bank. Die Höhe der Sicherheit wird meist im Urteil selbst festgelegt und orientiert sich am geforderten Betrag zuzüglich möglicher Vollstreckungskosten.
Durch das Leisten dieser Sicherheit signalisieren Sie, dass der Anspruch des Gläubigers im Falle einer endgültigen Bestätigung des Urteils abgesichert ist. Solange diese Sicherheit besteht, darf der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in Ihr Vermögen (wie z.B. eine Kontopfändung oder Gehaltspfändung) nicht durchführen oder muss eine bereits begonnene Vollstreckung einstellen.
Wichtig ist: Diese Möglichkeit besteht nur, wenn das Urteil die Abwendungsbefugnis ausdrücklich vorsieht. Manchmal kann der Gläubiger Ihrer Abwendungsbefugnis wiederum entgegentreten, indem er selbst Sicherheit leistet, um doch vollstrecken zu dürfen. Dies ist eine rechtliche Abwägung, die im Urteil oder durch gesonderte gerichtliche Entscheidungen geregelt sein kann.
Zusammenfassend ermöglicht die Abwendungsbefugnis dem Schuldner eines vorläufig vollstreckbaren Urteils, die sofortige Zwangsvollstreckung durch das Leisten einer im Urteil bestimmten Sicherheit abzuwenden. Es ist ein Mechanismus, um die Rechte beider Parteien während der Schwebephase eines noch nicht endgültigen Urteils auszubalancieren. –ENDE FAQ-FRAGE–
Welche Rolle spielt die Zivilprozessordnung (ZPO) bei einer Zwangsvollstreckung und inwiefern schützt sie Schuldner?
Die Zivilprozessordnung, kurz ZPO, ist im Grunde das „Regelbuch“ für zivilrechtliche Gerichtsverfahren in Deutschland. Wenn jemand einen Anspruch gegen eine andere Person hat – zum Beispiel auf Zahlung von Geld – und dieser Anspruch gerichtlich festgestellt wurde (oft durch ein Urteil oder einen Vergleich), dann regelt die ZPO auch, wie dieser Anspruch notfalls mit staatlicher Hilfe durchgesetzt werden kann. Das ist die sogenannte Zwangsvollstreckung.
Die ZPO als Grundlage der Zwangsvollstreckung
Die ZPO legt fest, wer, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen eine Zwangsvollstreckung durchführen darf. Sie bestimmt, welche Dokumente (wie ein Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil) dafür notwendig sind, welche Behörden zuständig sind (z. B. Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsgericht) und welche Schritte im Verfahren genau einzuhalten sind.
Stellen Sie sich die ZPO wie eine klare Anleitung vor: Sie sorgt dafür, dass eine Zwangsvollstreckung nicht willkürlich abläuft, sondern immer nach festen Regeln und unter staatlicher Kontrolle. Das ist wichtig, um sowohl die Rechte desjenigen zu wahren, der Geld bekommt (des Gläubigers), als auch die desjenigen, der zahlen muss (des Schuldners).
Schuldnerschutz durch die ZPO
Ein zentraler Aspekt der ZPO ist der Schutz des Schuldners. Die Zwangsvollstreckung soll zwar dem Gläubiger helfen, zu seinem Recht zu kommen, sie darf den Schuldner aber nicht in seiner Existenz vernichten. Die ZPO enthält daher viele Regeln, die sicherstellen, dass dem Schuldner das Nötigste zum Leben bleibt.
Diese Schutzvorschriften in der ZPO dienen dazu, dem Schuldner ein menschenwürdiges Leben weiterhin zu ermöglichen. Sie verhindern, dass ihm alles weggenommen wird und er mittellos dasteht.
Einige Beispiele für solche Schutzvorschriften:
- Pfändungsschutz bei Arbeitseinkommen: Ein Teil des Lohns oder Gehalts ist unpfändbar. Wie viel genau, hängt von der Höhe des Einkommens und der Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen ab. Dafür gibt es Pfändungstabellen, die in der ZPO verankert sind. Nur der Betrag, der über dieser Pfändungsfreigrenze liegt, darf gepfändet werden.
- Pfändungsschutz bei Sachwerten: Bestimmte Gegenstände, die der Schuldner und seine Familie zum Leben oder für eine bescheidene Haushaltsführung unbedingt brauchen, dürfen nicht gepfändet werden. Dazu gehören zum Beispiel einfache Möbel, Kleidung, Hausrat oder auch Hilfsmittel, die wegen einer Krankheit benötigt werden. Auch Gegenstände, die für die Ausübung des Berufs notwendig sind, sind oft geschützt.
- Pfändungsschutz auf Konten: Durch die Einrichtung eines Pfändungsschutzkontos (P-Konto) wird ein bestimmter Betrag auf dem Girokonto automatisch vor Pfändung geschützt (der Grundfreibetrag). Dieser Freibetrag kann unter bestimmten Umständen (z. B. bei Unterhaltspflichten) erhöht werden.
Diese und weitere Vorschriften in der ZPO zeigen, dass das Gesetz nicht nur den Gläubiger, sondern auch den Schuldner im Blick hat und versucht, einen Ausgleich der Interessen herzustellen. Die ZPO gibt dem Schuldner zudem verschiedene Rechte und Möglichkeiten, sich gegen eine unzulässige Zwangsvollstreckung zu wehren (z. B. durch Erinnerung oder Vollstreckungsgegenklage). –ENDE FAQ-FRAGE–
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Abwendungsbefugnis
Die Abwendungsbefugnis ist das Recht des Schuldners, eine drohende oder laufende Zwangsvollstreckung gegen sich vorläufig zu verhindern. Dazu kann er dem Gläubiger eine Sicherheit – meist Geld oder eine Bürgschaft – leisten. Diese Sicherheit stellt sicher, dass der Gläubiger im Falle eines endgültigen Urteils rückwirkend seine Forderung erhält. Die Abwendungsbefugnis ist im § 711 Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt und tritt typischerweise bei vorläufig vollstreckbaren Urteilen in Kraft. Beispiel: Wenn ein noch nicht endgültiges Urteil die Zahlung eines Betrags vorsieht, kann der Schuldner durch Sicherheitsleistung die sofortige Pfändung seines Vermögens verhindern.
Sicherheitsleistung
Eine Sicherheitsleistung ist eine Garantie oder Absicherung, die der Schuldner zur Verhinderung der Zwangsvollstreckung erbringt. Dabei handelt es sich meist um Geld, Wertpapiere oder eine Bürgschaft, die dazu dient, den Gläubiger vor Nachteilen zu schützen, falls das Urteil am Ende bestätigt wird. Die Sicherheitsleistung kann gemäß § 711 ZPO vom Schuldner verlangt werden, um eine Vollstreckung vorübergehend auszusetzen oder zu stoppen. Beispiel: Um eine Kontopfändung abzuwenden, hinterlegt der Schuldner 110 % des geforderten Betrags als Sicherheit bei Gericht.
Hinterlegung
Die Hinterlegung ist eine spezifische Form der Geld- oder Sachwertabgabe bei einer amtlichen Stelle (z. B. Gericht), die gesetzlich geregelt ist (u.a. § 108 ZPO). Sie dient dazu, Werte sicher zu verwahren – etwa als Sicherheitsleistung oder zur Ausführung einer Zahlung, wenn der Empfänger unklar ist oder die Annahme verweigert. Im Zwangsvollstreckungsrecht kann die Hinterlegung eine Art der Sicherheitsleistung sein, aber auch eigenständig genutzt werden, wenn geklärt werden muss, wem die Leistung gebührt. Beispiel: Der Schuldner legt den geforderten Geldbetrag bei Gericht hinter, um die Zwangsvollstreckung vorläufig auszusetzen.
Urteilsergänzung
Eine Urteilsergänzung ist ein förmliches Verfahren, um ein Gerichtsurteil zu vervollständigen, wenn das Gericht versehentlich über einen ausdrücklich beantragten und zum Streitgegenstand gehörenden Punkt nicht entschieden hat (§ 321, § 716 ZPO). Sie dient nicht der Korrektur inhaltlicher Fehler, sondern nur zur Schließung von Lücken, wenn ein Teil des Streitgegenstandes übersehen wurde. Beispiel: Hat das Gericht vergessen, über die Kostenverteilung zu urteilen, kann eine Urteilsergänzung beantragt werden, um dies nachzuholen.
Tatbestand (im Urteil)
Der Tatbestand ist der Teil eines Urteils, in dem das Gericht den relevanten Sachverhalt und den bisherigen Verlauf des Rechtsstreits zusammenfasst. Er stellt die Grundlage für die Entscheidung dar. Wichtig ist, dass der Tatbestand die Angaben der Parteien wiedergibt; er muss nicht auf Richtigkeit geprüft werden, sondern entspricht dem, was von den Parteien vorgetragen wurde. Fehler in den schriftsätzlichen Angaben der Parteien werden hier vom Gericht übernommen, ohne dass diese automatisch eine Unrichtigkeit des Gerichts darstellen. Beispiel: Wenn eine Partei eine falsche Rechnungshöhe angibt, wird diese Angabe im Tatbestand vermerkt, ohne dass das Gericht sie ändert.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 711 ZPO: Regelt die Abwendungsbefugnis bei vorläufig vollstreckbaren Urteilen, insbesondere die Möglichkeit, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abzuwenden. Die Norm sichert dem Verpflichteten Schutz vor unbilliger oder verfrühter Zwangsvollstreckung. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG gewährte dem Anwalt die Abwendungsbefugnis ausschließlich durch Sicherheitsleistung, nicht aber durch ausdrückliche Hinterlegung, was Gegenstand des Ergänzungsantrags war.
- § 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO: Erlaubt die Erbringung der Sicherheitsleistung durch Geld- oder Wertpapierhinterlegung bei der zuständigen Stelle. Diese Bestimmung konkretisiert, wie Sicherheitsleistungen praktisch erbracht werden können. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG führte an, dass die Hinterlegung von Geld als Sicherheitsleistung bereits durch diese Vorschrift gedeckt ist, weshalb eine ausdrückliche Regelung der Hinterlegung im Urteil überflüssig war.
- § 716 ZPO und § 321 ZPO: Ermöglichen die Ergänzung und Berichtigung von Urteilen, wenn wesentliche Punkte übersehen oder Fehler entstanden sind. § 716 ZPO betrifft fehlende Entscheidungen (sog. Urteilsergänzung), § 321 ZPO die Berichtigung wegen Versehen oder Irrtümern. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG argumentierte, dass keine fehlende Entscheidung oder übergangener Nebenpunkt vorlag, sodass die Anträge des Anwalts auf Urteilsergänzung und -berichtigung unzulässig waren.
- § 319 ZPO: Lässt Berichtigungen des Urteils zu, wenn es sich um offensichtliche Schreib-, Rechen- oder andere versehentliche Fehler handelt. Voraussetzung ist, dass die Unrichtigkeit dem Gericht unterlaufen ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG stellte fest, dass keine offensichtlichen Fehler vorliegen, weil der Tatbestand den Angaben des Anwalts aus eigenem Vorbringen entsprach, also keine gerichtliche Fehlwiedergabe erfolgte.
- § 320 ZPO: Erlaubt die Berichtigung des Tatbestandes bei Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Sachverhalt oder dem Parteivortrag und der richterlichen Darstellung im Urteil, soweit die Abweichung nicht auf einem offensichtlichen Fehler nach § 319 ZPO beruht. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die beanstandeten Angaben waren nicht tatrichterlich unrichtig, sondern spiegelten die falschen eigenen Angaben des Anwalts wider, daher keine Berichtigungsmöglichkeit.
- Vorläufige Vollstreckbarkeit nach §§ 708, 709 ZPO: Ermöglicht die Vollstreckung von Urteilen trotz Rechtsmittel, um den Gläubiger zu schützen. Voraussetzung ist oft die Anordnung der Vollstreckbarkeit mit oder ohne Sicherheitsleistung. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG bestätigte die vorläufige Vollstreckbarkeit beider Urteile zugunsten des Mandanten und regelte die Bedingungen zur Abwendung der Vollstreckung durch Sicherheitsleistung.
Das vorliegende Urteil
OLG Bremen – Az.: 1 U 12/24 – Urteil vom 23.04.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.