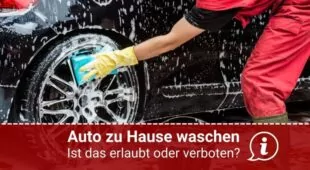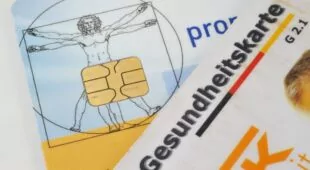Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Landgericht Frankfurt korrigiert Streitwert für einstweilige Verfügung bei Balkonsanierung in WEG – 50% der Sanierungskosten angesetzt
- Ausgangslage: Streit um teure Balkonsanierung und die Verhinderung eines WEG-Beschlusses
- Das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Hanau: Vorläufiger Stopp der Sanierung bei niedrigem Streitwert
- Die Beschwerde: Anwalt des Wohnungseigentümers ficht Streitwertfestsetzung an
- Entscheidung des Landgerichts Frankfurt: Streitwert auf 11.107 Euro erhöht – § 49 GKG maßgeblich
- Die detaillierte Begründung des Landgerichts: Gesamtinteresse und faktische Vorwegnahme der Hauptsache entscheidend für Streitwertbemessung
- Keine Kostenübernahme im Beschwerdeverfahren und Ausschluss weiterer Rechtsmittel
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet „Streitwert“ in einem juristischen Verfahren und warum ist er wichtig?
- Warum wurde im vorliegenden Fall eine einstweilige Verfügung beantragt und was bezweckt sie grundsätzlich?
- Welche Faktoren beeinflussen die Höhe des Streitwerts bei einer einstweiligen Verfügung im WEG-Recht?
- Was bedeutet es, wenn das Gericht eine „offenkundige Rechtswidrigkeit“ eines WEG-Beschlusses feststellt?
- Welche Rechte haben Wohnungseigentümer, wenn sie mit einem Beschluss der WEG nicht einverstanden sind?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 2-13 T 7/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Frankfurt am Main
- Datum: 17.03.2025
- Aktenzeichen: 2-13 T 7/25
- Verfahrensart: Beschluss über die sofortige Beschwerde gegen die Streitwertfestsetzung
- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Kostenrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Der Verfügungskläger beantragte gerichtlich, die Vollziehung eines Beschlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft auszusetzen. Sein Prozessbevollmächtigter legte Beschwerde gegen die Streitwertfestsetzung des Amtsgerichts ein.
- Beklagte: Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), deren Beschluss über eine Baumaßnahme angefochten wurde.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Ein Wohnungseigentümer beantragte im Eilverfahren, einen WEG-Beschluss über eine Balkonsanierung für 22.214,33 Euro auszusetzen. Das Amtsgericht gab dem Antrag statt, setzte den Streitwert für das Verfahren aber nur auf 1.000 Euro fest. Dagegen legte der Anwalt des Wohnungseigentümers Beschwerde ein.
- Kern des Rechtsstreits: Die zentrale Frage war die korrekte Höhe des Streitwerts für eine Einstweilige Verfügung, mit der die Vollziehung eines Beschlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft über eine teure Baumaßnahme ausgesetzt werden sollte.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Landgericht änderte die Streitwertfestsetzung des Amtsgerichts ab. Es setzte den Streitwert für das Verfahren der einstweiligen Verfügung auf 11.107 Euro fest.
- Begründung: Die Aussetzung des Beschlusses durch die einstweilige Verfügung verhindert die Annahme des konkreten Angebots für die Sanierung. Angesichts der Dauer eines Hauptsacheverfahrens wird dieses Angebot voraussichtlich hinfällig, sodass die WEG neue Angebote einholen muss. Daher kommt der Erfolg im Eilverfahren dem Erfolg in der Hauptsache (Verhinderung des konkreten Beschlusses) sehr nahe. Entsprechend gefestigter Rechtsprechung beträgt der Streitwert in solchen Fällen 50 % des Werts der Hauptsache, hier der Kosten der Sanierungsmaßnahme.
- Folgen: Der höhere Streitwert von 11.107 Euro ist maßgeblich für die Berechnung der Gerichts- und Anwaltsgebühren im Verfahren der einstweiligen Verfügung. Das Beschwerdeverfahren zur Streitwertfestsetzung selbst war gebührenfrei.
Der Fall vor Gericht
Landgericht Frankfurt korrigiert Streitwert für einstweilige Verfügung bei Balkonsanierung in WEG – 50% der Sanierungskosten angesetzt
Das Landgericht Frankfurt am Main hat in einem Beschluss vom 17. März 2025 (Az.: 2-13 T 7/25) eine wichtige Klarstellung zur Festsetzung des Streitwerts in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes bei Wohnungseigentumssachen getroffen.

Konkret ging es um die Frage, wie hoch der Wert anzusetzen ist, wenn ein Wohnungseigentümer per einstweiliger Verfügung die Umsetzung eines Beschlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) über eine teure Balkonsanierung verhindern will. Das Gericht entschied, dass in solchen Fällen der Streitwert in der Regel mindestens 50 % der Kosten der umstrittenen Maßnahme beträgt.
Ausgangslage: Streit um teure Balkonsanierung und die Verhinderung eines WEG-Beschlusses
Ein Wohnungseigentümer hatte bei Gericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. Sein Ziel war es, die Ausführung eines Beschlusses zu stoppen, den die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), deren Mitglied er ist, gefasst hatte. Dieser WEG-Beschluss sah die Vergabe eines Auftrags für eine umfangreiche Balkonsanierung vor. Die Kosten für diese Sanierungsmaßnahme waren im Beschluss exakt mit 22.214,33 Euro beziffert. Der antragstellende Wohnungseigentümer wollte mit seinem juristischen Schritt verhindern, dass dieser Beschluss umgesetzt und der Auftrag erteilt wird, bevor die Rechtmäßigkeit des Beschlusses in einem Hauptsacheverfahren geklärt ist.
Das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Hanau: Vorläufiger Stopp der Sanierung bei niedrigem Streitwert
Das zunächst zuständige Amtsgericht Hanau hatte dem Antrag des Wohnungseigentümers mit einem Beschluss vom 6. Januar 2025 stattgegeben und die einstweilige Verfügung erlassen. Die Begründung des Amtsgerichts lautete, dass die Durchführung des WEG-Beschlusses vollendete Tatsachen schaffen würde. Zudem sah das Gericht eine Offenkundige Rechtswidrigkeit des Beschlusses als gegeben an, da für die geplante Balkonsanierung offenbar keine Vergleichsangebote eingeholt worden waren, was ein üblicher Verfahrensfehler in WEG-Angelegenheiten ist.
Für das Verfahren der einstweiligen Verfügung setzte das Amtsgericht Hanau den Streitwert jedoch lediglich auf 1.000 Euro fest. Dieser Wert ist unter anderem für die Berechnung der Anwalts- und Gerichtsgebühren relevant.
Die Beschwerde: Anwalt des Wohnungseigentümers ficht Streitwertfestsetzung an
Gegen diese aus seiner Sicht zu niedrige Streitwertfestsetzung durch das Amtsgericht Hanau legte der Prozessbevollmächtigte des Wohnungseigentümers, also dessen Anwalt, sofortige Beschwerde ein. Er war der Auffassung, dass der vom Amtsgericht festgesetzte Wert von 1.000 Euro dem tatsächlichen wirtschaftlichen Interesse seines Mandanten und der Bedeutung der Angelegenheit nicht gerecht werde.
Entscheidung des Landgerichts Frankfurt: Streitwert auf 11.107 Euro erhöht – § 49 GKG maßgeblich
Das Landgericht Frankfurt am Main gab der sofortigen Beschwerde des Anwalts statt. Mit seinem Beschluss vom 17. März 2025 änderte es die Streitwertfestsetzung des Amtsgerichts Hanau ab und setzte den Streitwert für das Verfahren der einstweiligen Verfügung auf 11.107 Euro fest. Dies entspricht etwa der Hälfte der Kosten der geplanten Balkonsanierung.
Das Gericht erklärte die Beschwerde gemäß § 68 des Gerichtskostengesetzes (GKG) und § 32 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) für statthaft und zulässig. Die Beschwerde sei auch in der Sache begründet. Für die Bemessung des Streitwerts sei § 49 GKG heranzuziehen.
Die detaillierte Begründung des Landgerichts: Gesamtinteresse und faktische Vorwegnahme der Hauptsache entscheidend für Streitwertbemessung
Das Landgericht Frankfurt führte aus, dass für die Wertfestsetzung das Gesamtinteresse an der begehrten Aussetzung der Vollziehung des WEG-Beschlusses maßgeblich sei. Dies sei hier der Fall, da der individuelle Miteigentumsanteil des antragstellenden Wohnungseigentümers (im konkreten Fall ein 7,5-facher Anteil von 134.685/1.000) das Gesamtinteresse im Hinblick auf die vorläufige Maßnahme übersteige. Einfach ausgedrückt: Der Stopp der gesamten Maßnahme war für die Streitwertbemessung relevanter als der individuelle Kostenanteil des einzelnen Eigentümers.
Verhinderung des konkreten Angebots durch die einstweilige Verfügung
Das Landgericht betonte, dass das maßgebliche Gesamtinteresse nicht, wie vom Amtsgericht angenommen, nur mit einem geringen Bruchteil des Werts der Balkonsanierung anzusetzen sei. Die vom Wohnungseigentümer beantragte und vom Amtsgericht gewährte Aussetzung der Vollziehung des WEG-Beschlusses habe zur Folge, dass der Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft das konkrete Angebot der im Beschluss genannten Firma für die Balkonsanierung nicht annehmen könne. Durch die einstweilige Verfügung werde also die Beauftragung genau dieses Unternehmens zu den im Angebot genannten Konditionen verhindert.
Verfall des Angebots und steigende Baukosten als wirtschaftliche Folge
Weiterhin sei üblicherweise davon auszugehen, dass dieses spezifische Angebot angesichts der oft langen Dauer von Anfechtungsverfahren in der Hauptsache hinfällig werde. Eine endgültige Entscheidung über die Gültigkeit des Beschlusses sei meist nicht vor Ablauf der Annahmefrist für das Angebot (gemäß § 147 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) zu erwarten.
Das Gericht prognostizierte, dass selbst wenn der antragstellende Wohnungseigentümer im späteren Hauptsacheverfahren unterliegen sollte – also der ursprüngliche WEG-Beschluss für gültig erklärt würde – die Baufirma nicht mehr an ihr ursprüngliches Angebot gebunden sei. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Preise auf dem Baumarkt sei zudem nicht zu erwarten, dass die Maßnahme später zu identischen Konditionen ausgeführt werden könne (vgl. § 150 BGB, der die verspätete Annahme eines Antrags als neuen Antrag wertet). In der Konsequenz bedeute dies, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft sich im Regelfall nach Abschluss des Hauptsacheverfahrens erneut um Angebote bemühen und über diese einen gesonderten Beschluss fassen müsse.
Anlehnung an ständige Rechtsprechung: Mindestens 50% des Hauptsachewerts für die einstweilige Verfügung
Aufgrund dieser Überlegungen gelangte das Landgericht zu dem Schluss, dass der antragstellende Wohnungseigentümer mit der erwirkten einstweiligen Verfügung einen Erfolg erziele, der de facto der Hauptsache sehr nahe komme. Die Hauptsache wäre hier die endgültige Verhinderung der Umsetzung des konkreten Beschlusses mit dem konkreten Angebot. Die einstweilige Verfügung erreiche dieses Ziel zumindest vorläufig und oft auch endgültig für das ursprüngliche Angebot.
In einem solchen Fall, so das Gericht, entspreche es der gefestigten Rechtsprechung der Kammer (veröffentlicht unter anderem in der Fachzeitschrift ZWE 2021, Seite 50, Randnummer 13), die auch vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main bestätigt wurde (OLG Frankfurt a.M., ZMR 2021, Seite 410), dass der Streitwert für die einstweilige Verfügung auf mindestens 50 % des Werts der Hauptsache festzusetzen ist. Der Wert der Hauptsache bemesse sich hier nach den Kosten der im Beschluss genannten Sanierungsmaßnahme, also den 22.214,33 Euro.
Dementsprechend sei der Streitwert auf 50 % von 22.214,33 Euro, mithin auf 11.107,165 Euro, festzusetzen. Dieser Betrag wurde auf 11.107 Euro gerundet. Das Landgericht merkte an, dass eine derartige Festsetzung des Streitwerts auch vom Anwalt des Wohnungseigentümers beantragt worden war.
Keine Kostenübernahme im Beschwerdeverfahren und Ausschluss weiterer Rechtsmittel
Das Landgericht Frankfurt entschied abschließend, dass das Beschwerdeverfahren gebührenfrei sei. Kosten, die den Parteien im Beschwerdeverfahren entstanden sind, würden gemäß § 68 Abs. 3 GKG nicht erstattet. Eine weitere Beschwerde gegen diesen Streitwertbeschluss ließ das Gericht nicht zu, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Die Entscheidung über den Streitwert ist somit in dieser Instanz endgültig. Diese Entscheidung hat praktische Bedeutung für Wohnungseigentümer und deren Anwälte, da sie eine klare Linie für die Bewertung des Streitwerts in ähnlichen Fällen des einstweiligen Rechtsschutzes vorgibt.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil klärt die Bemessung des Streitwerts bei einstweiligen Verfügungen gegen WEG-Beschlüsse zu Sanierungsmaßnahmen: Er beträgt mindestens 50% der Gesamtkosten der geplanten Maßnahme, nicht nur einen geringen Bruchteil. Hintergrund ist, dass durch den vorläufigen Stopp der Maßnahme faktisch eine Vorwegnahme der Hauptsache erfolgt, da das ursprüngliche Angebot verfällt und die konkrete Maßnahme in der bewilligten Form später meist nicht mehr umsetzbar ist. Diese Entscheidung hat praktische Bedeutung für alle Wohnungseigentümer, die per einstweiliger Verfügung gegen kostspielige WEG-Beschlüsse vorgehen wollen, da sich daraus deutlich höhere Verfahrenskosten ergeben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet „Streitwert“ in einem juristischen Verfahren und warum ist er wichtig?
In einem juristischen Verfahren bezeichnet der Streitwert (manchmal auch Gegenstandswert genannt) den finanziellen Wert dessen, worüber gestritten wird. Stellen Sie sich vor, Sie fordern Geld, weil Ihnen jemand Schaden zugefügt hat, oder Sie möchten die Übergabe einer Sache erreichen. Der Geldwert dieser Forderung oder der Wert der Sache ist dann der Streitwert. Auch bei anderen Auseinandersetzungen, die nicht direkt um Geld gehen, wie zum Beispiel bei der Nutzung eines Grundstücks oder einem bestimmten Recht, muss das Gericht versuchen, diesen Streitwert in Geld auszudrücken.
Die Bedeutung des Streitwerts liegt vor allem in seiner Funktion als Grundlage für die Berechnung der Kosten des Verfahrens. Sowohl die Gebühren für das Gericht als auch die Gebühren für die beteiligten Rechtsanwälte richten sich maßgeblich nach diesem Wert.
Für Sie als Beteiligten bedeutet das:
- Die Kosten hängen ab: Ein höherer Streitwert führt in der Regel zu höheren Gerichts- und Anwaltskosten. Wenn es um einen kleinen Betrag geht, sind die Kosten entsprechend geringer, als wenn es um eine sehr hohe Summe oder einen Gegenstand von großem Wert geht.
- Spiegelbild der Angelegenheit: Der Streitwert zeigt auch, wie „wichtig“ die Angelegenheit aus finanzieller Sicht ist. Eine Klage über 1.000 Euro hat einen Streitwert von 1.000 Euro. Geht es um 100.000 Euro, beträgt der Streitwert 100.000 Euro, was die höhere wirtschaftliche Bedeutung des Falles widerspiegelt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Streitwert ist der Geldwert des „Streitgegenstandes“ und er ist deshalb so wichtig, weil er die Höhe der entstehenden Kosten in einem juristischen Verfahren bestimmt.
Warum wurde im vorliegenden Fall eine einstweilige Verfügung beantragt und was bezweckt sie grundsätzlich?
Die einstweilige Verfügung ist ein wichtiges Instrument im deutschen Recht, das immer dann relevant wird, wenn eine schnelle gerichtliche Entscheidung benötigt wird. Stellen Sie sich vor, es droht eine unmittelbare Gefahr oder ein großer Nachteil, der nicht warten kann, bis ein reguläres Gerichtsverfahren abgeschlossen ist – denn das kann oft Monate oder Jahre dauern. In solchen Eilfällen kann eine einstweilige Verfügung beantragt werden.
Ihr grundsätzlicher Zweck ist es, vorläufige Regelungen zu treffen und einen aktuellen Zustand schnell abzusichern oder einen drohenden Schaden abzuwenden. Es geht darum, eine vorläufige Lösung zu schaffen, bis über die eigentliche Streitfrage in einem normalen Verfahren entschieden werden kann. Man könnte es mit einer Art gerichtlichem „Erste-Hilfe-Maßnahme“ vergleichen.
Warum eine einstweilige Verfügung im WEG-Recht?
Im Wohnungseigentumsrecht (WEG) wird eine einstweilige Verfügung häufig dann beantragt, wenn ein Wohnungseigentümer die Umsetzung eines Beschlusses der Eigentümergemeinschaft schnell verhindern möchte. Nehmen wir an, die Eigentümer haben einen Beschluss gefasst, der aus Sicht eines Eigentümers offensichtlich rechtswidrig ist – zum Beispiel, weil er gegen Gesetze, die Teilungserklärung oder frühere Vereinbarungen verstößt.
Wenn dieser Beschluss nun aber schnell umgesetzt werden soll (z.B. durch Beauftragung von Handwerkern für Bauarbeiten, die der Eigentümer für falsch hält), dann reicht es oft nicht aus, nur eine normale Klage gegen den Beschluss einzureichen. Bis darüber entschieden ist, könnten die Arbeiten längst begonnen haben und große, schwer rückgängig zu machende Fakten geschaffen sein. Eine einstweilige Verfügung kann hier sehr schnell erreichen, dass die Umsetzung des Beschlusses vorläufig gestoppt wird, bis das Gericht in Ruhe über die Rechtmäßigkeit des Beschlusses entscheiden konnte. So werden irreversible Nachteile verhindert.
Es ist wichtig zu verstehen, dass eine einstweilige Verfügung immer nur eine vorläufige Entscheidung ist. Sie regelt die Situation für eine Übergangszeit. Die endgültige Klärung der rechtlichen Frage erfolgt dann in einem eventuell folgenden „Hauptsacheverfahren“.
Welche Faktoren beeinflussen die Höhe des Streitwerts bei einer einstweiligen Verfügung im WEG-Recht?
Der Streitwert (auch Verfahrenswert genannt) ist eine Geldsumme, die für Gerichtsverfahren festgelegt wird. Er ist wichtig, weil sich nach seiner Höhe sowohl die Gerichtsgebühren als auch die Anwaltskosten richten. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel die Kosten.
Bei einer einstweiligen Verfügung im Wohnungseigentumsrecht (WEG-Recht) geht es oft darum, eine schnelle, vorläufige Entscheidung zu bekommen, zum Beispiel um dringende Maßnahmen zu erzwingen oder zu verhindern. Der Streitwert bei einer solchen vorläufigen Entscheidung ist nicht immer derselbe wie bei einem endgültigen Verfahren zur gleichen Sache.
Welche Faktoren die Höhe des Streitwerts bei einer einstweiligen Verfügung im WEG-Recht beeinflussen, sind vor allem:
Das wirtschaftliche Interesse
Der Streitwert orientiert sich am wirtschaftlichen Interesse der Partei, die den Antrag stellt (des sogenannten Antragstellers).
- Für den einzelnen Eigentümer: Wenn Sie als einzelner Eigentümer etwas per einstweiliger Verfügung erreichen wollen, fragt man, welchen geldwerten Vorteil oder welchen wirtschaftlichen Nachteil diese Verfügung für Sie persönlich hätte. Geht es zum Beispiel darum, dass ein Schaden an Ihrem Sondereigentum repariert wird, könnte Ihr Interesse dem Wert der Reparatur entsprechen.
- Für die Gemeinschaft: Oft betreffen WEG-Angelegenheiten aber das Gemeinschaftseigentum oder Entscheidungen, die alle Eigentümer gemeinsam betreffen. In diesen Fällen wird auch das wirtschaftliche Interesse der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) berücksichtigt.
Bedeutung von Sanierungskosten
Geht es bei der einstweiligen Verfügung um eine notwendige Sanierung oder eine andere teure Maßnahme am Gemeinschaftseigentum, spielen die Kosten dieser Maßnahme eine wichtige Rolle für den Streitwert.
Gerichte versuchen, das wirtschaftliche Interesse am Erfolg des Antrags einzuschätzen. Dabei wird nicht immer der volle Wert der gesamten Maßnahme angesetzt, weil es sich ja nur um eine vorläufige Regelung handelt.
- Stellen Sie sich vor, eine dringend notwendige Sanierung am Dach soll per einstweiliger Verfügung durchgesetzt werden, weil es reinregnet. Die Sanierung kostet 100.000 Euro.
- Obwohl der volle wirtschaftliche Wert der Maßnahme für die Gemeinschaft 100.000 Euro beträgt, beurteilt das Gericht das Interesse an der einstweiligen Regelung oft anders. Es geht ja (noch) nicht um die endgültige Entscheidung über die Maßnahme selbst, sondern nur darum, bis zur Klärung der Hauptsache schnell etwas zu erreichen oder zu verhindern.
- Daher nehmen Gerichte bei einstweiligen Verfügungen in WEG-Sachen, die sich auf Kosten beziehen, häufig nur einen Bruchteil der vollen Kosten als Streitwert an. Eine Orientierung an 50% der Sanierungskosten ist dabei ein Ansatz, den Gerichte verfolgen können. Dies soll das spezifische, oft dringliche Interesse an der vorläufigen Regelung abbilden, ohne den Streitwert gleich so hoch anzusetzen wie bei einem endgültigen Urteil über die Durchführung der gesamten Maßnahme.
Dieser Ansatz berücksichtigt, dass das wirtschaftliche Gewicht einer vorläufigen Anordnung geringer sein kann als das einer endgültigen Entscheidung und gleichzeitig das Interesse der Gemeinschaft an der Maßnahme als Ganzes. Es ist eine Art Schätzung des Gerichts, wie wichtig die Angelegenheit zum Zeitpunkt des Eilverfahrens finanziell zu bewerten ist, sowohl für den Antragsteller als auch für die Gemeinschaft.
Was bedeutet es, wenn das Gericht eine „offenkundige Rechtswidrigkeit“ eines WEG-Beschlusses feststellt?
Wenn ein Gericht feststellt, dass ein Wohnungseigentümergemeinschafts (WEG)-Beschluss „offenkundig rechtswidrig“ ist, bedeutet dies, dass der Beschluss auf den ersten Blick und für jedermann klar erkennbar gegen geltendes Recht verstößt. Es handelt sich um einen schwerwiegenden und offensichtlichen Fehler.
Ein solcher Beschluss ist nicht nur „anfechtbar“ (also gerichtlich überprüfbar), sondern von Anfang an „nichtig“. Das bedeutet: Der Beschluss hat rechtlich nie existiert und entfaltet keinerlei Wirkungen, so als wäre er niemals gefasst worden.
Typische Gründe für eine offenkundige Rechtswidrigkeit
Die offenkundige Rechtswidrigkeit liegt vor, wenn der Fehler des Beschlusses so gravierend und offensichtlich ist, dass er ohne Weiteres erkennbar ist. Das passiert meist bei Verstößen gegen zwingende gesetzliche Vorschriften, die fundamental sind, oder wenn die WEG ihre Zuständigkeit klar überschreitet.
Beispiele für Fehler, die zu einer offenkundigen Rechtswidrigkeit führen können, sind:
- Die WEG beschließt etwas, das rechtlich gar nicht von der Gemeinschaft entschieden werden darf, weil es zum Beispiel in das Sondereigentum eines Eigentümers eingreift, ohne dass dafür eine gesetzliche Grundlage besteht.
- Bei einer wichtigen und kostspieligen Baumaßnahme werden grundlegende, gesetzlich vorgeschriebene Verfahren nicht eingehalten. Ein Beispiel, das Sie vielleicht aus einem Gerichtsurteil kennen könnten, ist das fehlende Einholen von Vergleichsangeboten bei einer Auftragsvergabe von bedeutendem Umfang, wenn dies nach den Umständen oder rechtlichen Vorgaben zwingend notwendig gewesen wäre und die Entscheidung derart beeinflusst hat.
- Der Beschluss verstößt gravierend gegen wesentliche Prinzipien des Wohnungseigentumsgesetzes oder gegen die inhaltlichen Grenzen der Beschlussfassungskompetenz.
Folgen der Feststellung
Die Konsequenz der offenkundigen Rechtswidrigkeit ist die Nichtigkeit des Beschlusses von Anfang an. Im Gegensatz zu einem nur anfechtbaren Beschluss, der gültig ist, solange er nicht gerichtlich aufgehoben wird, ist ein nichtiger Beschluss von vornherein unwirksam.
Auch wenn ein nichtiger Beschluss nicht zwingend gerichtlich angefochten werden muss, um seine Unwirksamkeit feststellen zu lassen, wird in der Praxis oft eine gerichtliche Klärung herbeigeführt. Dies dient der Rechtssicherheit und schafft Klarheit für alle Beteiligten, dass der Beschluss tatsächlich keine rechtliche Wirkung entfaltet.
Für Sie als Wohnungseigentümer bedeutet die Feststellung der offenkundigen Rechtswidrigkeit, dass Sie durch diesen Beschluss rechtlich nicht gebunden sind.
Welche Rechte haben Wohnungseigentümer, wenn sie mit einem Beschluss der WEG nicht einverstanden sind?
Als Wohnungseigentümer haben Sie das Recht, sich an der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zu beteiligen. Dazu gehört auch das Recht, Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) überprüfen zu lassen, wenn Sie der Meinung sind, dass diese nicht ordnungsgemäß zustande gekommen sind oder gegen geltendes Recht oder eine ordnungsmäßige Verwaltung verstoßen.
Dieses Recht wird durch die Anfechtungsklage ausgeübt. Das bedeutet, Sie können beim zuständigen Gericht beantragen, den Beschluss für ungültig zu erklären.
Fristen und Vorgehen
Es ist sehr wichtig, dass Sie bestimmte Fristen beachten:
- Die Klage muss innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung bei Gericht eingereicht werden.
- Innerhalb von zwei weiteren Monaten nach Ablauf der Klagefrist müssen Sie die Klage begründen. Das bedeutet, Sie müssen dem Gericht mitteilen, warum Sie den Beschluss für falsch halten.
Wenn diese Fristen versäumt werden, wird der Beschluss grundsätzlich bestandskräftig, das heißt, er kann dann nicht mehr angefochten werden, selbst wenn er fehlerhaft sein sollte. Es gibt wenige Ausnahmen, beispielsweise bei sogenannten Nicht-Beschlüssen oder absoluten Nichtigkeiten, die aber in der Praxis selten sind.
Wirkung der Anfechtung und einstweiliger Rechtsschutz
Eine wichtige Besonderheit ist: Die Einreichung der Anfechtungsklage führt nicht automatisch dazu, dass der Beschluss vorläufig nicht umgesetzt werden darf. Der Beschluss bleibt also zunächst gültig und kann von der Verwaltung der WEG (dem Verwalter oder Beirat) umgesetzt werden, bis das Gericht endgültig entschieden hat.
Wenn die sofortige Umsetzung des Beschlusses für Sie schwere oder unzumutbare Nachteile hätte, gibt es die Möglichkeit, beim Gericht einen Eilantrag zu stellen. Diesen Antrag nennt man Antrag auf einstweilige Verfügung oder Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz. Damit kann das Gericht, falls es dem Antrag stattgibt, die vorläufige Aussetzung der Beschlussumsetzung anordnen, bis über die Hauptsache (die Anfechtungsklage) entschieden ist. Ein solcher Eilantrag ist nur in bestimmten, dringenden Fällen Erfolg versprechend.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Streitwert
Der Streitwert bezeichnet die finanzielle Wertgröße des Konflikts, um den es in einem Gerichtsverfahren geht. Er gibt an, wie viel Geld der Streitgegenstand ungefähr wert ist und ist die Grundlage für die Berechnung von Gerichts- und Anwaltsgebühren (§§ 3, 49 GKG). Im vorliegenden Fall wird der Streitwert an den Kosten der Balkonsanierung bemessen, da diese die wirtschaftliche Bedeutung des streitigen WEG-Beschlusses widerspiegelt. Ein höherer Streitwert führt zu höheren Kosten für die Parteien.
Beispiel: Wenn Sie gegen einen Beschluss klagen, der Baumaßnahmen für 20.000 Euro betrifft, orientiert sich der Streitwert typischerweise an dieser Summe oder einem Teil davon.
Einstweilige Verfügung
Die einstweilige Verfügung ist eine schnelle, vorläufige gerichtliche Anordnung, mit der vermieden wird, dass durch ein Handeln des Gegners bereits vor der endgültigen Gerichtsentscheidung unwiederbringliche Fakten geschaffen werden. Sie dient der vorläufigen Regelung einer Situation bis zur endgültigen Klärung im Hauptsacheverfahren (§ 935 ZPO). Im geschilderten Fall will der Wohnungseigentümer mit der einstweiligen Verfügung verhindern, dass der WEG-Beschluss zur Balkonsanierung umgesetzt wird, bevor das Gericht die Rechtmäßigkeit des Beschlusses endgültig beurteilt.
Beispiel: Wenn jemand gerade damit beginnt, ein umstrittenes Bauvorhaben durchzuführen, kann man mit einer einstweiligen Verfügung erreichen, dass die Arbeiten vorübergehend gestoppt werden.
Offenkundige Rechtswidrigkeit
Ein Beschluss ist offenkundig rechtswidrig, wenn sein Verstoß gegen geltendes Recht so offensichtlich und gravierend ist, dass er ohne weitere Prüfung sofort erkennbar ist. Dies führt dazu, dass der Beschluss von Anfang an unwirksam oder nichtig ist (§ 134 BGB als Grundnorm für Rechtswidrigkeit). Im Fall des WEG-Beschlusses lag eine offenkundige Rechtswidrigkeit vor, weil keine erforderlichen Vergleichsangebote eingeholt wurden – ein typischer, schwerwiegender Verfahrensfehler in solchen Verfahren.
Beispiel: Wenn die Eigentümergemeinschaft einen Bauauftrag ohne Einholung kommerzieller Angebote an ein willkürlich ausgewähltes Unternehmen vergibt, kann dies eine offenkundige Rechtswidrigkeit darstellen.
Aussetzung der Vollziehung
Die Aussetzung der Vollziehung bedeutet, dass die Wirksamkeit eines behördlichen oder gerichtlichen Verwaltungsakts (hier: WEG-Beschluss) vorübergehend ausgesetzt wird, bis über dessen Rechtmäßigkeit endgültig entschieden ist (§ 80 Abs. 5 VwGO analog im Zivilrecht möglich). Durch die einstweilige Verfügung wird die Umsetzung des Beschlusses vorläufig gestoppt, sodass keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden, bevor geklärt ist, ob der Beschluss gültig ist. Somit „ruht“ die Vollziehung des Beschlusses.
Beispiel: Ein Bauvorhaben darf erst beginnen, wenn die Aussetzung der Vollziehung aufgehoben ist, wenn ein Widerspruch oder eine Klage gegen den Bau genehmigung anhängig ist.
§ 49 Gerichtskostengesetz (GKG)
§ 49 GKG regelt die Bemessung des Streitwertes für gerichtliche Verfahren. Er bestimmt, wie der Gegenstandswert zu schätzen ist, wenn kein unmittelbar klarer Geldbetrag zugrunde liegt oder bei besonderen rechtlichen Umständen. Im vorliegenden Fall hat das Landgericht Frankfurt § 49 GKG für die Festsetzung des Streitwertes in der einstweiligen Verfügung herangezogen, indem es den wirtschaftlichen Wert der streitigen Maßnahme – hier die Balkonsanierungskosten – zur Grundlage nahm und diese auf 50 % angesetzt hat.
Beispiel: Wenn ein Gericht über die Gültigkeit eines Beschlusses im Wohnungseigentum entscheidet, dessen wirtschaftliche Folgen sich nicht eins zu eins in Geld ausdrücken lassen, hilft § 49 GKG bei der Schätzung des Streitwerts zur Berechnung der Verfahrenskosten.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 49 Gerichtskostengesetz (GKG): Regelt die Bemessung des Streitwerts insbesondere für Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und legt fest, dass der wirtschaftliche Wert der Streitigkeit Grundlage für die Gebührenbildung ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht verwendete § 49 GKG als entscheidende Rechtsgrundlage zur korrekten Festsetzung des Streitwerts, da dieser den Umfang des wirtschaftlichen Interesses am Verfahrensgegenstand abbildet.
- § 68 Gerichtskostengesetz (GKG): Behandelt das Beschwerdeverfahren über Streitwertfestsetzungen bei Gerichten und stellt klar, unter welchen Voraussetzungen eine Beschwerde zulässig und gebührenfrei ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Beschwerde des Wohnungseigentümers gegen die zu niedrige Streitwertfestsetzung wurde nach § 68 GKG als zulässig und statthaft anerkannt, das Beschwerdeverfahren selbst blieb kostenfrei.
- § 32 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG): Enthält Grundsätze zur Ermittlung des Streitwerts für anwaltliche Gebühren im Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht zog § 32 RVG hinzu, um die Gebührenermittlung auf Basis des festgesetzten Streitwerts korrekt zu begründen, was für die Kostentragung und Anwaltsgebühren relevant ist.
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG): Regelt die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern und die Entscheidungskompetenz der Wohnungseigentümergemeinschaft, einschließlich der Beschlussfassung zu baulichen Maßnahmen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Streit dreht sich um die Anfechtung und Aussetzung eines WEG-Beschlusses, der eine Balkonsanierung beschlossen hat, welche der einzelne Eigentümer per einstweiliger Verfügung stoppen will.
- § 147 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Bestimmt, dass eine Willenserklärung nur wirksam angenommen werden kann, solange der Antrag noch gilt; die Annahme einer verspäteten Erklärung wird als neuer Antrag gewertet. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die mögliche Verwirkung des ursprünglichen Sanierungsangebots aufgrund der Dauer des Hauptsacheverfahrens beruht auf § 147 Abs. 2 BGB, da die Annehmfrist des Angebots verstreichen kann.
- § 150 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Regelt, dass die verspätete Annahme eines Antrags als neuer Antrag gilt und somit rechtlich andere Bedingungen oder Fristen zur Folge haben kann. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht weist darauf hin, dass durch verspätete Annahme des Sanierungsangebots neue Konditionen erforderlich werden könnten, was wirtschaftliche Nachteile für die WEG bedeutet und die Bedeutung der einstweiligen Verfügung verstärkt.
Das vorliegende Urteil
LG Frankfurt/Main – Az.: 2-13 T 7/25 – Beschluss vom 17.03.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.