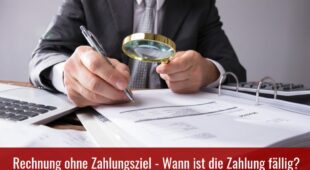Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- LG Lübeck: Kein Rücktritt vom Kaufvertrag für Photovoltaikanlage bei zu kurzer Fristsetzung trotz Speicher-Brandgefahr und Kapazitätsreduktion
- Ausgangslage: Streit um defekten Photovoltaik-Speicher und bekannte Brandgefahr bei Senec-Modellen
- Streitpunkte der Parteien: Mangelhafte Batteriemodule, Brandrisiko und Angemessenheit der Nacherfüllungsfrist
- Entscheidung des Landgerichts Lübeck: Klage der Käufer wegen Stromspeicher-Mängeln vollumfänglich abgewiesen
- Begründung des Gerichts: Vertragstyp und entscheidend fehlende angemessene Fristsetzung zur Nacherfüllung
- Entscheidender Punkt: Unangemessen kurze Frist zur Nacherfüllung verhindert wirksamen Rücktritt vom Kaufvertrag
- Kein späterer wirksamer Rücktritt und kein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verkäufer
- Kosten des Rechtsstreits und vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Rechte habe ich als Käufer, wenn ein Produkt, wie ein Stromspeicher, nicht die versprochene Leistung erbringt oder Sicherheitsmängel aufweist?
- Was bedeutet „Nacherfüllung“ im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag und welche Fristen sind dabei zu beachten?
- Wann ist eine Frist zur Nacherfüllung „angemessen“ und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
- Unter welchen Umständen kann ich von einem Kaufvertrag zurücktreten, wenn ein Produkt mangelhaft ist?
- Welche Rolle spielt der Hersteller eines Produkts (hier: Stromspeicher) bei Mängeln und welche Ansprüche kann ich gegebenenfalls direkt gegen den Hersteller geltend machen?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 10 O 82/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: LG Lübeck
- Verfahrensart: Schriftliches Verfahren
- Rechtsbereiche: Vertragsrecht, Kaufrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Käufer einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher, die wegen behaupteter Mängel am Speicher (Brandgefahr, Kapazitätsreduktion) vom Vertrag zurücktreten wollten.
- Beklagte: Vertriebshändler der Photovoltaikanlage und des Speichers, der die Klageabweisung beantragte.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Käufer kauften eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher. Nach bekannt gewordenen Brandvorfällen bei ähnlichen Speichern reduzierte der Hersteller die Kapazität per Fernwartung und kündigte später einen Modulaustausch an. Weniger als drei Wochen nach ihrer Forderung auf volle Betriebsbereitschaft erklärten die Käufer den Rücktritt vom Kaufvertrag.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging darum, ob die Käufer vom Vertrag zurücktreten konnten, weil der Speicher wegen möglicher Brandgefahr nur eingeschränkt nutzbar war, obwohl der Hersteller eine Lösung (Modulaustausch) ankündigte. Zentral war die Frage, ob die Käufer dem Verkäufer eine ausreichend lange Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hatten.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Klage der Käufer wurde vollständig abgewiesen. Die Käufer müssen die Kosten des Rechtsstreits tragen.
- Begründung: Das Gericht sah den Vertrag als Kaufvertrag an. Der Hauptgrund für die Abweisung war, dass die Käufer dem Verkäufer keine angemessene Frist zur Reparatur oder Nachlieferung gesetzt hatten, bevor sie den Rücktritt erklärten. Eine Frist von weniger als drei Wochen wurde als zu kurz angesehen, insbesondere bei einem komplexen Massenprodukt und der Rolle des Verkäufers als reiner Händler.
- Folgen: Die Klage auf Rückabwicklung des Vertrages wegen mangelhafter Leistung wurde abgewiesen. Die Käufer konnten somit zu diesem Zeitpunkt nicht vom Vertrag zurücktreten und müssen die Kosten des Verfahrens tragen.
Der Fall vor Gericht
LG Lübeck: Kein Rücktritt vom Kaufvertrag für Photovoltaikanlage bei zu kurzer Fristsetzung trotz Speicher-Brandgefahr und Kapazitätsreduktion

Das Landgericht Lübeck hat in einem viel beachteten Fall entschieden, dass Käufer einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher nicht ohne Weiteres vom Vertrag zurücktreten können, auch wenn der Speicher aufgrund von Brandgefahr in seiner Kapazität gedrosselt wurde. Entscheidend war hier, dass die Käufer dem Verkäufer eine zu kurze Frist zur Behebung der Mängel gesetzt hatten, insbesondere da der Hersteller bereits einen kostenlosen Austausch der betroffenen Module angekündigt hatte.
Ausgangslage: Streit um defekten Photovoltaik-Speicher und bekannte Brandgefahr bei Senec-Modellen
Im Zentrum des Rechtsstreits stand eine Photovoltaikanlage, die die Käufer bei dem beklagten Vertriebshändler erworben hatten. Ein wesentlicher Bestandteil des Auftrags war ein Stromspeicher des Typs Senec V3 Hybrid duo mit einer Gesamtspeicherkapazität von 7,5 kWh, hergestellt von einem als Streithelferin auftretenden Unternehmen. Der Vertrag umfasste sowohl die Lieferung als auch die Montage der gesamten Anlage. Die Installation und Inbetriebnahme des Speichers erfolgte am 8. April 2022.
In der Folgezeit kam es zu besorgniserregenden Entwicklungen: In den Monaten März 2022 sowie März und August 2023 wurden mehrere Brandvorfälle bei Stromspeichern des Herstellers bekannt. Als Ursache wurden Schäden an den verbauten Lithium-Ionen-Batteriemodulen (NCA-Zellen) identifiziert. Um weitere Risiken zu minimieren, reagierte der Speicherhersteller mit drastischen Maßnahmen: Mittels Fernabschaltung wurden Tausende von Speichern – im März 2022 rund 66.000 und im März 2023 etwa 90.000 Geräte – in einen geregelten Standby-Modus versetzt oder ihr Betriebszustand auf eine reduzierte Kapazität, zuletzt auf maximal 70 Prozent, beschränkt. Für die betroffenen Kunden bedeutete dies eine erhebliche Einschränkung der Nutzbarkeit ihrer Stromspeicher. Zur Überwachung und Früherkennung von Zelldefekten entwickelte der Hersteller zudem eine spezielle Monitoring-Software namens „SmartGuard“.
Als Kompensation für die eingeschränkte Nutzbarkeit bot der Speicherhersteller seinen Kunden Kulanzzahlungen an, die zunächst 7,50 € pro Woche betrugen und später auf 1,07 € pro Tag bei einer theoretischen Nutzung über der 70-Prozent-Kapazitätsgrenze hinaus angepasst wurden.
Am 22. November 2023 forderten die Käufer den Verkäufer schriftlich auf, ihren Speicher wieder uneingeschränkt und sicher in Betrieb zu nehmen. Nur zwei Tage später, am 24. November 2023, erhielten die Käufer eine direkte E-Mail vom Speicherhersteller. Darin kündigte dieser einen kostenlosen Austausch der betroffenen Batteriemodule gegen Module mit neuerer LFP-Technologie an. Dieser Austauschprozess sollte voraussichtlich ab Sommer 2024 beginnen. Bis dahin sollten die Speicher weiterhin im auf 70 Prozent reduzierten Betriebszustand verbleiben.
Ungeachtet dieser Ankündigung erklärten die Prozessbevollmächtigten der Käufer bereits mit Schreiben vom 10. Dezember 2023 – also weniger als drei Wochen nach ihrer Aufforderung zur Nacherfüllung – den Rücktritt vom Kaufvertrag. Sie forderten die Rückzahlung des ihrer Ansicht nach anteiligen Kaufpreises für den Speicher in Höhe von 16.124,50 € brutto Zug-um-Zug gegen Rückgabe des Speichers.
Streitpunkte der Parteien: Mangelhafte Batteriemodule, Brandrisiko und Angemessenheit der Nacherfüllungsfrist
Die Käufer begründeten ihren Rücktritt mit schwerwiegenden Vorwürfen: Die verbauten Zellmodule seien minderwertig und wiesen physische Produktionsfehler auf. Diese Fehler würden eine akute Brandgefahr begründen, die auch nicht durch Software-Updates behoben werden könne. Zudem führten die Mängel zu einer Unterschreitung der vertraglich garantierten nutzbaren Speicherkapazität.
Der Verkäufer beantragte die Abweisung der Klage. Er argumentierte, der anteilige Preis für den Speicher habe lediglich 13.328,00 € betragen. Der Speicher sei zudem zertifiziert und verfüge über eine Sicherheitsinfrastruktur, die dem aktuellen Stand der Technik entspreche. Die bekannt gewordenen Brandvorfälle seien seltene Einzelfälle eines unvermeidbaren Technologierisikos von Lithium-Ionen-Zellen. Ein solches Restrisiko könne nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik nicht vollständig ausgeschlossen werden und sei von Käufern als Teil des allgemeinen Lebensrisikos hinzunehmen, zumal den Käufern dieses Risiko bekannt gewesen sei oder hätte bekannt sein müssen. Die Reduzierung der Kapazität und die Ankündigung des Modulaustauschs durch den Hersteller seien adäquate Maßnahmen.
Das Gericht fällte seine Entscheidung im schriftlichen Verfahren, also ohne mündliche Verhandlung.
Entscheidung des Landgerichts Lübeck: Klage der Käufer wegen Stromspeicher-Mängeln vollumfänglich abgewiesen
Das Landgericht Lübeck wies die Klage vollumfänglich ab. Folglich müssen die Käufer die Kosten des Rechtsstreits sowie die Kosten der Nebenintervention (also die Kosten, die dem Speicherhersteller durch seine Beteiligung am Verfahren entstanden sind) tragen. Das Urteil ist gegen eine Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.
Begründung des Gerichts: Vertragstyp und entscheidend fehlende angemessene Fristsetzung zur Nacherfüllung
Die Klage wurde als unbegründet erachtet, da den Käufern kein Anspruch auf Rückabwicklung des Vertrages gemäß den relevanten Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere §§ 346 Abs. 1, 323 Abs. 1, 437 Nr. 2, 434 BGB, zustehe.
Einleitend klärte das Gericht die rechtliche Natur des Vertragsverhältnisses. Der Vertrag über die Lieferung und Montage der Photovoltaikanlage nebst Stromspeicher wurde als Kaufvertrag mit Montageverpflichtung nach § 433 BGB eingestuft und nicht als Werkvertrag gemäß § 631 BGB. Diese Einordnung ist entscheidend, da unterschiedliche Vertragstypen auch unterschiedliche Rechtsfolgen bei Mängeln nach sich ziehen können. Das Gericht stützte sich dabei auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), wonach der Schwerpunkt der Gesamtleistung maßgeblich ist. Kriterien hierfür sind die Art des Liefergegenstandes, das Wertverhältnis von Lieferung und Montage sowie die Besonderheiten des zu erbringenden Ergebnisses. Im vorliegenden Fall handelte es sich bei den Komponenten der Photovoltaikanlage und des Speichers um serienmäßig hergestellte Waren. Die Käufer hatten keine individuellen Herstellungsanforderungen vorgetragen. Auch gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Installations- und Anpassungsarbeiten über das übliche Maß hinausgegangen wären. Aus der vorgelegten Rechnung, die für den Speicher und eine Wallbox Einzelpreise auswies, die knapp die Hälfte des Gesamtnettopreises ausmachten, sowie aus gerichtsbekannten Entgelten aus Parallelverfahren schloss das Gericht, dass der Montageleistung ein verhältnismäßig geringer Wert zukam. Die bloße Pflicht zur Herstellung einer funktionstüchtigen Anlage stelle für sich genommen keinen individuellen Erfolg dar, der für einen Werkvertrag spräche. Das Gericht folgte damit einer in vergleichbaren Fällen verbreiteten juristischen Einschätzung, nahm aber auch zur Kenntnis, dass andere Landgerichte in ähnlichen Konstellationen zu abweichenden Einordnungen gelangt waren.
Entscheidender Punkt: Unangemessen kurze Frist zur Nacherfüllung verhindert wirksamen Rücktritt vom Kaufvertrag
Der Kernpunkt der gerichtlichen Abweisung lag jedoch darin, dass die Käufer dem Verkäufer keine Angemessene Frist zur Nacherfüllung im Sinne von § 323 Abs. 1 BGB gesetzt hatten. Dieser Paragraph sieht vor, dass ein Gläubiger (hier die Käufer) bei einer nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung dem Schuldner (hier dem Verkäufer) grundsätzlich erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt haben muss, bevor er vom Vertrag zurücktreten kann.
Die Angemessenheit einer solchen Frist bestimmt sich stets nach den Umständen des Einzelfalls und erfordert eine Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien. Das Gericht verwies darauf, dass bei technisch komplexen Produkten und insbesondere bei massenhaft auftretenden Mängeln in der Vergangenheit Fristen von lediglich zwei Wochen oder zwei Monaten als unangemessen kurz, hingegen Fristen von bis zu zwölf Monaten als angemessen betrachtet wurden.
Bei der Interessenabwägung im konkreten Fall berücksichtigte das Gericht:
- Das nachvollziehbare Interesse der Käufer an einem zügig funktionierenden Speicher zur Eigenstromnutzung, zur Einsparung von Stromkosten und insbesondere an der Beseitigung einer persönlich empfundenen Brandgefahr.
- Die Position des Verkäufers, der lediglich Vertriebshändler und nicht der Produzent des Speichers ist. Nach einem Nacherfüllungsverlangen benötige der Verkäufer Zeit zur Einordnung der Reklamation, gegebenenfalls zur Überprüfung des Mangels, zur Analyse der Ursachen sowie zur Planung und Umsetzung der Nacherfüllung. Dies erfordere bei der großen Anzahl betroffener Speicher einen erheblichen organisatorischen, finanziellen und logistischen Aufwand. Dass es sich um ein Massenprodukt handele, sei Käufern beispielsweise durch die üblichen Lieferzeiten solcher Anlagen regelmäßig bekannt.
- Zugunsten des Verkäufers (und mittelbar des Herstellers) wurde zudem gewertet, dass dem Brandrisiko durch die Drosselung der Speicherkapazität auf 70 % bereits begegnet wurde. Weiterhin leistete der Speicherhersteller finanzielle Kulanzzahlungen für die eingeschränkte Nutzung und hatte den kostenlosen Austausch der Module bereits angekündigt.
Vor diesem Hintergrund befand das Gericht die von den Käufern abgewartete Frist zwischen ihrer Aufforderung zur Nacherfüllung am 22. November 2023 und ihrer Rücktrittserklärung am 10. Dezember 2023, die weniger als drei Wochen betrug, als eindeutig nicht angemessen. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums sei eine angemessene Reaktion des Verkäufers angesichts der komplexen Gesamtumstände und der bereits initiierten Maßnahmen des Herstellers vernünftigerweise nicht zu erwarten gewesen. Die Ankündigung des Modulaustauschs durch den Hersteller nur zwei Tage nach der Nacherfüllungsaufforderung hätte den Käufern signalisieren müssen, dass an einer Lösung gearbeitet wird.
Kein späterer wirksamer Rücktritt und kein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verkäufer
Das Gericht stellte weiterhin fest, dass die Käufer auch zu keinem späteren Zeitpunkt, insbesondere nicht im laufenden Gerichtsverfahren, eine wirksame Rücktrittserklärung abgegeben hätten. Zwar könne eine Klage auf Rückabwicklung eines Vertrages unter bestimmten Umständen eine konkludente (stillschweigende) Rücktrittserklärung beinhalten. Dies schied hier jedoch aus, da die Käufer sich in ihrer Klageschrift explizit auf den vorgerichtlich am 10. Dezember 2023 erklärten Rücktritt bezogen hatten. Einem solchen Festhalten an einer bereits unwirksamen Erklärung könne kein neues Erklärungsbewusstsein für einen erneuten Rücktritt beigemessen werden.
Schließlich verneinte das Gericht auch einen etwaigen Schadensersatzanspruch der Käufer gegen den Verkäufer aus den §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB (Pflichtverletzung bei Vertragsverhandlungen oder im Vorfeld eines Vertragsschlusses). Die Käufer hatten keinen konkreten Vortrag zu einer Pflichtverletzung des Verkäufers vor Vertragsschluss gehalten. Soweit die Käufer eine Pflichtverletzung in den Softwaremaßnahmen am Speicher sahen (also der Kapazitätsdrosselung), so sei diese Maßnahme nicht vom Verkäufer, sondern vom Speicherhersteller erfolgt und könne daher nicht dem Verkäufer angelastet werden.
Kosten des Rechtsstreits und vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils
Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits beruht auf dem Grundsatz, dass die unterliegende Partei die Kosten trägt (§§ 91 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO). Da die Käufer mit ihrer Klage vollumfänglich scheiterten, müssen sie sowohl die Gerichtskosten als auch die Anwaltskosten des Verkäufers und des Speicherherstellers übernehmen. Die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils gegen Sicherheitsleistung ergibt sich aus § 709 S. 2 ZPO. Dies bedeutet, dass der Verkäufer das Urteil (hinsichtlich der Kostenerstattung) bereits vollstrecken könnte, wenn er eine entsprechende Sicherheit leistet, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil lehrt, dass bei Mängeln an technisch komplexen Produkten wie Photovoltaikanlagen eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewährt werden muss, bevor ein Rücktritt vom Kaufvertrag möglich ist. Die Quintessenz liegt darin, dass selbst bei Sicherheitsrisiken (hier Brandgefahr durch defekte Batteriemodule) ein vorschneller Rücktritt unwirksam sein kann, wenn der Hersteller bereits eine Lösung (Modulaustausch) angekündigt hat. Das Urteil dürfte für viele PV-Anlagenbesitzer relevant sein, da es die Hürden für einen Rücktritt bei Mängeln verdeutlicht und zeigt, dass Gerichte bei Massenprodukten längere Nacherfüllungsfristen als angemessen erachten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Rechte habe ich als Käufer, wenn ein Produkt, wie ein Stromspeicher, nicht die versprochene Leistung erbringt oder Sicherheitsmängel aufweist?
Wenn Sie ein Produkt kaufen und dieses nicht so funktioniert wie es soll oder sogar Sicherheitsmängel hat, spricht man juristisch von einem Sachmangel. Ein Sachmangel liegt zum Beispiel vor, wenn das Produkt nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat (z.B. geringere Leistung als versprochen) oder sich nicht für die übliche Verwendung eignet (z.B. Sicherheitsrisiken). Als Käufer haben Sie in diesem Fall bestimmte Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer.
Ihr wichtigstes und erstes Recht ist die sogenannte Nacherfüllung. Das bedeutet, Sie können vom Verkäufer verlangen, dass er den Mangel behebt. Der Verkäufer hat dabei die Wahl, ob er das Produkt repariert (Nachbesserung) oder Ihnen ein neues, mangelfreies Produkt liefert (Nachlieferung). Der Verkäufer trägt die Kosten dafür, zum Beispiel für Transport oder Einbau.
Sie müssen dem Verkäufer grundsätzlich eine angemessene Frist für diese Nacherfüllung einräumen. Erst wenn die Nacherfüllung fehlschlägt (z.B. die Reparatur behebt den Mangel nicht) oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert oder sie unmöglich ist, können Sie weitere Rechte geltend machen.
Nachdem die Nacherfüllung nicht erfolgreich war oder unmöglich ist, stehen Ihnen sekundäre Rechte zur Verfügung:
- Minderung des Kaufpreises: Sie können den Kaufpreis auf einen angemessenen Betrag reduzieren. Stellen Sie sich vor, das Produkt ist nur die Hälfte wert, weil es nicht richtig funktioniert; dann könnten Sie verlangen, die Hälfte des Preises zurückzuerhalten.
- Rücktritt vom Kaufvertrag: Wenn der Mangel erheblich ist, können Sie vom Vertrag zurücktreten. Das bedeutet, Sie geben das mangelhafte Produkt zurück und erhalten den gezahlten Kaufpreis erstattet. Dieses Recht besteht aber in der Regel nur bei wesentlichen Mängeln und nachdem die Nacherfüllung versucht wurde oder unmöglich war.
Zusätzlich zu diesen Rechten können Sie unter bestimmten Voraussetzungen auch Schadensersatz verlangen. Dies ist möglich, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Kosten für die Demontage des mangelhaften Produkts). Schadensersatz können Sie in der Regel neben der Nacherfüllung oder der Minderung geltend machen, aber nicht gleichzeitig mit dem Rücktritt vom Vertrag, da dieser den Vertrag insgesamt aufhebt.
Ein wichtiger Punkt ist die Beweislast. Grundsätzlich muss der Käufer beweisen, dass das Produkt bei der Übergabe bereits einen Mangel hatte. Wenn Sie das Produkt jedoch als Verbraucher von einem Unternehmer gekauft haben (Verbrauchsgüterkauf), gibt es in den ersten zwölf Monaten nach Übergabe eine Erleichterung für Sie: Es wird vermutet, dass der Mangel bereits bei der Übergabe vorhanden war, es sei denn, der Verkäufer kann das Gegenteil beweisen. Nach Ablauf dieser zwölf Monate kehrt sich die Beweislast wieder um, das heißt, Sie müssten dann beweisen, dass der Mangel von Anfang an bestand.
Was bedeutet „Nacherfüllung“ im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag und welche Fristen sind dabei zu beachten?
Wenn Sie etwas kaufen und die Ware nicht so ist, wie sie sein sollte (man spricht von einem Mangel), dann haben Sie als Käufer bestimmte Rechte. Das wichtigste Recht ist zunächst die Nacherfüllung. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen neuen Fernseher, und der Bildschirm hat einen Kratzer. Oder Sie kaufen eine Waschmaschine, die von Anfang an nicht richtig wäscht. Hier liegt ein Mangel vor.
Was bedeutet Nacherfüllung?
Die Nacherfüllung gibt dem Verkäufer die Möglichkeit, den Mangel zu beheben. Er kann das auf zwei Arten tun:
- Reparatur (Nachbesserung): Der Verkäufer versucht, den Mangel an der gelieferten Sache selbst zu beheben. Beim Fernseher wäre das, den Kratzer zu entfernen oder den Bildschirm auszutauschen. Bei der Waschmaschine wäre es, den Defekt zu reparieren.
- Austausch (Nachlieferung): Der Verkäufer liefert Ihnen eine neue, mangelfreie Sache derselben Art. Im Beispiel des Fernsehers oder der Waschmaschine bekämen Sie ein neues, funktionierendes Gerät.
Sie als Käufer haben grundsätzlich das Wahlrecht zwischen Reparatur und Austausch. Allerdings kann der Verkäufer Ihre gewählte Art der Nacherfüllung ablehnen, wenn diese für ihn mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre, insbesondere im Vergleich zur anderen Art der Nacherfüllung.
Wie fordern Sie Nacherfüllung und setzen eine Frist?
Um Ihr Recht auf Nacherfüllung auszuüben, müssen Sie den Verkäufer über den Mangel informieren und ihn auffordern, diesen zu beheben. Dabei sollten Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist für die Nacherfüllung setzen.
Was eine „angemessene Frist“ ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Es gibt keine starren Vorgaben in Tagen oder Wochen. Faktoren, die dabei eine Rolle spielen können, sind:
- Die Art der gekauften Sache (ein Auto zu reparieren dauert länger als ein Buch umzutauschen).
- Die Schwere des Mangels.
- Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder einer neuen Sache.
- Die Zumutbarkeit für den Käufer.
Die Frist muss so bemessen sein, dass der Verkäufer unter normalen Umständen die Möglichkeit hat, den Mangel innerhalb dieser Zeit zu reparieren oder die neue Sache zu liefern. Es ist ratsam, die Frist konkret zu benennen (z.B. „bis zum [Datum]“ oder „innerhalb von zwei Wochen“), auch wenn das Gesetz das nicht zwingend vorschreibt. Eine klare Kommunikation hilft beiden Seiten.
Was passiert, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder der Verkäufer nicht reagiert?
Wenn der Verkäufer innerhalb der von Ihnen gesetzten angemessenen Frist den Mangel nicht behebt oder die Nacherfüllung verweigert, dann scheitert die Nacherfüllung. In diesem Fall stehen Ihnen als Käufer weitere Rechte zu. Sie können dann zum Beispiel vom Vertrag zurücktreten und Ihr Geld zurückverlangen oder den Kaufpreis mindern.
Auch wenn der Verkäufer versucht hat, den Mangel zu beheben, dies aber mehrmals nicht erfolgreich war (man spricht von „fehlgeschlagener Nachbesserung“, meist nach zwei Versuchen, abhängig vom Einzelfall), dann gilt die Nacherfüllung ebenfalls als gescheitert, und die weiteren Rechte entstehen.
Wann ist eine Frist zur Nacherfüllung „angemessen“ und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
Wenn Sie eine Sache gekauft haben, die einen Mangel aufweist, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, Sie können verlangen, dass der Verkäufer den Mangel beseitigt (Reparatur) oder Ihnen eine mangelfreie Sache liefert (Ersatzlieferung). Dafür müssen Sie dem Verkäufer eine sogenannte „angemessene“ Frist setzen.
Was bedeutet „angemessen“?
Der Begriff „angemessen“ bedeutet hier: Die Frist muss unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls passend sein. Es gibt keine festen Regeln wie „immer zwei Wochen“ oder „immer zehn Werktage“. Was im Einzelfall angemessen ist, hängt stark von der jeweiligen Situation ab.
Welche Faktoren beeinflussen die Länge der Frist?
Viele verschiedene Punkte spielen eine Rolle, um zu beurteilen, ob eine Frist angemessen ist:
- Art des Mangels: Handelt es sich um einen kleinen Kratzer, der schnell behoben ist, oder um einen komplizierten technischen Defekt, der eine aufwendige Reparatur erfordert? Je einfacher der Mangel, desto kürzer kann die Frist sein.
- Komplexität der Nacherfüllung: Eine einfache Reparatur dauert kürzer als der Austausch eines komplexen Bauteils oder die Lieferung einer komplett neuen, schwer verfügbaren Ware.
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder Ersatzware: Sind die benötigten Teile sofort lieferbar oder müssen sie erst bestellt werden, vielleicht sogar aus dem Ausland? Das kann die Dauer erheblich verlängern.
- Zumutbarkeit für den Verkäufer: Der Verkäufer muss eine realistische Chance haben, die Nacherfüllung innerhalb der Frist zu schaffen. Seine betrieblichen Möglichkeiten, die Verfügbarkeit von Personal und Werkstattkapazitäten spielen eine Rolle.
- Ihre Interessen als Käufer: Wie dringend benötigen Sie die Sache? Ist es zum Beispiel ein Auto, das Sie täglich brauchen, oder ein saisonaler Gegenstand, den Sie erst in einigen Monaten wieder verwenden?
Eine Frist von wenigen Tagen kann bei einem einfachen Mangel angemessen sein, während bei einer komplizierten Reparatur oder Beschaffung auch mehrere Wochen angemessen sein können.
Was, wenn der Hersteller eine Reparatur ankündigt?
Manchmal kündigt nicht der Verkäufer, sondern der Hersteller an, einen Mangel zu beheben, zum Beispiel im Rahmen einer Rückrufaktion. Auch in diesem Fall muss die Reparatur durch den Hersteller innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Die Beurteilung der Angemessenheit folgt denselben Grundsätzen wie oben beschrieben, wobei hier die Organisation und die Kapazitäten des Herstellers sowie die Anzahl der betroffenen Produkte eine Rolle spielen können. Eine solche Ankündigung des Herstellers kann dazu führen, dass die Frist für die Nacherfüllung durch den Verkäufer gehemmt oder beeinflusst wird, solange die Mangelbehebung durch den Hersteller realistisch und zeitnah erwartet werden kann.
Unter welchen Umständen kann ich von einem Kaufvertrag zurücktreten, wenn ein Produkt mangelhaft ist?
Wenn Sie ein Produkt kaufen, das einen Mangel aufweist – also nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet – stehen Ihnen bestimmte Rechte zu. Der Rücktritt vom Kaufvertrag, bei dem Sie das Produkt zurückgeben und Ihr Geld zurückerhalten, ist eine dieser Möglichkeiten.
Allerdings können Sie in der Regel nicht sofort vom Kaufvertrag zurücktreten, nur weil ein Mangel vorliegt. Das Gesetz sieht vor, dass der Verkäufer zunächst eine Chance erhält, den Mangel zu beheben. Diesen Vorrang der Mängelbeseitigung nennt man Nacherfüllung.
Die Priorität der Nacherfüllung
Die Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer das Recht hat, Ihnen entweder ein neues, mangelfreies Produkt zu liefern (Ersatzlieferung) oder das mangelhafte Produkt zu reparieren (Nachbesserung). Sie als Käufer können in der Regel wählen, welche Art der Nacherfüllung Sie bevorzugen, es sei denn, die eine Option ist für den Verkäufer mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden.
Sie müssen dem Verkäufer hierfür in der Regel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung einräumen. Was „angemessen“ ist, hängt von der Art des Produkts und des Mangels ab.
Wann ist ein Rücktritt möglich?
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist meist erst dann möglich, wenn die dem Verkäufer eingeräumte Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert. Eine Nacherfüllung gilt zum Beispiel als fehlgeschlagen, wenn zwei Reparaturversuche desselben Mangels ohne Erfolg bleiben oder eine Ersatzlieferung ebenfalls mangelhaft ist.
Auch wenn die Nacherfüllung für Sie als Käufer unzumutbar ist (z.B. weil sie sehr lange dauern würde oder Ihnen erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet), kann dies unter bestimmten Umständen ebenfalls einen Rücktritt rechtfertigen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der vorliegende Mangel nicht unerheblich sein darf. Ein sehr kleiner, unbedeutender Mangel, der die Funktion oder den Wert des Produkts kaum beeinträchtigt (stellen Sie sich einen winzigen, kaum sichtbaren Kratzer an einem Möbelstück vor), berechtigt in der Regel nicht zum Rücktritt. Der Mangel muss schon eine gewisse Bedeutung haben.
Die Folgen des Rücktritts
Wenn die Voraussetzungen für einen Rücktritt vorliegen und Sie diesen wirksam erklären, führt das zu einer Rückabwicklung des Kaufvertrags. Das bedeutet, der Vertrag wird im Prinzip „rückgängig gemacht“.
Sie als Käufer müssen das mangelhafte Produkt an den Verkäufer zurückgeben. Im Gegenzug muss der Verkäufer Ihnen den von Ihnen gezahlten Kaufpreis erstatten. Gegebenenfalls sind dabei Nutzungsentschädigungen für die Zeit, in der Sie das Produkt trotz des Mangels genutzt haben, zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt der Hersteller eines Produkts (hier: Stromspeicher) bei Mängeln und welche Ansprüche kann ich gegebenenfalls direkt gegen den Hersteller geltend machen?
Wenn Sie ein Produkt wie einen Stromspeicher kaufen, ist Ihr erster und wichtigster Ansprechpartner bei Mängeln in der Regel derjenige, von dem Sie das Produkt gekauft haben – also der Verkäufer (z.B. der Installateur oder Händler). Das liegt an der sogenannten gesetzlichen Gewährleistung. Die Gewährleistung besagt, dass der Verkäufer dafür einstehen muss, dass die Ware zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Mängeln ist. Zeigt sich innerhalb einer bestimmten Frist ein Mangel, haben Sie grundsätzlich Ansprüche gegen den Verkäufer, wie z.B. Nachbesserung oder Neulieferung.
Der Hersteller des Produkts spielt bei Mängeln eine andere Rolle als der Verkäufer. Direkt gegen den Hersteller können Sie unter bestimmten Umständen Ansprüche geltend machen, die zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gegen den Verkäufer bestehen können.
Herstellergarantie (oft freiwillig)
Viele Hersteller geben eine Herstellergarantie. Dies ist ein freiwilliges Versprechen des Herstellers an den Käufer. Die genauen Bedingungen, was die Garantie abdeckt (z.B. bestimmte Teile, Arbeitszeit, die Dauer der Garantie), sind Sache des Herstellers. Wenn der Mangel unter die Bedingungen dieser Herstellergarantie fällt, können Sie Ihre Ansprüche (z.B. Reparatur oder Austausch) direkt beim Hersteller geltend machen, unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer.
Produkthaftung (bei Schäden durch das Produkt)
Eine weitere Möglichkeit, den Hersteller direkt in Anspruch zu nehmen, besteht aufgrund der sogenannten Produkthaftung. Diese kommt aber nicht bei jedem Mangel zur Anwendung. Die Produkthaftung greift, wenn durch einen Fehler des Produkts ein Schaden entsteht, der über das Produkt selbst hinausgeht (z.B. wenn der defekte Stromspeicher einen Brand verursacht und Ihr Haus beschädigt). In solchen Fällen können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatzansprüche direkt gegen den Hersteller haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei einem Mangel am Stromspeicher ist Ihr erster Ansprechpartner meist der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung. Der Hersteller kann direkt in Anspruch genommen werden, wenn er eine Garantie gegeben hat (Herstellergarantie) oder wenn der Mangel zu Schäden an anderen Dingen geführt hat (Produkthaftung).
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Rücktritt vom Kaufvertrag
Der Rücktritt vom Kaufvertrag ist ein Recht des Käufers, den Vertrag nachträglich aufzulösen, wenn die gekaufte Sache mangelhaft ist und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Voraussetzung für den Rücktritt ist in der Regel, dass der Verkäufer trotz gesetzter angemessener Frist die Mängel nicht beseitigt (Nacherfüllung). Bei wirksamem Rücktritt geben Käufer und Verkäufer die erbrachten Leistungen zurück (z. B. Rückgabe der Ware gegen Erstattung des Kaufpreises). Dieses Recht ist nur bei erheblichen Mängeln anwendbar und erfolgt auf Grundlage von §§ 346, 323, 437 BGB.
Beispiel: Sie kaufen ein defektes Handy und geben dem Händler zwei Wochen Zeit, es zu reparieren. Reparatur gelingt nicht, dann können Sie vom Kaufvertrag zurücktreten und Geld zurückverlangen.
Angemessene Frist zur Nacherfüllung
Die angemessene Frist zur Nacherfüllung ist der Zeitraum, den der Käufer dem Verkäufer zur Behebung eines Mangels setzt, bevor er weitere Rechte wie den Rücktritt geltend machen kann (§ 323 Abs. 1 BGB). Die Länge der Frist richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, zum Beispiel Art und Schwere des Mangels, Komplexität der Reparatur sowie Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Eine Frist ist angemessen, wenn sie dem Verkäufer eine realistische Chance gibt, den Mangel zu beheben, auch bei technisch anspruchsvollen Produkten.
Beispiel: Bei einem einfachen Computerproblem kann eine Frist von zwei Wochen ausreichen, bei einer komplexen Reparatur eines Stromspeichers sind mehrere Monate angemessen.
Nacherfüllung
Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer zu verlangen, dass er die mangelhafte Sache repariert (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefert (Nachlieferung) (§ 439 BGB). Der Verkäufer trägt die Kosten der Nacherfüllung. Der Käufer hat grundsätzlich das Wahlrecht, aber der Verkäufer kann die gewünschte Art ablehnen, wenn sie mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre. Die Nacherfüllung muss innerhalb der vom Käufer gesetzten angemessenen Frist erfolgen.
Beispiel: Wenn Ihre Waschmaschine defekt ist, kann der Händler sie reparieren oder durch ein neues Gerät ersetzen.
Kaufvertrag mit Montageverpflichtung
Ein Kaufvertrag mit Montageverpflichtung ist ein Vertrag, bei dem der Verkäufer nicht nur die Kaufsache übergibt, sondern auch deren Installation oder Montage übernimmt. Rechtlich wird dieser Vertragstyp meist als Kaufvertrag gemäß § 433 BGB eingeordnet, wenn der Schwerpunkt auf der Lieferung der Ware liegt. Dadurch gelten die Regeln des Kaufrechts (z. B. Gewährleistungsrechte), allerdings können Montagefehler ebenfalls zu Mängeln führen.
Beispiel: Sie kaufen eine Photovoltaikanlage inklusive Einbau; der Vertrag ist ein Kaufvertrag mit Montageverpflichtung, da die Hauptleistung der Kauf der Anlage ist und die Montage eine Nebenleistung.
Pflichtverletzung vor Vertragsschluss (culpa in contrahendo)
Die Pflichtverletzung vor Vertragsschluss bezeichnet eine schuldhafte Verletzung von Pflichten, die schon während der Vertragsverhandlungen gelten (§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB). Hierunter fallen etwa fehlerhafte Informationen oder Verschweigen wichtiger Umstände, die für den Vertragsschluss entscheidend sind. Eine solche Pflichtverletzung kann zu Schadensersatzansprüchen führen, wenn der Vertragspartner dadurch einen Schaden erleidet.
Beispiel: Ein Verkäufer verschweigt vor Vertragsschluss, dass ein gekaufter Stromspeicher wegen Brandgefahr zurückgerufen wurde; das kann Schadensersatzpflicht begründen, wenn der Käufer dadurch geschädigt wird.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 323 Abs. 1 BGB (Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung): Dieser Paragraph regelt, dass der Käufer erst nach erfolgloser, angemessener Fristsetzung zur Nacherfüllung vom Vertrag zurücktreten kann. Die Frist muss sich nach den Umständen des Einzelfalls richten und dem Verkäufer die Möglichkeit geben, den Mangel zu beheben. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Käufer setzten dem Verkäufer nur eine sehr kurze Frist von weniger als drei Wochen zur Nacherfüllung, die das Gericht als unangemessen bewert, weshalb der Rücktritt unwirksam war.
- § 434 BGB (Sachmangel): Ein Mangel liegt vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet. Physische Defekte oder Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit können einen Sachmangel begründen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die reduzierte Speicherkapazität aufgrund der Drosselung und die Brandgefahr stellten einen Sachmangel dar, der jedoch nicht automatisch zum Rücktritt berechtigte, da Nacherfüllung möglich war.
- § 433 BGB (Vertragstyp – Kaufvertrag): Regelt die Pflichten des Verkäufers und Käufers bei einem Kaufvertrag, insbesondere Lieferung einer mangelfreien Sache. Die Einordnung als Kaufvertrag mit Montagepflicht bestimmt die anwendbaren Gewährleistungsrechte. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht qualifizierte den Vertrag als Kaufvertrag mit Montage und nicht als Werkvertrag, was die rechtlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt und Schadensersatz maßgeblich beeinflusst.
- § 437 Nr. 2 BGB (Rechte des Käufers bei Mängeln – Rücktritt): Definiert die Befugnis des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Mangel nicht behoben wird und eine angemessene Frist verstrichen ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Obwohl die Käufer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machten, scheiterte die Rücktrittserklärung an der unzureichenden Fristsetzung zur Nacherfüllung.
- § 280 Abs. 1 BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung): Regelt Schadensersatzansprüche bei Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung zu vertreten hat. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Käufer konnten keinen Schadensersatz gegenüber dem Verkäufer geltend machen, da keine Pflichtverletzung des Verkäufers vor Vertragsschluss vorgetragen wurde und die Kapazitätsdrosselung nicht vom Verkäufer verursacht war.
- § 346 Abs. 1 BGB (Rückabwicklung nach Rücktritt): Bestimmt die Rückgewähr der empfangenen Leistungen bei wirksamen Rücktritt vom Vertrag. Voraussetzung ist die Wirksamkeit des Rücktrittsrechts. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Da der Rücktritt nicht wirksam erklärt wurde, bestehen keine Ansprüche auf Rückabwicklung und Rückzahlung des Kaufpreises.
- §§ 91 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO (Kostenentscheidung im Prozess): Legen fest, dass die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits und der Nebenintervention zu tragen hat. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Käufer mussten die gesamten Prozesskosten sowie die Kosten des Speicherherstellers übernehmen, da ihre Klage vollständig abgewiesen wurde.
- § 709 Satz 2 ZPO (Vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils): Erlaubt die Vollstreckung eines Urteils trotz Rechtsmittel einzulegen, wenn Sicherheitsleistung erbracht wird. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Urteil gegen die Käufer ist vorläufig vollstreckbar, sodass der Verkäufer bereits jetzt Kostenerstattungen geltend machen kann, sofern er Sicherheit leistet.
Das vorliegende Urteil
LG Lübeck – Az.: 10 O 82/24 – Urteil vom 02.05.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.