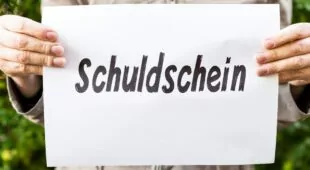LG Essen – Az.: 7 S 188/16 – Beschluss vom 27.06.2017
Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Marl (16 C 59/16) vom 02.12.2016 wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Rechtsmittels trägt der Beklagte.
Das angefochtene Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.
Gründe
Der Beschluss ergeht gemäß § 522 Abs. 2 ZPO.
Zur Begründung wird zunächst gem. § 522 Abs. 2 S. 3 ZPO auf den Hinweisbeschluss vom 04.05.2017 Bezug genommen.
Der Inhalt des Schriftsatzes vom 19.06.2017 rechtfertigt keine abweichende Entscheidung. Richtig ist, dass das Oberlandesgericht im dortigen Fall keine Haftung angenommen hat. Dass die Pflichtverletzung im vorliegenden Fall anders zu bewerten – und die Kammer nicht an die dortige Beurteilung gebunden – ist, wurde unter Verweis auf einschlägige Gerichtsurteile bereits ausgesprochen.
Die Kammer bleibt dabei, dass der Beklagte seiner Pflicht zur ordnungsgemäßen Absicherung der von ihm betriebenen Waschanlage nicht nachgekommen ist; sein Verschulden wird mangels ausreichender Entlastung vermutet. Der Umfang von Verkehrssicherungspflichten bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Leitend sind Gedanken der Risikoverteilung, der Schutzbedürftigkeit, der Erkennbarkeit der Risiken, aber auch der Zumutbarkeit der etwa erforderlichen Maßnahmen. Für Betreiber von automatisierten Waschanlagen bedeutet dies, dass sie gehalten sind, durch die Installation eines Risikominimierungssystems dafür Sorge zu tragen, dass nicht nur bei Fehlfunktionen der Anlage selbst, sondern gerade auch bei typischen Gefahrsituationen, die durch andere Nutzer hervorgerufen werden, ein rechtzeitiger Stopp der Anlage erfolgen kann. Konkrete Vorgaben zur Umsetzung gibt es nicht; es bleibt vielmehr den Waschanlagenbetreibern selbst überlassen, ob sie zur Gefahrvermeidung auf lichtsensorische oder technische Systeme, auf digitale oder personelle Überwachung/Beaufsichtigung oder sonstige geeignete Maßnahmen zurückgreifen. Entscheidend ist, dass die vom Anlagenbetreiber vorgehaltenen Sicherungssysteme geeignet sind, den Weitertransport auf dem Förderband in Gefahrsituationen unverzüglich zu unterbrechen. Die Pflicht des Anlagenbetreibers ist dabei nicht darauf beschränkt, in einer bestimmten Art und Weise tätig zu werden, sondern ist unmittelbar erfolgsbezogen (vgl. LG Itzehoe, Urt. v. 26.01.2017 – 6 O 279/16; OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.06.2015 – 9 U 29/14).
Diesen Anforderungen ist der Beklagte nicht gerecht geworden. Seine Anlage verfügt nicht über ein ausreichendes Sicherungssystem, was sich allein aus dem Umstand ergibt, dass unstreitig das Fahrzeug des Klägers auf ein weiteres, die Waschanlage nutzendes Fahrzeug „aufgeschoben“ wurde. Die Risikosphäre des Klägers war dabei nicht berührt, denn er hatte in der konkreten Situation keine Handhabe zur Schadensvermeidung. Durch Abbremsen seines Fahrzeugs hätte sich der Kläger bei fortdauernder Schleppbewegung der Gefahr eines weiteren Schadens ausgesetzt, weswegen ihm kein (Mit-)Verschuldensvorwurf gemacht werden kann.

Die Kammer „überspannt“ die Anforderungen an die Substantiierungspflicht zur Exkulpation nicht. Abgesehen davon, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21.10.2014 (VIII ZR 34/14) mündliche Nebenabreden zu einem schriftlichen Mietvertrag betraf und die dortige Beurteilung deswegen nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar ist, sind die Ausführungen des Beklagten zu seinem mangelnden Verschulden mit Blick auf die bereits zitierte Entscheidung des OLG Düsseldorf (Urt. v. 16.12.2003 – 21 U 97/03) nicht ausreichend. Die Ursache des Schadens steht fest (vgl. Palandt – Grüneberg, 76. Auflage 2017, § 280 Rn. 40); sie liegt in der mangelnden sofortigen Abschaltung der von dem Beklagten betriebenen Waschanlage und dem dadurch verursachten Aufschieben des Fahrzeugs des Klägers auf ein Drittfahrzeug. Dass der Beklagte diese Ursache nicht zu vertreten haben soll, hat er nicht dargelegt und ist für die Kammer auch nach dem gesamten Parteivorbringen nicht erkennbar.
Schließlich besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 522 Abs. 2 S. 1 Nrn. 2, 3 ZPO i. V. m. § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO nicht vorliegen. Die Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung, wenn eine klärungsbedürftige Frage zu entscheiden ist, deren Auftreten in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen zu erwarten ist und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an einheitlicher Entwicklung und Handhabung des Rechts berührt. Klärungsbedürftig ist eine Rechtsfrage, wenn zu ihr unterschiedliche Auffassungen vertreten werden und noch keine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt (vgl. Zöller-Heßler, 31. Auflage, § 543 Rn. 11 ff.). Eine grundsätzliche Bedeutung folgt also nicht daraus, dass es – wie im Alltag ohnehin – stets zu Schadensfällen auch in einer Waschanlage kommen kann. Gleichzeitig ist der vorliegende Fall nicht „symptomatisch“ für eine bestimmte Rechtskonstellation, da die von dem Beklagten betriebene Waschanlage nur eine unter vielen mit jeweils verschiedener technischer und organisatorischer Ausstattung ist. Ebensowenig steht eine Fortbildung des Rechts im Raum, weil hier lediglich die Frage der Pflichtverletzung eines Werkvertrags untersucht und im obigen Sinne beantwortet wird. Schließlich sprechen sich unter Verweis auf die oben und im Hinweisbeschluss vom 04.05.2017 zitierten Entscheidungen immer mehr erst- und zweitinstanzliche Gerichte für den eingangs dargelegten Haftungsmaßstab aus, was nicht zuletzt dem technischen Fortschritt bei Waschanlagen geschuldet ist. Demnach bedarf es zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung keiner Entscheidung des Berufungs- oder Revisionsgerichts.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO, 26 Nr. 8 EGZPO.