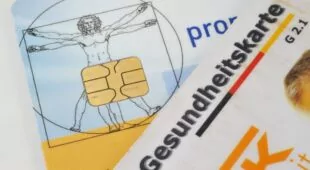Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit-nehmer lässt es sich häufig nicht vermeiden, dass von Zeit zu Zeit einmal ein Schaden entsteht, welcher vom Arbeitnehmer verursacht wurde. Schnell stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage der Haftung. Muss der Arbeitnehmer für einen Schaden aufkommen? Sind etwaige Schadensersatzansprüche der Höhe nach gedeckelt? Welche Faktoren beeinflussen die Höhe des Schadens-ersatzanspruches? Diesen und weiteren Fragen geht der vorliegende Artikel auf den Grund.
Anspruchsgrundlagen der Arbeitnehmerhaftung
Die Haftung des Arbeitnehmers insbesondere bei Sachschäden ergibt sich im wesentlichen aus zwei Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Zum einen kommt eine vertragliche Haftung aus § 280 BGB in Verbindung mit dem jeweiligen Arbeitsvertrag in Betracht. Zum anderen kann eine deliktische Haftung aus § 823 BGB bestehen.
§ 280 BGB
„Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schulder die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.“, § 280 BGB.
Die Norm regelt, dass der Schuldner – in diesem Fall der Arbeitnehmer -, wenn er eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis – z.B. die Pflicht Sachen des Arbeitgebers nicht zu beschädigen – verletzt, dem Gläubiger – Arbeitgeber – dem daraus entstehenden Schaden grundsätzlich ersetzen muss. Weiterhin ist es erforderlich, dass der Schuldner – Arbeitnehmer – die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Während dies im allgemeinen Zivilrecht grundsätzlich vermutet wird, regelt § 619 a BGB im Arbeitsrecht ausdrücklich, dass der Arbeitnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten haben muss. Den Nachweis muss folglich der Arbeitgeber führen. Der Begriff Verschulden bedeutet, dass der Arbeitnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben muss.
§ 823 BGB
„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“, § 823 BGB.
Bei der Arbeitnehmerhaftung liegen die Voraussetzungen des § 823 BGB zwar regelmäßig vor, jedoch kommt der Norm häufig keine große Bedeutung zu. Dies ist deshalb der Fall, weil im Rahmen von § 823 BGB der Nachweis des Vertretenmüssens der Pflichtverletzung vom Arbeitgeber geführt werden muss, während die Beweislast bei § 280 BGB so verteilt ist, dass die Pflichtverletzung vermutet wird, der Arbeitnehmer diese Vermutung jedoch entkräften kann. Der Arbeitgeber ist hier also haftungsrechtlich in einer komfortableren Situation.
Umfang der Arbeitnehmerhaftung
Bezüglich beider Anspruchsgrundlagen bestehen im Arbeitsrecht im Vergleich zum allgemeinen Zivilrecht Besonderheiten, welche zugunsten des Arbeitnehmers wirken. Ebenso sind Auszubildende von der Regelung erfasst. Die Besonderheiten gelten nur, soweit es sich um eine betrieblich veranlasste Tätigkeit handelt.
Zunächst ist – wie im allgemeinen Zivilrecht auch – ein Mitverschulden des Arbeitgebers an der Pflichtverletzung zu prüfen, § 254 BGB. Dieses kann zum Beispiel anzunehmen sein, wenn den Arbeitgeber ein Organisationsverschulden trifft, er den Betrieb also nicht so eingerichtet hat, dass Pflichtverletzungen möglichst vermieden werden.
Im Anschluss an die Prüfung des „echten Mitverschuldens“ ist zu untersuchen, ob sich aus arbeitsrechtlichen Grundsätzen eine Beschränkung der Haftung des Arbeitnehmers ergibt. Es finden die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs Anwendung. Im Rahmen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs wird geprüft, inwieweit eine vollständige Arbeitnehmerhaftung gerechtfertigt erscheint. In der Praxis hat sich hierbei, basierend auf richterlicher Rechtsfortbildung, eine Abstufung nach Fahrlässigkeitsstufen als Grundgerüst herausgebildet. Je geringer der Verschuldensvorwurf an den Arbeitnehmer ist, desto eher ist seine Haftung eingeschränkt (Haftungsprivilegierung im Arbeitsrecht). Eine Besonderheit besteht auch insoweit, als dass sich das Verschulden in Fällen der Arbeitnehmerhaftung auch auf den Schaden beziehen muss.
Leichte Fahrlässigkeit
Von leichter Fahrlässigkeit ist, vereinfacht gesprochen, auszugehen bei Fehlern, die grundsätzlich jedem einmal passieren können und die sich auf die Dauer gesehen, kaum vermeiden lassen. Bei leichter Fahrlässigkeit entfällt die Haftung des Arbeitnehmers in der Regel vollständig.
Mittlere Fahrlässigkeit
Mittlere Fahrlässigkeit liegt bei Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt vor. Hätte der Arbeitnehmer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt aufgewendet, wäre es nicht zu einer Schädigung gekommen. In die Gruppe der mittleren Fahrlässigkeit lassen sich wohl die meisten aller Schadensereignisse im Arbeitsverhältnis einordnen. Eine allgemein gütlige Regelung bei der Haftungsverteilung besteht bei mittlerer Fahrlässigkeit nicht. Würde man eine solche Regelung aufstellen wollen, so könnte man näherungsweise von einer Haftungsteilung 50 : 50 ausgehen. Da das Spektrum der von dieser Gruppe erfassten Fälle jedoch sehr groß ist, lässt sich eine solche Regelung praktisch nicht durchhalten. Letztlich ist im Einzelfall abzuwägen, welche Haftungsquote im konkreten Fall angemessen ist.
Grobe Fahrlässigkeit
Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in einem ungewöhnlich hohem Maße außer Acht lässt und dasjenige unbeachtet lässt, was jedem sofort hätte einleuchten müssen. Erfasst sind folglich Fälle, in denen sich ein objektiver Dritter bei der Verhaltensweise des Arbeitnehmers buchstäblich „an den Kopf fassen“ würde. Bei grober Fahrlässigkeit ist jedenfalls im Grundsatz von einer vollständigen Arbeitnehmerhaftung auszugehen. Auch hier bestehen jedoch Ausnahmen. Nach einer Abwägung kann im Einzelfall, insbesondere bei sehr hohen Schäden, eine Haftungsquotelung angenommen werden.

Vorsatz
Der Arbeitnehmer handelt bereits dann vorsätzlich, wenn er den Eintritt eines Schadens bewusst in Kauf nimmt und wenn er sich mit der Möglichkeit des Schadenseintritts abfindet. Ebenso erfasst sind Fälle, in denen es der Arbeitnehmer gerade darauf anlegt, einen Schaden zu verursachen. Bei vorsätzlichem Verhalten ist für eine Mithaftung des Arbeitgebers grundsätzlich kein Raum.
Generelle Deckelung der Höhe des Schadensersatzanspruchs?
In der Rechtsprechung der Landesarbeitsgerichte wurde phasenweise die Ansicht vertreten, dass der Schadensersatzanspruch des Arbeitsgebers auf eine gewisse Höhe zu deckeln sei. Häufig wurde in diesem Zusammenhang eine Anknüpfung an das monatliche Einkommen favorisiert und etwa eine Deckelung auf die Höhe von drei Monatseinkommen angenommen.
Diesen Ansichten hat jedoch das Bundesarbeitsgericht eine Absage erteilt. Im Wesentlichen hat es als Argument ins Feld geführt, eine derartige generelle Haftungsdeckelung sei – falls insoweit Bedarf gesehen wird – vom Gesetzgeber zu regeln und könne nicht generell von den Gerichten angenommen werden.
Kriterien für eine Haftungsbeschränkung
Insbesondere bei Fällen mittlerer Fahrlässigkeit ist regelmäßig eine umfassende Abwägung vorzunehmen, um zu einer entsprechenden Hadftungsquote zu gelangen. Im Rahmen der Abwägung sind zahlreiche Kriterien zu berücksichtigen.
Dazu zählen beispielhaft:
– Versicherbarkeit des durch den Arbeitnehmer verwirklichten Schadensrisikos
– Dauer der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers
– Alter des Arbeitnehmers
– familiäre Situation des Arbeitnehmers
– wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers
– Verstoß gegen eine ausdrückliche Weisung des Arbeitgebers
– Schadensträchtigkeit der jeweiligen Tätigkeit

Freistellungsanspruch bei Schädigung Dritter
Basierend auf unterschiedlichen dogmatischen Grundsätzen besteht Einigkeit, dass die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung auch dann Anwendung finden, wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen einer betrieblich veranlassten Tätigkeit das Eigentum eines Dritten schädigt.
Eine Haftungsbeschränkung im Verhältnis zum Dritten tritt allerdings nicht ein. Vielmehr hat der Arbeitnehmer in solchen Fällen einen (teilweisen) Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber. Der Umfang dieses Freistellungsanspruchs richtet sich nach den dargelegten Grundsätzen.
Die Tatsache, dass es sich lediglich um einen Freistellungsanspruch handelt führt allerdings auch dazu, dass der Arbeitnehmer im Ergebnis vollständig haftet, wenn der Arbeitgeber für den Schaden – z.B. infolge Insolvenz – nicht aufkommen kann.
Aus der Praxis: Urteile zur Arbeitnehmerhaftung
Anforderungen an die Annahme von grober Fahrlässigkeit bei der Arbeitnehmerhaftung
Grundsatzurteil des BAG aus dem Jahr 1957 zur schadensgeneigten Tätigkeit
Arbeitnehmerhaftung bei mittlerer Fahrlässigkeit
Einschränkung der Arbeitnehmerhaftung trotz grober Fahrlässigkeit
Höchstsumme für die Arbeitnehmerhaftung bei grober Fahrlässigkeit?
Einschränkung der Arbeitnehmerhaftung durch vertragliche Vereinbarung?