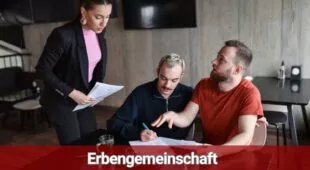Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Prozessuales Anerkenntnis: Schlüssel zu effektiver Prozessverteidigung und Klageabweisung
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Fristen sind bei einer Abmahnung als angemessen anzusehen?
- Was bedeutet ein Prozessuales Anerkenntnis für die Kostenverteilung?
- Wann ist ein Eilantrag vor Gericht wirklich eilbedürftig?
- Ab welchem Zeitpunkt beginnt die Frist für ein sofortiges Anerkenntnis?
- Welche Vor- und Nachteile hat ein vorgerichtliches Anerkenntnis gegenüber einem gerichtlichen?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: LG Berlin II
- Datum: 23.01.2025
- Aktenzeichen: 27 O 351/24
- Verfahrensart: Einstweiliges Verfahren – Anerkenntnisurteil im einstweiligen Verfügungsverfahren
- Rechtsbereiche: Zivilrecht (Persönlichkeitsrecht), Zivilprozessrecht
- Beteiligte Parteien:
- Antragsteller: Die Partei, die den Unterlassungsanspruch geltend machte und deren Ansprüche von der Antragsgegnerin anerkannt wurden.
- Antragsgegnerin: Die Partei, die sich durch ihre Äußerungen und die Verbreitung eines Fotos in Bezug auf den Antragsteller zu einer Unterlassungsverpflichtung hat verpflichten lassen und im Schriftsatz den Anspruch des Antragstellers anerkannt hat.
- Um was ging es?
- Sachverhalt: Es ging um die gerichtliche Anordnung, dass die Antragsgegnerin künftig weder wörtliche noch sinngemäße Äußerungen hinsichtlich des Antragstellers sowie das betreffende Foto verbreitet. Diese Äußerungen und die Verbreitung des Fotos hatten seit dem 28.12.2024 stattgefunden.
- Kern des Rechtsstreits: Der zentrale Streitpunkt war die Zulässigkeit des Erlasses eines Anerkenntnisurteils im einstweiligen Verfügungsverfahren zur Unterlassung bestimmter Äußerungen und der Verbreitung eines Fotos.
- Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Antragsgegnerin wurde verpflichtet, die beanstandeten Äußerungen und die Verbreitung des Fotos zu unterlassen, andernfalls drohen Ordnungsgelder von bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bzw. Ordnungshaft bis zu sechs Monaten. Der Antragsteller trägt die Kosten des Rechtsstreits und das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Zudem wurde der Streitwert auf 30.000,00 € festgesetzt.
- Begründung: Die Antragsgegnerin hat mit ihrem Schriftsatz vom 14.01.2025 den Anspruch des Antragstellers anerkannt, weshalb gemäß § 307 Satz 1 ZPO ein Anerkenntnisurteil zu erlassen war. Der Erlass eines solchen Urteils ist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zulässig. Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 93 ZPO, der ebenfalls Anwendung im einstweiligen Verfügungsverfahren findet.
- Folgen: Die Antragsgegnerin muss unter Androhung von Ordnungsgeldern bzw. Ordnungshaft die Verbreitung der beanstandeten Äußerungen und des Fotos unterlassen. Gleichzeitig trägt der Antragsteller die Kosten des Rechtsstreits, und das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Prozessuales Anerkenntnis: Schlüssel zu effektiver Prozessverteidigung und Klageabweisung
Das prozessuale Anerkenntnis nach § 93 ZPO erweist sich als zentrales Instrument im Prozessrecht, das dem Antragsgegner durch klare Einlassung in gerichtlichen Verfahren und anwaltliche Beratung signifikante Vorteile verschafft. Die Anwendung dieser Regelung basiert auf soliden verfahrensrechtlichen Grundlagen und kann zur Klageabweisung sowie zur Wahrung von zivilrechtlichen Ansprüchen und Streitwerten beitragen.
Ein konkreter Fall beleuchtet, wie gezielte prozessuale Verteidigung und passende Prozessstrategien einen effektiven Rechtsschutz ermöglichen.
Der Fall vor Gericht
Kostenfolgen bei überstürztem Eilantrag trotz Anerkenntnis

Das Landgericht Berlin hat am 23. Januar 2025 ein Anerkenntnisurteil erlassen, das die Bedeutung angemessener Fristen bei einstweiligen Verfügungen unterstreicht. Die Antragsgegnerin wurde zwar zur Unterlassung bestimmter Äußerungen und der Verbreitung eines Fotos verpflichtet, die Verfahrenskosten muss jedoch der Antragsteller tragen.
Zu kurze Abhilfefrist am Wochenende
Der Fall nahm seinen Anfang, als der Antragsteller am Samstag, dem 28. Dezember 2024, eine Abmahnung an die Antragsgegnerin versandte. Die Frist zur Abhilfe wurde auf den nächsten Tag, den 29. Dezember 2024, gesetzt. Bereits am 30. Dezember 2024 um 13:08 Uhr reichte der Antragsteller einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Berlin ein.
Vorschnelles gerichtliches Vorgehen
Das Gericht kritisierte dieses übereilte Vorgehen deutlich. Die gesetzte Frist von nur einem Tag sei nicht ausreichend gewesen, um der Antragsgegnerin eine angemessene rechtliche und tatsächliche Prüfung sowie eine vorgerichtliche Antwort zu ermöglichen. Dies gelte besonders, da die Abmahnung am Wochenende zugestellt wurde. Selbst der Umstand, dass es sich bei der streitgegenständlichen Berichterstattung um eine Verwechslung des Antragstellers mit einer anderen Person gehandelt haben soll, ändere nichts an dieser Bewertung.
Sofortiges Anerkenntnis nach Akteneinsicht
Die Antragsgegnerin erkannte den Anspruch des Antragstellers am 14. Januar 2025 an, nachdem sie am 9. Januar 2025 erstmals durch Akteneinsicht vom vollständigen Inhalt der Antragsschrift Kenntnis erlangt hatte. Das Gericht wertete dies als „sofortiges“ Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO, da es innerhalb der gesetzten Drei-Tages-Frist nach Kenntnisnahme der vollständigen Antragsunterlagen erfolgte.
Streitwert und Ordnungsgeld
Das Gericht setzte den Streitwert auf 30.000 Euro fest. Bei Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung droht der Antragsgegnerin ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise Ordnungshaft. Alternativ kann eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten verhängt werden, die gegebenenfalls an der Geschäftsführung zu vollziehen ist.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass bei Unterlassungsansprüchen eine angemessene Frist zur Stellungnahme gewährt werden muss, bevor gerichtliche Schritte eingeleitet werden. Selbst bei offensichtlichen Rechtsverletzungen wie Personenverwechslungen muss dem Gegner ausreichend Zeit zur Prüfung und Reaktion eingeräumt werden – insbesondere an Wochenenden. Wird vorschnell geklagt, können die Prozesskosten dem Antragsteller auferlegt werden, auch wenn er in der Sache Recht bekommt.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Sie von jemandem eine Unterlassung fordern möchten, müssen Sie diesem eine faire Chance geben, auf Ihre Forderung zu reagieren. Eine Frist von nur einem oder zwei Tagen über das Wochenende ist zu kurz – auch wenn die Rechtsverletzung für Sie offensichtlich erscheint. Setzen Sie realistische Fristen von mindestens 3-5 Werktagen. Andernfalls riskieren Sie, die Prozesskosten selbst tragen zu müssen, auch wenn Sie den Rechtsstreit gewinnen. Eine vorschnelle Klage kann Sie also unnötig Geld kosten.
Benötigen Sie Hilfe?
Präzise Beratung bei engen Fristen und Prozessabläufen
In Fällen, in denen kurzfristige Fristen und abrupte gerichtliche Entscheidungen den Ablauf eines Zivilverfahrens bestimmen, können Sie mit Unsicherheiten und komplexen rechtlichen Fragen konfrontiert werden. Eine sorgfältige Prüfung des Prozessgeschehens und ein detailliertes Verständnis der Abläufe tragen wesentlich dazu bei, individuelle Risiken und Handlungsspielräume realistisch einzuschätzen.
Wir unterstützen Sie bei der Analyse Ihrer Situation und bei der Bewertung Ihrer nächsten Schritte. Mit einer transparenten und strukturierten Beratung helfen wir Ihnen dabei, Ihr Anliegen fundiert zu beleuchten und darüber nachzudenken, welche Maßnahme in Ihrer Situation zielführend sein könnte.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Fristen sind bei einer Abmahnung als angemessen anzusehen?
Bei einer Abmahnung gelten je nach Rechtsgebiet und Situation unterschiedliche Fristen als angemessen.
Fristen im Wettbewerbsrecht
Im gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht liegt die angemessene Frist zwischen 5 und 14 Tagen. Eine Frist von einer Woche bis zehn Tagen wird bei typischen wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, etwa bei irreführender Werbung, als ausreichend angesehen.
Besondere Dringlichkeit
In Fällen besonderer Dringlichkeit oder bei Gefahr im Verzug können auch deutlich kürzere Fristen zulässig sein. Bei besonders eilbedürftigen Fällen können sogar Fristen von wenigen Stunden angemessen sein, etwa bei:
- Präsentation von Markenplagiaten auf einer kurzzeitigen Messe
- Schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen
Arbeitsrechtliche Abmahnungen
Im Arbeitsrecht gibt es keine gesetzlich festgelegten Fristen. Das Bundesarbeitsgericht fordert lediglich eine „zeitnahe“ Abmahnung, die in der Regel innerhalb von zwei Wochen erfolgen sollte. Bei notwendigen Ermittlungen des Arbeitgebers kann sich diese Frist entsprechend verlängern.
Rechtliche Konsequenzen zu kurzer Fristen
Eine zu kurz bemessene Frist macht die Abmahnung nicht unwirksam. Stattdessen wird sie automatisch durch eine angemessene Frist ersetzt. Der Abgemahnte muss in einer angemessenen Zeit reagieren, ist aber nicht an zu kurze Fristen gebunden.
Angemessenheitskriterien
Die Angemessenheit einer Frist bemisst sich danach, ob dem Abgemahnten ausreichend Zeit bleibt:
- Die Abmahnung auf ihre Begründetheit zu überprüfen
- Sich rechtlich beraten zu lassen
- Eine fundierte Entscheidung zu treffen
Die konkrete Fristbemessung hängt vom Einzelfall ab, wobei die ab Zugang der Abmahnung verbleibende Zeit maßgeblich ist.
Was bedeutet ein Prozessuales Anerkenntnis für die Kostenverteilung?
Ein prozessuales Anerkenntnis ist eine Erklärung der beklagten Partei vor Gericht, mit der sie den geltend gemachten Anspruch als berechtigt anerkennt. Die Kostenverteilung richtet sich dabei nach zwei zentralen Vorschriften:
Grundregel der Kostentragung
Wenn Sie als beklagte Partei den Anspruch anerkennen, müssen Sie als unterliegende Partei nach § 91 ZPO grundsätzlich die Kosten des Rechtsstreits tragen. Dies umfasst sowohl die Gerichtskosten als auch die Anwaltskosten der Gegenseite.
Kostenprivilegierung bei sofortigem Anerkenntnis
Eine wichtige Ausnahme besteht, wenn Sie zwei Voraussetzungen erfüllen:
1. Sofortiges Anerkenntnis: Sie müssen den Anspruch bei der ersten sich bietenden prozessualen Möglichkeit anerkennen. Dies kann im frühen ersten Termin oder in der Klageerwiderung erfolgen.
2. Keine Klageveranlassung: Sie dürfen durch Ihr vorprozessuales Verhalten keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben haben.
Praktische Bedeutung
Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung versehentlich nicht bezahlt haben und der Gläubiger sofort Klage erhebt, ohne Sie vorher zu mahnen, können Sie durch ein sofortiges Anerkenntnis im ersten Termin die Kostenlast auf den Kläger abwälzen.
Bei einer Geldschuld ist zu beachten: Befinden Sie sich bereits im Verzug, haben Sie grundsätzlich Veranlassung zur Klage gegeben. In diesem Fall hilft auch ein sofortiges Anerkenntnis nicht, die Kostenlast zu vermeiden.
Die Kostenentscheidung bei einem Anerkenntnisurteil kann isoliert mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden. Dies ermöglicht eine separate Überprüfung der Kostenentscheidung, ohne das gesamte Urteil anzugreifen.
Wann ist ein Eilantrag vor Gericht wirklich eilbedürftig?
Ein Eilantrag ist dann wirklich eilbedürftig, wenn durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts vereitelt oder dessen Durchsetzung wesentlich erschwert würde.
Voraussetzungen der Eilbedürftigkeit
Die Dringlichkeit muss objektiv begründet sein. Das bedeutet, es muss eine konkrete Gefahr bestehen, dass ohne eine schnelle gerichtliche Entscheidung ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen würde.
Die Unzumutbarkeit des normalen Verfahrens spielt eine zentrale Rolle. Wenn Sie auf den regulären Rechtsweg verwiesen werden könnten, ohne dass dadurch erhebliche Nachteile entstehen, liegt keine echte Eilbedürftigkeit vor.
Zeitliche Aspekte
Die Gerichte prüfen bei der Beurteilung der Eilbedürftigkeit besonders das zeitliche Verhalten:
Schnelles Handeln ist erforderlich. Nach der Rechtsprechung wird bei einer Untätigkeit von mehr als 6-8 Wochen nach Kenntniserlangung vom Rechtsverstoß die Dringlichkeit in der Regel verneint.
Nach einer Abmahnung sollten Sie noch zügiger handeln. Ein Zeitraum von etwa 2 Wochen nach Zurückweisung der Abmahnung bis zur Antragstellung wird als angemessen angesehen.
Glaubhaftmachung der Eilbedürftigkeit
Die Eilbedürftigkeit müssen Sie dem Gericht nachvollziehbar darlegen. Dafür können Sie verschiedene Beweismittel nutzen, etwa:
- Eine eidesstattliche Versicherung
- Vorliegende Dokumente und Unterlagen
- Konkrete Nachweise der drohenden Gefahr
Wichtig: Die Gerichte prüfen die Eilbedürftigkeit von Amts wegen. Dabei wägen sie die Interessen beider Parteien gegeneinander ab. Eine bloße Behauptung der Dringlichkeit reicht nicht aus – die konkreten Umstände müssen eine schnelle gerichtliche Entscheidung tatsächlich erforderlich machen.
Ab welchem Zeitpunkt beginnt die Frist für ein sofortiges Anerkenntnis?
Fristbeginn im schriftlichen Vorverfahren
Die Frist für ein sofortiges Anerkenntnis beginnt mit der Zustellung der Klage und der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens nach § 276 ZPO. Das Gericht setzt dabei zwei wichtige Fristen:
- Eine zweiwöchige Notfrist zur Anzeige der Verteidigungsbereitschaft
- Eine weitere zweiwöchige Frist für die Klageerwiderung
Zeitliche Anforderungen
Ein Anerkenntnis gilt als „sofort“ wenn es innerhalb der Klageerwiderungsfrist erklärt wird. Dabei müssen zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein:
- In der Verteidigungsanzeige darf kein klageabweisender Antrag angekündigt worden sein
- Der Beklagte darf dem Klageanspruch nicht auf andere Weise entgegengetreten sein
Besondere Konstellationen
Bei einem erst im Verfahren schlüssig gewordenen Anspruch beginnt die Frist neu. In diesem Fall muss das Anerkenntnis nach einer angemessenen Prüfungsfrist erfolgen. Die Rechtsprechung sieht hier unterschiedliche Zeiträume als angemessen an:
- Maximal vier bis sechs Wochen zur Prüfung komplexerer Sachverhalte
- In einfachen Fällen etwa 12 Tage
Auswirkungen der Fristversäumung
Wird die Frist versäumt, verliert der Beklagte die Kostenprivilegierung nach § 93 ZPO. Dies gilt auch dann, wenn der Beklagte zunächst einen klageabweisenden Antrag angekündigt hat und erst später anerkennt. Die fehlende Erfüllung einer Geldforderung hindert dagegen nicht daran, ein Anerkenntnis als „sofort“ zu qualifizieren.
Welche Vor- und Nachteile hat ein vorgerichtliches Anerkenntnis gegenüber einem gerichtlichen?
Vorgerichtliches Anerkenntnis
Ein vorgerichtliches Anerkenntnis stellt einen schuldrechtlichen Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger dar und führt zu einer eigenständigen einseitigen Verpflichtung. Diese ist vom ursprünglichen Kausalgeschäft losgelöst und begründet eine neue Verbindlichkeit.
Der wesentliche Vorteil liegt in der Vermeidung von Gerichtskosten. Wenn Sie vorgerichtlich anerkennen, sparen Sie die Kosten eines Gerichtsverfahrens. Zudem können Sie durch ein vorgerichtliches Anerkenntnis eine schnellere Einigung erzielen.
Gerichtliches Anerkenntnis
Das prozessuale Anerkenntnis ist eine einseitige Prozesshandlung, die dem Gericht gegenüber erklärt wird. Es führt unmittelbar zu einem Anerkenntnisurteil, das ohne weitere inhaltliche Prüfung ergeht.
Ein wichtiger Vorteil des gerichtlichen Anerkenntnisses liegt in der Kostenprivilegierung nach § 93 ZPO. Wenn Sie sofort anerkennen und keine Veranlassung zur Klage gegeben haben, trägt der Kläger die Prozesskosten.
Rechtliche Unterschiede
Das gerichtliche Anerkenntnis ist bedingungsfeindlich und unwiderruflich. Im Gegensatz dazu kann das vorgerichtliche Anerkenntnis unter bestimmten Voraussetzungen angefochten werden.
Das prozessuale Anerkenntnis erfordert die Postulationsfähigkeit des Erklärenden. Bei Anwaltszwang muss ein Rechtsanwalt das Anerkenntnis erklären. Das vorgerichtliche Anerkenntnis können Sie hingegen ohne anwaltliche Vertretung erklären.
Ein gerichtliches Anerkenntnis führt zu einem vollstreckbaren Titel. Das vorgerichtliche Anerkenntnis verschafft dem Gläubiger hingegen noch keinen Vollstreckungstitel – hierfür müsste erst geklagt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Prozessuales Anerkenntnis
Ein prozessuales Anerkenntnis ist eine einseitige Prozesshandlung des Beklagten, mit der dieser den gegen ihn geltend gemachten Anspruch in vollem Umfang als berechtigt anerkennt. Diese Erklärung führt unmittelbar zum Prozessgewinn des Klägers durch Anerkenntnisurteil. Nach § 93 ZPO können die Kosten dem Kläger auferlegt werden, wenn der Beklagte nicht Anlass zur Klageerhebung gegeben hat.
Beispiel: Der Beklagte erkennt sofort nach Erhalt der Klageschrift die Forderung an, weil er vorher keine Gelegenheit hatte, den Anspruch zu prüfen.
Einlassung
Die Einlassung bezeichnet die erste inhaltliche Stellungnahme des Beklagten zur Klage im Gerichtsverfahren. Mit der Einlassung nimmt der Beklagte zum Klagevorbringen Stellung und bringt seine Verteidigung vor. Die Einlassung ist ein wichtiger prozessualer Schritt, der bestimmte Rechtsfolgen auslöst und Einwendungen gegen die Zuständigkeit des Gerichts ausschließen kann.
Beispiel: Nach Erhalt der Klageschrift reicht der Beklagte einen Schriftsatz ein, in dem er die Vorwürfe bestreitet und Gegenargumente vorbringt.
Streitwert
Der Streitwert ist der in Geld ausgedrückte Wert des Streitgegenstandes eines Gerichtsverfahrens. Er ist maßgeblich für die Höhe der Gerichtskosten und Anwaltsgebühren gemäß §§ 3-9 ZPO. Bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten wird der Streitwert durch das Gericht nach billigem Ermessen festgesetzt.
Beispiel: Bei einer Unterlassungsklage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung setzt das Gericht den Streitwert auf 30.000 Euro fest.
Ordnungsgeld
Das Ordnungsgeld ist ein gerichtliches Zwangsmittel, das bei Verstößen gegen gerichtliche Anordnungen, insbesondere bei Unterlassungsverfügungen, verhängt werden kann. Es dient der Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen gemäß § 890 ZPO. Die Höhe kann bis zu 250.000 Euro betragen.
Beispiel: Verstößt jemand gegen eine gerichtliche Unterlassungsverfügung, kann das Gericht ein Ordnungsgeld von 5.000 Euro verhängen.
Abhilfefrist
Die Abhilfefrist bezeichnet den Zeitraum, der dem Abgemahnten eingeräumt wird, um auf eine Abmahnung zu reagieren und den beanstandeten Zustand zu beseitigen. Die Frist muss angemessen sein und dem Abgemahnten eine realistische Chance zur Prüfung und Reaktion geben.
Beispiel: Eine Abhilfefrist von nur einem Tag über ein Wochenende ist unangemessen kurz, da keine ausreichende Prüfungsmöglichkeit besteht.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 307 ZPO: Diese Vorschrift regelt das Anerkenntnisurteil, bei dem der Beklagte den Anspruch des Klägers anerkennt, wodurch das Gericht das Urteil ohne weitere Prüfung erlässt. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin den Anspruch des Antragstellers mit ihrem Schriftsatz vom 14.01.2025 anerkannt, was zur Erlassung eines Anerkenntnisurteils führte.
- § 93 ZPO: Bestimmt die Kostenentscheidung im Verfahren, wonach der Kläger die Kosten trägt, wenn der Beklagte den Anspruch unverzüglich anerkannt hat und keine Veranlassung zur Klageerhebung bestand. Hier hat das Gericht festgestellt, dass die Antragsgegnerin den Anspruch sofort nach Kenntnisnahme anerkannt hat, weshalb der Antragsteller die Kosten des Rechtsstreits tragen muss.
- § 53 Abs. 1 Nr. 1 GKG: Legt die Bestimmung des Streitwertes fest, der Grundlage für die Gerichts- und Anwaltskosten ist. In diesem Fall wurde der Streitwert auf 30.000 Euro festgesetzt, was die Höhe der möglichen Ordnungsgelder und sonstigen Kosten bestimmt.
- Einstweilige Verfügungen gemäß ZPO: Diese gesetzlichen Regelungen ermöglichen es, schnelle gerichtliche Maßnahmen zu ergreifen, um vorläufige Rechte zu sichern. Das Gericht hat eine einstweilige Verfügung erlassen, um die Antragsgegnerin dazu zu verpflichten, bestimmte Äußerungen gegenüber dem Antragsteller zu unterlassen.
- § 1004 BGB: Regelt den Unterlassungsanspruch bei Verletzung von Eigentums- oder Persönlichkeitsrechten. Dieser Paragraph bildet die Grundlage für den Unterlassungsanspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin, die im Urteil unterlassen werden soll, bestimmte Äußerungen zu verbreiten.
Das vorliegende Urteil
LG Berlin II – Az.: 27 O 351/24 – Urteil vom 23.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.