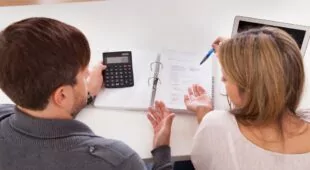Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Rechtliche Konsequenzen bei eBay-Käufen: Gewährleistung und Schadensersatz im Fokus
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Pflichten hat ein Verkäufer beim Weiterverkauf einer nicht abgenommenen Ware?
- Was passiert, wenn der Käufer grundlos vom Kaufvertrag zurücktritt?
- Wie berechnet sich der Schadensersatz bei einem Deckungsverkauf?
- Wann muss sich ein Verkäufer einen höheren möglichen Verkaufserlös anrechnen lassen?
- Welche Verkaufswege muss ein Verkäufer beim Deckungsverkauf nutzen?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Saarbrücken
- Datum: 16.03.2018
- Aktenzeichen: 10 S 41/17
- Verfahrensart: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Kaufrecht, Vertragsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Verkäufer eines Flügels. Der Kläger argumentierte, dass der Beklagte unberechtigt vom Vertrag zurückgetreten sei und beanspruchte den restlichen Kaufpreis in Höhe von 1.500 €, Lagergebühren von 100 € und Aufwendungen für den Schriftverkehr von 150 €, insgesamt also 1.750 €.
- Beklagter: Käufer des Flügels. Der Beklagte behauptete, er habe den Kauf wegen fehlender Informationen über Maße und Gewicht nicht erfüllen können und dass dem Kläger kein Schaden entstanden sei, da er den Flügel zurückerwarb und erneut verkaufte.
Um was ging es?
- Sachverhalt: Der Beklagte kaufte über eBay von dem Kläger einen Flügel für 2.300 €. Der Beklagte trat jedoch kurz darauf vom Kauf zurück, worauf der Kläger den Flügel für 800 € verkaufte. Der Streit drehte sich um die Zahlung des ursprünglichen Kaufpreises.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging darum, ob dem Kläger ein Anspruch auf die Zahlung des restlichen Kaufpreises zusteht, trotz des Rücktritts des Beklagten und der niedrigeren Verkaufssumme durch den Deckungsverkauf.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Berufung des Beklagten hatte Erfolg; das Gericht wies die Klage ab, womit der Kläger keine weiteren Ansprüche gegen den Beklagten auf Zahlung des restlichen Kaufpreises geltend machen konnte.
- Begründung: Der Kläger habe den Flügel böswillig unter dem Wert verkauft und dabei eine ertragreichere Verkaufsform unterlassen, die ihm angesichts der Umstände zumutbar gewesen wäre. Deshalb musste er sich den niedrigeren Erlös anrechnen lassen, obwohl der Beklagte initial den Vertrag nicht erfüllt hatte.
- Folgen: Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits, und das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Eine Revision wurde nicht zugelassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hatte.
Rechtliche Konsequenzen bei eBay-Käufen: Gewährleistung und Schadensersatz im Fokus
Beim Erwerb von Waren über Plattformen wie eBay greifen Käufer und Verkäufer auf ein rechtlich bindendes Vertragsverhältnis zurück, das den eBay-Kaufvertrag definiert. Bei Problemen können unterschiedliche Aspekte des Verbraucherrechts und der rechtlichen Grundlagen des Online-Kaufrechts eine Rolle spielen, etwa bei der Abwicklung von Käufen oder beim Rücktritt vom Kaufvertrag. Insbesondere spielen Regelungen zur Gewährleistung und die spezifischen eBay-Richtlinien eine entscheidende Rolle, wenn es um Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen geht.
Ein zentrales Thema, das oft Streitfälle rund um eBay prägt, ist die Anrechnung eines fiktiven Erlöses aus einem unterlassenen Deckungsverkauf. Die Komplexität dieses Themas erfordert ein genaues Verständnis der Grundlagen, um die rechtlichen Implikationen und die Auswirkungen auf Käufer und Verkäufer zu erkennen. Im Folgenden wird ein konkreter Fall vorgestellt, der diese Fragen beleuchtet und die beteiligten rechtlichen Aspekte analysiert.
Der Fall vor Gericht
Streitfall über Online-Flügelkauf: Schaden durch nicht optimalen Deckungsverkauf

Der Rechtsstreit zwischen einem privaten Verkäufer und dem Käufer eines Klavierflügels der Marke Bechstein zeigt die rechtlichen Folgen einer unberechtigten Verweigerung des Kaufvertrags bei gleichzeitig nicht optimaler Schadensbegrenzung durch den Verkäufer. Das Landgericht Saarbrücken entschied am 16. März 2018, dass der Verkäufer seinen Anspruch auf den Differenzbetrag zwischen ursprünglichem und späterem Verkaufspreis vollständig verliert, wenn er bei der Weiterveräußerung der Ware nicht alle erfolgversprechenden Verkaufswege nutzt.
Vertragliche Bindung und unbegründeter Rücktritt
Der Beklagte erwarb am 23. Februar 2016 über die Online-Plattform eBay einen Flügel zum Preis von 2.300 Euro im Wege des Sofortkaufs. Bereits am nächsten Tag erklärte er per E-Mail, er habe sich getäuscht und trete vom Kauf zurück. Eine wirksame Anfechtung des Kaufvertrags lag nach Ansicht des Gerichts nicht vor, da der Käufer keinen Anfechtungsgrund darlegte. Auch ein Rücktrittsrecht stand ihm nicht zu, da weder ein Sachmangel vorlag noch der Verkäufer seine vertraglichen Pflichten verletzt hatte.
Weiterverkauf unter Wert
Nach der Weigerung des Käufers, den Flügel abzunehmen, verkaufte der Kläger das Instrument am 3. März 2016 für 800 Euro an einen spontanen Kaufinteressenten. Der Verkäufer verzichtete dabei darauf, den Flügel erneut über eBay anzubieten, obwohl derselbe Flügel wenige Tage später über diese Plattform wieder für 2.300 Euro verkauft wurde. Der Kläger forderte daraufhin vom ursprünglichen Käufer die Differenz von 1.500 Euro.
Rechtliche Bewertung des Gerichts
Das Landgericht stellte fest, dass der Verkäufer nach § 326 Abs. 2 Satz 2 BGB verpflichtet war, einen möglichst hohen Erlös beim Weiterverkauf zu erzielen. Der sofortige Verkauf zu einem deutlich niedrigeren Preis ohne Nutzung der ursprünglichen, nachweislich erfolgreicheren Verkaufsplattform stelle ein „Böswilliges Unterlassen„ dar. Dies führe dazu, dass der Verkäufer sich den theoretisch erzielbaren höheren Verkaufspreis anrechnen lassen müsse. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass bei einer erneuten Nutzung von eBay ein Verkaufspreis von 2.300 Euro realistisch gewesen wäre, da dieser Preis für denselben Flügel innerhalb kurzer Zeit zweimal erzielt wurde.
Rechtsfolgen der Entscheidung
Die Klage des Verkäufers auf Zahlung der Preisdifferenz wurde vollständig abgewiesen. Das Gericht betonte, dass ein Verkäufer bei der Durchführung eines Deckungsverkaufs nach Möglichkeit die Bedingungen des gescheiterten Geschäfts einhalten muss. Die bewusste Wahl eines anderen, weniger erfolgversprechenden Verkaufswegs führe zum Verlust des Anspruchs auf Schadensersatz.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil stellt klar, dass ein Verkäufer bei einem Notverkauf nach Nichtabnahme der Ware die bestmögliche Verkaufsform wählen muss, um einen angemessenen Preis zu erzielen. Ein deutlich unter Wert erfolgter Privatverkauf ist nicht ausreichend, wenn durch andere Verkaufswege (wie eBay) nachweislich ein höherer Erlös hätte erzielt werden können. Der Verkäufer muss sich in solchen Fällen den höheren fiktiven Erlös auf seinen Schadensersatzanspruch anrechnen lassen.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Sie als Online-Verkäufer nach einer Kaufvertragsverletzung die Ware anderweitig verkaufen müssen, sind Sie verpflichtet, einen möglichst hohen Verkaufspreis anzustreben. Verkaufen Sie beispielsweise einen Artikel für 800€ privat, obwohl Sie nachweislich auf eBay 2.300€ erzielen könnten, müssen Sie sich die Differenz anrechnen lassen. Als Käufer bedeutet dies umgekehrt, dass Sie bei einer unberechtigten Vertragsverweigerung nur für den tatsächlichen Schaden haften, den der Verkäufer trotz bestmöglicher Schadenminderung erleidet.
Sicherer Umgang mit Deckungsverkäufen
Das Urteil des Landgerichts Saarbrücken zeigt, wie wichtig die richtige Vorgehensweise beim Deckungsverkauf ist, um Ihre Rechte als Verkäufer zu wahren. Die Wahl des Verkaufswegs und die Nachweispflicht über den erzielten Preis können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Gerade bei Unsicherheiten im Umgang mit Schadensersatzforderungen nach einem gescheiterten Online-Verkauf ist es ratsam, sich rechtlich absichern zu lassen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Ansprüche optimal durchzusetzen oder ungerechtfertigte Forderungen abzuwehren.
✅ Fordern Sie unsere Ersteinschätzung an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Pflichten hat ein Verkäufer beim Weiterverkauf einer nicht abgenommenen Ware?
Wenn Sie als Verkäufer eine Ware weiterverkaufen möchten, die vom ursprünglichen Käufer nicht abgenommen wurde, müssen Sie einige wichtige Pflichten beachten:
Schadensminderungspflicht
Als Verkäufer sind Sie verpflichtet, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet, Sie müssen beim Weiterverkauf einen angemessenen Preis erzielen. Verkaufen Sie die Ware deutlich unter Wert, riskieren Sie, dass Sie die Differenz zum ursprünglichen Kaufpreis nicht als Schadensersatz geltend machen können.
Angemessene Verkaufsbemühungen
Sie müssen sich ernsthaft um einen Weiterverkauf zu marktüblichen Konditionen bemühen. Dazu gehört, dass Sie:
- Die Ware in einem angemessenen Zeitraum anbieten
- Geeignete Verkaufsplattformen nutzen
- Einen realistischen Preis ansetzen
Wenn Sie beispielsweise einen auf eBay nicht abgenommenen Artikel offline zu einem deutlich niedrigeren Preis verkaufen, obwohl online ein höherer Preis erzielbar wäre, kann dies als unzureichender Deckungsverkauf gewertet werden.
Dokumentation des Weiterverkaufs
Dokumentieren Sie den Weiterverkaufsprozess sorgfältig. Notieren Sie, wann und wo Sie die Ware angeboten haben, zu welchem Preis und welche Resonanz Sie erhalten haben. Diese Informationen können wichtig sein, falls der ursprüngliche Käufer den Schadensersatz anfechten sollte.
Fristsetzung und Rücktritt
Bevor Sie die Ware weiterverkaufen, sollten Sie dem ursprünglichen Käufer eine angemessene Frist zur Abnahme und Zahlung setzen. Verstreicht diese Frist fruchtlos, können Sie vom Vertrag zurücktreten und die Ware anderweitig veräußern.
Berücksichtigung des Käuferinteresses
Beim Weiterverkauf müssen Sie auch die Interessen des ursprünglichen Käufers im Blick behalten. Verkaufen Sie die Ware vorschnell oder zu einem unangemessen niedrigen Preis, kann der Käufer argumentieren, dass Sie seine Interessen nicht ausreichend berücksichtigt haben.
Wenn Sie diese Pflichten beachten, stellen Sie sicher, dass Sie beim Weiterverkauf einer nicht abgenommenen Ware rechtlich auf der sicheren Seite sind und Ihre Ansprüche auf Schadensersatz wahren können.
Was passiert, wenn der Käufer grundlos vom Kaufvertrag zurücktritt?
Ein grundloser Rücktritt vom Kaufvertrag ist rechtlich nicht zulässig. Wenn Sie als Käufer ohne berechtigten Grund vom Vertrag zurücktreten, kann dies erhebliche Konsequenzen haben.
Vertragliche Bindung bleibt bestehen
Zunächst einmal bleibt der Kaufvertrag trotz Ihres Rücktrittswunsches weiterhin gültig. Der Verkäufer kann auf die Erfüllung des Vertrages bestehen und die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verlangen. Dies gilt insbesondere bei eBay-Auktionen, wo ein verbindlicher Kaufvertrag zustande kommt, sobald Sie als Höchstbietender den Zuschlag erhalten haben.
Mögliche Schadensersatzansprüche
Sollten Sie als Käufer den Vertrag nicht erfüllen, kann der Verkäufer Schadensersatz geltend machen. Dies kann verschiedene Formen annehmen:
- Entgangener Gewinn: Wenn der Verkäufer durch Ihren Rücktritt einen Gewinn verliert, kann er diesen von Ihnen ersetzt verlangen.
- Aufwendungsersatz: Kosten, die dem Verkäufer im Vertrauen auf den Vertrag entstanden sind, können Ihnen in Rechnung gestellt werden.
- Wertverlust: Sollte der Kaufgegenstand an Wert verloren haben, können Sie dafür haftbar gemacht werden.
Besonderheiten bei Online-Käufen
Bei Online-Käufen von gewerblichen Händlern haben Sie als Verbraucher in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Dieses Recht erlaubt es Ihnen, den Kauf ohne Angabe von Gründen rückgängig zu machen. Beachten Sie jedoch:
- Das Widerrufsrecht gilt nur bei Käufen von gewerblichen Verkäufern, nicht bei Privatverkäufen.
- Es gibt Ausnahmen, bei denen kein Widerrufsrecht besteht, z.B. bei Sonderanfertigungen oder verderblichen Waren.
Folgen eines unberechtigten Rücktritts
Wenn Sie außerhalb der Widerrufsfrist oder bei nicht widerrufbaren Käufen grundlos vom Vertrag zurücktreten, können folgende Konsequenzen eintreten:
- Der Verkäufer kann auf Vertragserfüllung bestehen und den vollen Kaufpreis verlangen.
- Er kann vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz fordern, z.B. für entgangenen Gewinn oder Aufwendungen.
- Bei eBay-Käufen können zusätzlich negative Bewertungen oder Accountsperren drohen.
Bedenken Sie, dass ein Kaufvertrag eine rechtlich bindende Vereinbarung ist. Ein grundloser Rücktritt kann nicht nur finanzielle Folgen haben, sondern auch Ihr Ansehen als zuverlässiger Käufer beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, Kaufentscheidungen sorgfältig zu überdenken und nur dann einen Vertrag abzuschließen, wenn Sie ihn auch erfüllen können und wollen.
Wie berechnet sich der Schadensersatz bei einem Deckungsverkauf?
Der Schadensersatz bei einem Deckungsverkauf berechnet sich grundsätzlich aus der Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten Kaufpreis und dem Preis des Deckungsgeschäfts.
Grundprinzip der Berechnung
Wenn Sie als Käufer ein Ersatzgeschäft tätigen müssen, weil der Verkäufer nicht liefert, können Sie die Mehrkosten des Deckungskaufs als Schaden geltend machen. Diese Berechnung erfolgt nach dem Prinzip der konkreten Schadensberechnung, bei der der tatsächlich entstandene Schaden ersetzt wird.
Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit
Der Deckungskauf muss in angemessener Weise und innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Vertragsaufhebung erfolgen. Dabei müssen Sie als geschädigte Partei nachweisen können, dass Sie einen gleichwertigen Ersatz beschafft haben.
Besonderheiten bei Online-Käufen
Bei Verkäufen über Online-Plattformen wie eBay gilt eine wichtige Besonderheit: Der Verkäufer muss bei einem Deckungsverkauf die erfolgversprechendste Verkaufsform wählen. Wenn Sie beispielsweise als Verkäufer einen Artikel offline zu einem niedrigeren Preis verkaufen, obwohl online ein höherer Preis erzielbar gewesen wäre, kann dies Ihren Schadensersatzanspruch mindern oder ausschließen.
Umfang des Schadensersatzes
Der Schadensersatz umfasst nicht nur die reine Preisdifferenz, sondern kann auch weitere Schäden einschließen, die durch das Deckungsgeschäft entstanden sind. Wichtig ist jedoch: Sie können nicht gleichzeitig die Erfüllung des ursprünglichen Vertrags und den Ersatz der Mehrkosten aus dem Deckungsgeschäft verlangen.
Wann muss sich ein Verkäufer einen höheren möglichen Verkaufserlös anrechnen lassen?
Bei einem Deckungsverkauf muss sich ein Verkäufer einen höheren möglichen Verkaufserlös anrechnen lassen, wenn er zumutbare und erfolgversprechende Verkaufsmöglichkeiten nicht nutzt. Dies gilt insbesondere dann, wenn der ursprüngliche Verkauf über eBay erfolgte.
Anforderungen an den Deckungsverkauf
Ein Verkäufer ist verpflichtet, beim Deckungsverkauf die gleiche Verkaufsplattform zu nutzen, über die der ursprüngliche Verkauf stattfand. Wenn Sie also einen Artikel zunächst über eBay verkauft haben, müssen Sie auch den Deckungsverkauf über eBay durchführen, da diese Plattform eine deutschlandweite Reichweite bietet und üblicherweise höhere Verkaufserlöse erzielt.
Kriterien für die Anrechnung fiktiver Erlöse
Ein fiktiver höherer Erlös wird angerechnet, wenn:
- Der Verkäufer ohne sachlichen Grund eine weniger erfolgversprechende Verkaufsmethode wählt
- Der Verkäufer ein deutlich zu niedriges Angebot vorschnell annimmt
- Der tatsächlich erzielte Verkaufspreis erheblich unter dem marktüblichen Wert liegt
Rechtliche Konsequenzen
Wenn Sie als Verkäufer diese Kriterien nicht beachten, können Sie sich im Rahmen der Schadensberechnung nicht auf den niedrigeren tatsächlich erzielten Verkaufserlös berufen. Stattdessen wird der nachweisbar erzielbare höhere Verkaufspreis als Berechnungsgrundlage herangezogen. Dies bedeutet konkret: Verkaufen Sie beispielsweise eine Ware offline für 800 Euro, obwohl Sie bei eBay nachweislich 2.300 Euro hätten erzielen können, müssen Sie sich die Differenz von 1.500 Euro anrechnen lassen.
Welche Verkaufswege muss ein Verkäufer beim Deckungsverkauf nutzen?
Ein Verkäufer muss beim Deckungsverkauf in angemessener Weise vorgehen und sich dabei an den Bedingungen des ursprünglichen, gescheiterten Geschäfts orientieren.
Anforderungen an den Verkaufsweg
Der Verkäufer ist verpflichtet, den bestmöglichen Verkaufserlös zu erzielen. Wenn Sie als Verkäufer einen Deckungsverkauf vornehmen, müssen Sie sich dabei an folgende Grundsätze halten:
- Der Verkauf muss innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Vertragsaufhebung erfolgen.
- Die Verkaufsbedingungen sollten möglichst nah an den ursprünglichen Konditionen liegen.
- Der neue Verkaufspreis muss marktgerecht sein.
Rechtliche Konsequenzen
Wenn Sie als Verkäufer diese Anforderungen nicht beachten, kann dies erhebliche rechtliche Folgen haben:
Der Verkäufer kann nur den tatsächlich entstandenen Schaden geltend machen, der durch einen ordnungsgemäß durchgeführten Deckungsverkauf entstanden ist. Ein voreiliger oder zu einem unangemessen niedrigen Preis durchgeführter Deckungsverkauf kann dazu führen, dass der Verkäufer den Preisunterschied nicht vollständig ersetzt bekommt.
Praktische Durchführung
Bei der Wahl des Verkaufsweges sollten Sie als Verkäufer erfolgversprechende Vertriebswege nutzen. Der Verkauf sollte über Kanäle erfolgen, die:
- Eine angemessene Marktreichweite gewährleisten
- Dem Warenwert und der Art der Ware entsprechen
- Eine zeitnahe Veräußerung ermöglichen
Die gewählte Verkaufsmethode muss dabei nicht identisch mit dem ursprünglichen Verkaufsweg sein, solange sie angemessen ist und zu einem marktgerechten Preis führt.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Deckungsverkauf
Ein Deckungsverkauf ist der Weiterverkauf einer Ware durch den Verkäufer, nachdem der ursprüngliche Käufer die Abnahme oder Zahlung verweigert hat. Der Verkäufer ist dabei nach § 254 BGB verpflichtet, den bestmöglichen Preis zu erzielen und alle erfolgversprechenden Verkaufswege zu nutzen. Verkauft er die Ware unter Wert, muss er sich den theoretisch erzielbaren höheren Preis anrechnen lassen. Beispiel: Wird ein Gegenstand zunächst für 1000€ auf eBay verkauft und nach Verweigerung des Käufers direkt für 400€ weiterverkauft, obwohl auf eBay 900€ erzielbar gewesen wären, verliert der Verkäufer seinen Anspruch auf die Differenz.
Anfechtung
Die Anfechtung ist die rechtliche Möglichkeit, eine Willenserklärung (z.B. einen Kaufvertrag) wegen eines Irrtums oder einer Täuschung für nichtig zu erklären. Sie ist in §§ 119 ff. BGB geregelt. Eine wirksame Anfechtung setzt einen gesetzlich anerkannten Anfechtungsgrund wie Irrtum, arglistige Täuschung oder Drohung voraus. Beispiel: Ein Käufer kann einen Kaufvertrag anfechten, wenn er sich über wesentliche Eigenschaften der Ware geirrt hat. Ein bloßer Sinneswandel oder Preisirrtum reicht jedoch nicht aus.
Rücktrittsrecht
Das Rücktrittsrecht ermöglicht es einer Vertragspartei, sich unter bestimmten Voraussetzungen vom Vertrag zu lösen. Es ist in §§ 346 ff. BGB geregelt und kann sich aus Gesetz (z.B. bei Mängeln) oder vertraglicher Vereinbarung ergeben. Bei Ausübung des Rücktritts müssen beide Parteien ihre bereits erhaltenen Leistungen zurückgewähren. Im Online-Handel besteht zusätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht für Verbraucher, das ohne Angabe von Gründen ausgeübt werden kann.
Böswilliges Unterlassen
Böswilliges Unterlassen bezeichnet im Schadensersatzrecht das bewusste Unterlassen von Handlungen zur Schadensbegrenzung. Nach § 254 BGB ist jede Partei verpflichtet, einen Schaden möglichst gering zu halten. Wer diese Pflicht verletzt, kann seinen Schadensersatzanspruch ganz oder teilweise verlieren. Ein Beispiel ist der Verkäufer, der bewusst einen ungünstigeren Verkaufsweg wählt, obwohl er weiß, dass er woanders einen höheren Preis erzielen könnte.
Fiktiver Erlös
Der fiktive Erlös ist der hypothetische Verkaufspreis, der bei optimaler Verkaufsstrategie hätte erzielt werden können. Er wird bei der Schadensberechnung berücksichtigt, wenn der tatsächliche Verkaufspreis durch schuldhaftes Verhalten des Verkäufers niedriger ausfällt. Geregelt ist dies in § 254 BGB (Mitverschulden). Beispiel: Verkauft jemand eine Ware für 500€, obwohl nachweislich 1000€ erzielbar gewesen wären, wird der fiktive Erlös von 1000€ bei der Schadensberechnung zugrunde gelegt.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 433 Abs. 2 BGB (Pflichten des Käufers im Kaufvertrag): Der Käufer ist verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. Dies umfasst auch die rechtzeitige Organisation der Abholung oder Lieferung des Kaufgegenstands. Im vorliegenden Fall ist zwischen den Parteien durch den Sofortkauf ein verbindlicher Kaufvertrag entstanden, der den Beklagten verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen und den Flügel abzunehmen.
- § 326 Abs. 2 Satz 2 BGB (Anrechnung eines fiktiven Erlöses bei böswilligem Unterlassen): Wenn der Verkäufer eine zumutbare Erwerbsmöglichkeit vorsätzlich auslässt, muss er sich den höheren fiktiven Erlös auf seinen Kaufpreisanspruch anrechnen lassen. Im vorliegenden Fall hat der Kläger den Flügel unter Marktwert verkauft, obwohl er durch den Verkauf über eBay nachweislich einen höheren Preis hätte erzielen können. Dieses Unterlassen wirkt sich negativ auf seinen Anspruch aus.
- § 323 Abs. 1 BGB (Rücktritt wegen nicht erfüllter Leistung): Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Verkäufer eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt und eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde. Der Beklagte konnte sich jedoch nicht auf ein Rücktrittsrecht berufen, da er keine Frist gesetzt hat und keine Pflichtverletzung des Klägers substantiiert nachgewiesen wurde.
- § 275 BGB (Befreiung von der Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit): Eine Leistungspflicht entfällt, wenn die Erfüllung unmöglich wird. Durch den Weiterverkauf des Flügels an einen Dritten konnte der Kläger die Übergabe an den ursprünglichen Käufer nicht mehr erfüllen. Der Beklagte muss jedoch darlegen, dass dies nicht durch sein Verhalten verursacht wurde.
- § 383 BGB (Selbsthilfeverkauf): Der Verkäufer kann eine nicht abgeholte Ware öffentlich versteigern, wenn der Käufer in Annahmeverzug gerät. Im vorliegenden Fall wurde kein öffentlicher Selbsthilfeverkauf durchgeführt. Stattdessen wurde der Flügel privat verkauft, was möglicherweise nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht und den Kläger in eine schwächere rechtliche Position versetzt hat.
Das vorliegende Urteil
LG Saarbrücken – Az.: 10 S 41/17 – Urteil vom 16.03.2018
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.