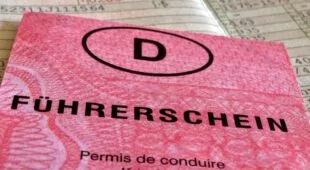Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Der Fall vor dem OLG Frankfurt: Streitwertberechnung bei Haupt- und Hilfsantrag
- Die Ausgangslage: Bauvertrag, Kündigung und Zahlungsstreit
- Haupt- und Hilfsantrag im Fokus
- Die Entscheidung des OLG Frankfurt: Identität des Streitgegenstands entscheidend
- Rechtliche Prüfung und Konsequenzen für die Streitwertfestsetzung
- Auswirkungen auf die Prozesskosten
- Bedeutung für ähnliche Fälle
- Anwaltsstrategien und Beweisführung
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wie berechnet sich der Streitwert bei Haupt- und Hilfsantrag?
- Was ist der Unterschied zwischen Haupt- und Hilfsantrag?
- Welche Kosten entstehen bei der Stellung von Haupt- und Hilfsanträgen?
- Wann macht die Stellung eines Hilfsantrags rechtlich Sinn?
- Welche Rechtsmittel gibt es gegen eine falsche Streitwertfestsetzung?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: OLG Frankfurt
- Datum: 30.01.2025
- Aktenzeichen: 20 W 1/25
- Verfahrensart: Beschwerdeverfahren zur Streitwertfestsetzung
- Rechtsbereiche: Werkvertragsrecht, Zivilprozessrecht
- Beteiligte Parteien:
- Klägerin: Ein Unternehmen aus den Bereichen Heizung, Sanitär, regenerative Energien sowie Klima & Lüftung, das ein Angebot zur Modernisierung der Wärmeversorgung unterbreitete und vertraglich vereinbarte Leistungen erbrachte, die zu Bauzeitverzögerungen führten.
- Beklagte: Eine Partei, die im Jahr 2023 ein Objekt modernisieren wollte, den Vertrag aufgrund von Verzögerungen kündigte, Abschlagszahlungen leistete und vorprozessual die Rückzahlung eines ermittelten Überzahlungsbetrages forderte.
- Um was ging es?
- Sachverhalt: Die Klägerin unterbreitete ein Angebot über 393.214,01 Euro, das von der Beklagten angenommen wurde. Nach Leistungserbringung kam es zu Bauzeitverzögerungen, wodurch der Vertrag gekündigt wurde. Es wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 275.249,81 Euro geleistet und Werkleistungen von mindestens 7.862,84 Euro erbracht. Zudem forderte die Beklagte vorprozessual die Rückzahlung von 267.386,97 Euro wegen vermeintlich zu hoher Zahlungen.
- Kern des Rechtsstreits: Es geht darum, wie der Streitwert der ersten Instanz unter Berücksichtigung der erbrachten Leistungen, geleisteten Abschlagszahlungen und der vorprozessual geltend gemachten Rückzahlungsforderung korrekt zu berechnen ist.
- Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Der Streitwert für die erste Instanz wurde auf 607.317,65 Euro festgesetzt; die Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei, und es erfolgt keine Kostenerstattung.
- Begründung: Die Berechnung des Streitwerts erfolgte unter Einbeziehung der vertraglich vereinbarten Leistungen, der bereits geleisteten Abschlagszahlungen sowie der vorprozessual erhobenen Rückzahlungsforderung.
- Folgen: Das festgesetzte Streitwertmaß dient als Basis für die weitere Kostenberechnung; es fallen keine Gerichtsgebühren an, und es erfolgt keine Erstattung von Kosten.
Der Fall vor Gericht
Der Fall vor dem OLG Frankfurt: Streitwertberechnung bei Haupt- und Hilfsantrag

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hatte sich in einem Beschluss vom 30. Januar 2025 (Az.: 20 W 1/25) mit der Frage der Streitwertberechnung in einem Fall zu befassen, in dem ein Hauptantrag und ein Hilfsantrag geltend gemacht wurden. Konkret ging es darum, ob diese Anträge bei der Berechnung des Streitwerts zusammengerechnet werden müssen, wenn sie denselben Streitgegenstand betreffen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Feinheiten des Prozessrechts und die Bedeutung einer korrekten Streitwertfestsetzung, da diese unmittelbar die Gerichts- und Anwaltskosten beeinflusst.
Die Ausgangslage: Bauvertrag, Kündigung und Zahlungsstreit
Die Klägerin, ein Unternehmen im Bereich Heizung, Sanitär und erneuerbare Energien, hatte der Beklagten ein Angebot zur Modernisierung der Wärmeversorgung in einem Objekt unterbreitet. Dieses Angebot über 393.214,01 Euro wurde von der Beklagten angenommen. Im Laufe der Leistungserbringung kam es zu Bauzeitverzögerungen, woraufhin die Beklagte den Vertrag kündigte. Die Beklagte hatte bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 275.249,81 Euro an die Klägerin geleistet. Die Klägerin wiederum argumentierte, dass sie Werkleistungen im Wert von mindestens 7.862,84 Euro erbracht habe.
Vor der Klageerhebung forderte die Beklagte die Klägerin auf, einen Betrag von 267.386,97 Euro zurückzuzahlen, da sie in dieser Höhe überbezahlt sei. Die Klägerin wies diese Forderung zurück und erhob Klage vor dem Landgericht Frankfurt.
Haupt- und Hilfsantrag im Fokus
Im Rahmen der Klage machte die Klägerin einen Hauptantrag auf Zahlung eines bestimmten Betrags geltend. Zusätzlich stellte sie einen Hilfsantrag, der auf die Feststellung gerichtet war, dass die Beklagte zur Zahlung eines weiteren Betrags verpflichtet sei, falls der Hauptantrag abgewiesen werden sollte. Das Landgericht setzte den Streitwert zunächst fest, wobei es den Wert des Hauptantrags und des Hilfsantrags addierte. Gegen diese Streitwertfestsetzung legte der Beklagtenvertreter Beschwerde beim OLG Frankfurt ein.
Die Entscheidung des OLG Frankfurt: Identität des Streitgegenstands entscheidend
Das OLG Frankfurt gab der Beschwerde des Beklagtenvertreters statt und änderte die Streitwertfestsetzung des Landgerichts ab. Kern der Entscheidung war die Feststellung, dass Hauptantrag und Hilfsantrag im vorliegenden Fall denselben Streitgegenstand betrafen.
Das Gericht argumentierte, dass eine Zusammenrechnung von Anträgen dann nicht zulässig ist, wenn die Anträge denselben wirtschaftlichen Gehalt haben. Dies sei der Fall, wenn der Hilfsantrag lediglich eine alternative Begründung für denselben Zahlungsanspruch darstellt.
Das OLG stellte klar, dass der Streitgegenstand durch den konkreten Anspruch bestimmt wird, der mit der Klage verfolgt wird. Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob die Beklagte zur Zahlung eines bestimmten Geldbetrags an die Klägerin verpflichtet ist. Ob dieser Anspruch auf der Grundlage eines bestimmten Vertrages oder einer anderen Rechtsgrundlage besteht, ist für die Bestimmung des Streitgegenstands unerheblich.
Rechtliche Prüfung und Konsequenzen für die Streitwertfestsetzung
Das Gericht führte eine umfassende rechtliche Prüfung der einschlägigen Vorschriften des Verfahrensrechts durch. Es stützte sich dabei auf die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Zusammenrechnung von Anträgen.
Das OLG betonte, dass eine gerichtliche Entscheidung über den Hilfsantrag nur dann erforderlich wird, wenn der Hauptantrag abgewiesen wird. In diesem Fall tritt der Hilfsantrag an die Stelle des Hauptantrags, sodass keine zusätzliche Belastung des Gerichts entsteht. Eine Zusammenrechnung der Werte beider Anträge würde daher zu einer ungerechtfertigten Erhöhung des Streitwerts und somit der Gerichts- und Anwaltskosten führen.
Auswirkungen auf die Prozesskosten
Durch die Entscheidung des OLG Frankfurt wurde der Streitwert für die erste Instanz auf 607.317,65 Euro festgesetzt. Diese Festsetzung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Gerichts- und Anwaltskosten, die von den Parteien zu tragen sind. Eine niedrigere Streitwertfestsetzung bedeutet in der Regel geringere Kosten für die Parteien.
Bedeutung für ähnliche Fälle
Die Entscheidung des OLG Frankfurt ist von Bedeutung für alle Fälle, in denen ein Hauptantrag und ein Hilfsantrag geltend gemacht werden, die denselben Streitgegenstand betreffen. Sie verdeutlicht, dass eine Zusammenrechnung von Anträgen in solchen Fällen nicht zulässig ist und dass der Streitwert anhand des wirtschaftlichen Interesses des Hauptantrags zu bestimmen ist. Dies dient dem Ziel, eine gerechte und angemessene Verteilung der Prozesskosten zu gewährleisten.
Anwaltsstrategien und Beweisführung
In vergleichbaren Fällen ist es für Anwälte ratsam, die Identität der Streitgegenstände genau zu prüfen und gegebenenfalls auf eine korrekte Streitwertfestsetzung hinzuwirken. Eine sorgfältige Beweisführung und eine überzeugende Darlegung der Rechtsposition sind entscheidend, um im Prozess erfolgreich zu sein. Vergleichsverhandlungen können zudem dazu beitragen, eine gütliche Einigung zu erzielen und die Prozesskosten zu minimieren.
Die Entscheidung des OLG Frankfurt zeigt, dass die Streitwertfestsetzung im Zivilprozess eine komplexe Materie sein kann, die eine sorgfältige rechtliche Prüfung erfordert. Sie verdeutlicht die Bedeutung des Streitgegenstands und die Grenzen der Zusammenrechnung von Anträgen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass bei Gerichtsverfahren mit mehreren Anträgen (Hauptantrag und Hilfsantrag) die Streitwerte addiert werden müssen, wenn diese unterschiedliche Gegenstände betreffen. Dies ist besonders relevant für die Berechnung der Anwaltsgebühren. Im vorliegenden Fall wurde der Streitwert deutlich nach oben korrigiert, da die negative Feststellungsklage und der Zahlungsantrag als separate Gegenstände betrachtet wurden.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Sie als Privatperson oder Unternehmen vor Gericht mehrere Anträge stellen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Gerichts- und Anwaltskosten haben. Stellen Sie beispielsweise einen Hauptantrag auf Feststellung und zusätzlich einen Hilfsantrag auf Zahlung, werden die Streitwerte möglicherweise addiert – was zu höheren Prozesskosten führt. Lassen Sie sich daher vor einer Klage von einem Anwalt beraten, um die möglichen Kostenrisiken richtig einzuschätzen. Bedenken Sie auch, dass die Wahl Ihrer Anträge direkten Einfluss auf die späteren Verfahrenskosten haben kann.
Benötigen Sie Hilfe?
Komplexe Streitwertberechnungen und strategische Entscheidungen
In Verfahren, in denen Haupt- und Hilfsanträge zum selben Streitgegenstand führen, ergeben sich häufig Fragen zur korrekten Bestimmung des Streitwerts. Solche Situationen können zu Unsicherheiten hinsichtlich der anfallenden Verfahren- und Anwaltskosten beitragen und bedürfen einer präzisen rechtlichen Analyse, um den zahlungstechnischen und strategischen Gehalt der Ansprüche klar zu erfassen.
Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, den konkreten Streitgegenstand sachgerecht zu analysieren und das geeignete Vorgehen abzuleiten. Mit einer fundierten Prüfung des Fallgeschehens helfen wir Ihnen, die wesentlichen Aspekte Ihres Rechtsanspruchs zu erkennen und Ihre Interessen zielgerichtet zu vertreten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie berechnet sich der Streitwert bei Haupt- und Hilfsantrag?
Der Streitwert bei Haupt- und Hilfsantrag richtet sich nach § 45 GKG und hängt maßgeblich davon ab, ob über den Hilfsantrag entschieden wurde und ob die Anträge wirtschaftlich gleichwertig sind.
Entscheidung nur über den Hauptantrag
Wenn nur über den Hauptantrag entschieden wird, entspricht der Streitwert ausschließlich dem Wert des Hauptantrags. Wenn Sie beispielsweise 1.000 Euro einklagen und hilfsweise die Herausgabe einer Sache verlangen, beträgt der Streitwert bei alleiniger Entscheidung über die Geldforderung nur 1.000 Euro.
Entscheidung über beide Anträge
Bei einer Entscheidung über beide Anträge ist die wirtschaftliche Betrachtungsweise entscheidend:
Wirtschaftlich verschiedene Anträge: Der Streitwert ergibt sich aus der Addition beider Werte, wenn Haupt- und Hilfsantrag wirtschaftlich unterschiedliche Interessen betreffen. Dies ist der Fall, wenn die Anträge sich nicht gegenseitig ausschließen.
Wirtschaftlich gleichwertige Anträge: Sind die Anträge wirtschaftlich gleichwertig, ist nur der höhere Wert maßgeblich. Dies tritt ein, wenn beide Anträge dasselbe wirtschaftliche Interesse verfolgen, wie etwa bei der Herausgabe einer Sache oder alternativ deren Wertersatz.
Praktische Berechnung
Streitwertformel bei verschiedenen Anträgen = Wert Hauptantrag + Wert Hilfsantrag
Die Zusammenrechnung erfolgt jedoch nur, wenn eine „wirtschaftliche Werthäufung“ vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Anträge nicht notwendigerweise einander ausschließen.
Was ist der Unterschied zwischen Haupt- und Hilfsantrag?
Ein Hilfsantrag ist eine zusätzliche Prozesshandlung zum Hauptantrag im Zivilprozess, die einen anderen Streitgegenstand betrifft. Stellen Sie sich vor, Sie möchten primär die Herausgabe eines Gegenstands erreichen, aber für den Fall, dass dies nicht möglich ist, alternativ Schadensersatz verlangen.
Arten von Hilfsanträgen
Echte Hilfsanträge werden für den Fall gestellt, dass der Hauptantrag erfolglos bleibt. Wenn Sie beispielsweise die Herausgabe Ihres Hundes verlangen, der zum Nachbarn gelaufen ist, können Sie hilfsweise Schadensersatz fordern, falls eine Herausgabe nicht mehr möglich ist.
Unechte Hilfsanträge kommen dagegen nur zur Geltung, wenn der Hauptantrag erfolgreich ist. Ein typisches Beispiel ist die Stufenklage: Wenn Sie zunächst Auskunft über verkaufte Produkte verlangen und nach erfolgreicher Auskunftsklage Schadensersatz geltend machen möchten.
Prozessuale Besonderheiten
Sobald Sie Haupt- und Hilfsantrag stellen, werden beide Ansprüche sofort rechtshängig und können verhandelt werden. Die Rechtshängigkeit des Hilfsantrags ist jedoch auflösend bedingt – wird der Hauptantrag in einer Weise entschieden, dass die Bedingung nicht eintritt, erlischt die Rechtshängigkeit des Hilfsantrags rückwirkend.
Streitwertberechnung
Die Streitwertberechnung unterscheidet sich je nach Art des Hilfsantrags:
Bei echten Hilfsanträgen erhöht sich der Streitwert erst dann um den Wert des Hilfsantrags, wenn über diesen tatsächlich entschieden wird. Wenn Sie beispielsweise mit dem Hauptantrag gewinnen, bleibt der Hilfsantrag bei der Berechnung außen vor.
Bei unechten Hilfsanträgen berechnet sich der Streitwert aus dem höheren Betrag von Hauptantrag und Hilfsantrag. Dies bedeutet, dass von Anfang an höhere Prozesskosten entstehen können.
Abgrenzung zum Hilfsvorbringen
Der Hilfsantrag ist vom Hilfsvorbringen zu unterscheiden. Während der Hilfsantrag einen anderen Streitgegenstand betrifft, bleibt beim Hilfsvorbringen der Streitgegenstand gleich – es wird lediglich eine alternative Begründung oder Rechtsansicht vorgebracht. Diese Unterscheidung ist prozessual bedeutsam, da über einen Hilfsantrag im Urteilstenor entschieden werden muss, während das Hilfsvorbringen nur in der Begründung berücksichtigt wird.
Welche Kosten entstehen bei der Stellung von Haupt- und Hilfsanträgen?
Die Kosten bei Haupt- und Hilfsanträgen richten sich nach dem Gebührenstreitwert, der sich unterschiedlich berechnet, je nachdem, ob und wie über die Anträge entschieden wurde.
Gebührenstreitwert bei nur entschiedenem Hauptantrag
Wenn das Gericht nur über den Hauptantrag entscheidet, entspricht der Gebührenstreitwert dem Wert des Hauptantrags. Wenn Sie beispielsweise eine Zahlung von 1.000 Euro verlangen und hilfsweise die Herausgabe einer Sache beantragen, beträgt der Streitwert bei alleiniger Entscheidung über den Hauptantrag nur 1.000 Euro.
Gebührenstreitwert bei Entscheidung über beide Anträge
Bei der Entscheidung über beide Anträge kommt es auf deren wirtschaftliche Gleichwertigkeit an:
Bei wirtschaftlich verschiedenen Anträgen werden die Streitwerte von Haupt- und Hilfsantrag addiert. Dies gilt etwa, wenn Sie im Hauptantrag Schmerzensgeld und hilfsweise die Herausgabe einer Sache verlangen.
Bei wirtschaftlich gleichwertigen Anträgen ist nur der höhere Wert maßgeblich. Dies trifft zu, wenn Sie im Hauptantrag die Herausgabe einer Sache und hilfsweise Schadensersatz in gleicher Höhe fordern.
Kostenentscheidung nach Verfahrensausgang
Die Verteilung der Kosten hängt vom Prozessausgang ab:
Bei Erfolg des Hauptantrags trägt die Gegenseite die Kosten nach dem einfachen Streitwert.
Bei Erfolg des Hilfsantrags wird eine Kostenquote nach § 92 ZPO gebildet. Ist der Hilfsantrag niedriger als der Hauptantrag, tragen Sie einen Teil der Kosten. Bei einem höheren oder gleichwertigen Hilfsantrag muss die Gegenseite die vollen Kosten tragen.
Bei vollständigem Unterliegen mit beiden Anträgen tragen Sie die gesamten Kosten.
Wann macht die Stellung eines Hilfsantrags rechtlich Sinn?
Ein Hilfsantrag ist besonders sinnvoll, wenn Sie sich in einem Rechtsstreit nicht sicher sind, ob Ihr Hauptantrag erfolgreich sein wird. Diese prozessuale Strategie ermöglicht es, mehrere rechtliche Optionen in einem einzigen Verfahren zu verfolgen.
Typische Einsatzszenarien
Komplexe Rechtslagen: Wenn verschiedene rechtliche Wege zum Ziel führen können, sichern Sie sich durch einen Hilfsantrag zusätzliche Erfolgsaussichten ab. Stellen Sie sich vor, Sie fordern die Rückabwicklung eines Kaufvertrags – hier können Sie im Hauptantrag die Anfechtung und hilfsweise den Rücktritt geltend machen.
Prozessökonomische Vorteile: Ein Hilfsantrag vermeidet die Notwendigkeit mehrerer separater Verfahren. Sie sparen dadurch Zeit und Prozesskosten, da alle Ansprüche in einem einzigen Verfahren behandelt werden.
Strategische Überlegungen
Flexibilität im Prozess: Wenn sich während des Verfahrens herausstellt, dass Ihr Hauptantrag weniger erfolgversprechend ist, greift automatisch der Hilfsantrag. Diese Absicherung ist besonders wertvoll bei unklarer Rechtslage oder schwieriger Beweissituation.
Sachdienlichkeit beachten: Ihr Hilfsantrag muss zur endgültigen Klärung der Streitigkeit beitragen. Er darf nicht missbräuchlich sein oder bereits in einem anderen Verfahren anhängig sein.
Formelle Anforderungen
Klare Formulierung: Der Hilfsantrag muss präzise formuliert sein und deutlich vom Hauptantrag abgegrenzt werden. Die Anträge müssen eine klare Rangfolge aufweisen – der Hilfsantrag wird nur geprüft, wenn der Hauptantrag erfolglos bleibt.
Zeitliche Komponente: Sie können einen Hilfsantrag grundsätzlich in jeder Prozessphase stellen, solange dies sachdienlich ist. In der Berufungsinstanz gelten jedoch strengere Voraussetzungen für die Zulässigkeit neuer Anträge.
Welche Rechtsmittel gibt es gegen eine falsche Streitwertfestsetzung?
Gegen eine fehlerhafte Streitwertfestsetzung steht Ihnen als wichtigstes Rechtsmittel die Streitwertbeschwerde zur Verfügung. Diese Beschwerde ist gerichtsgebührenfrei und führt nicht zur Erstattung außergerichtlicher Kosten.
Voraussetzungen der Streitwertbeschwerde
Die Streitwertbeschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt. Stellen Sie sich vor, das Gericht hat einen Streitwert von 10.000 Euro festgesetzt, Sie halten aber 8.000 Euro für angemessen – in diesem Fall wäre eine Beschwerde zulässig, da die Differenz von 2.000 Euro den Schwellenwert deutlich überschreitet.
Fristen beachten
Für die Einlegung der Streitwertbeschwerde gelten folgende Fristen:
- Sechs Monate nach Rechtskraft der Hauptsacheentscheidung oder anderweitiger Erledigung des Verfahrens.
- Bei einer Streitwertfestsetzung, die erst einen Monat vor Fristablauf erfolgt, verlängert sich die Frist auf einen Monat nach Zustellung des Festsetzungsbeschlusses.
- Für Rechtsanwälte gilt eine verkürzte Frist von zwei Wochen ab Zustellung des Streitwertbeschlusses.
Form und Einreichung
Die Streitwertbeschwerde können Sie auf zwei Wegen einreichen:
- Schriftlich beim zuständigen Gericht
- Zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts
Die Beschwerde muss eine schlüssige Begründung enthalten, warum Sie die Streitwertfestsetzung für fehlerhaft halten. Das Gericht prüft dann die Beschwerde und kann den Streitwert korrigieren. Wenn das Gericht der Beschwerde nicht abhilft, wird sie zur Entscheidung an das nächsthöhere Gericht weitergeleitet.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Streitgegenstand
Der Streitgegenstand ist das, worüber in einem Gerichtsprozess konkret gestritten wird. Er wird bestimmt durch den Klageantrag (was der Kläger will) und den zugrundeliegenden Lebenssachverhalt (was tatsächlich passiert ist). Der Streitgegenstand ist wichtig für die Berechnung des Streitwerts und legt den Rahmen fest, über den das Gericht entscheiden darf.
Beispiel: Bei einer Schadensersatzklage wegen eines Verkehrsunfalls ist der Streitgegenstand die Forderung auf Ersatz des konkreten Schadens aufgrund des spezifischen Unfallgeschehens.
Hauptantrag
Der Hauptantrag ist die primäre Forderung des Klägers im Gerichtsverfahren. Er enthält das eigentliche Ziel der Klage und wird vom Gericht zuerst geprüft. Der Hauptantrag ist in § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO gesetzlich verankert und muss bestimmt und eindeutig formuliert sein.
Beispiel: Ein Verkäufer klagt auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises als Hauptantrag.
Hilfsantrag
Ein Hilfsantrag ist eine alternative Forderung für den Fall, dass der Hauptantrag erfolglos bleibt. Er wird vom Gericht nur geprüft, wenn der Hauptantrag abgewiesen wurde. Diese Möglichkeit der alternativen Antragstellung dient der Prozessökonomie und der Rechtssicherheit des Klägers.
Beispiel: Wird im Hauptantrag die Erfüllung eines Vertrags verlangt, könnte im Hilfsantrag Schadensersatz wegen Nichterfüllung gefordert werden.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 45 GKG (Gerichts- und Kostenverfahrensgesetz): Dieser Paragraph regelt die Festsetzung des Streitwerts, der die Grundlage für die Gerichtskosten und die Zuständigkeit des Gerichts bildet. Der Streitwert bemisst sich nach dem wirtschaftlichen Interesse der Parteien am Rechtsstreit. In diesem Fall spielt § 45 GKG eine zentrale Rolle, da die Streitwertbeschwerde darauf abzielt, den Streitwert für die Klage der Klägerin neu festzulegen.
- § 648 BGB (Kündigungsrecht beim Werkvertrag): Diese Vorschrift erlaubt es dem Besteller, einen Werkvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Sie enthält Regelungen über die Folgen der Kündigung, insbesondere hinsichtlich der Vergütung und Rückzahlungen. Im vorliegenden Fall hat die Beklagte den Vertrag gekündigt, was die Grundlage für die geforderten Rückzahlungen und die anschließenden rechtlichen Auseinandersetzungen bildet.
- § 812 Abs. 1 BGB (Herausgabeanspruch bei ungerechtfertigter Bereicherung): Diese Norm bestimmt, dass jemand, der durch die Leistung eines anderen ohne rechtlichen Grund bereichert ist, die Leistung herausgeben muss. Die Beklagte behauptet, dass die Klägerin zu viel bezahlt wurde, was einen Herausgabeanspruch gemäß § 812 Abs. 1 BGB begründen könnte. Dies ist relevant für die Forderung der Beklagten nach Rückzahlung der überzahlten Beträge.
- § 631 BGB (Vergütungspflicht beim Werkvertrag): Dieser Paragraph legt fest, dass der Unternehmer verpflichtet ist, dem Besteller das vereinbarte Entgelt für die Erbringung des Werkes zu zahlen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Besteller, das Werk abzunehmen. Im vorliegenden Fall ist der Vertrag über die Erneuerung der Wärmeversorgung ein Werkvertrag, dessen Bedingungen und die daraus resultierenden Zahlungspflichten maßgeblich sind.
- § 280 BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung): Diese Vorschrift regelt den Anspruch auf Schadensersatz, wenn eine Vertragspartei ihre Pflichten aus dem Vertrag verletzt. Die Klägerin hat in diesem Fall verschiedene Schadensersatzpositionen geltend gemacht, was auf eine behauptete Pflichtverletzung durch die Beklagte hinweist. Dies betrifft die zusätzlichen finanziellen Forderungen der Klägerin im Zusammenhang mit Bauzeitverzögerungen und weiteren entstandenen Kosten.
Das vorliegende Urteil
OLG Frankfurt – Az.: 20 W 1/25 – Beschluss vom 30.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.