Gerichtsentscheidung des Finanzgericht Münster zur Pfändbarkeit der Corona-Soforthilfen
Corona-Soforthilfen sind geschützt vor einer Pfändung. Dies entschied das Finanzgericht Münster (siehe auch Az: 1 V 1286/20 AO vom 13.05.2020) , nachdem sich ein Soloselbstständiger gegen die Pfändung von 9.000 Euro durch des Finanzamtes gewehrt hatte. Auch wenn bereits vor der Corona-Krise Schulden vorlagen, bedeutet dies dem Gericht zufolge nicht, dass gewährte Soforthilfen gepfändet werden dürfen. Die ausgezahlten Hilfen dienen der Notlinderung in der Krise und sind nicht dafür gedacht, Schulden, die vor dem März entstanden sind, zu tilgen.
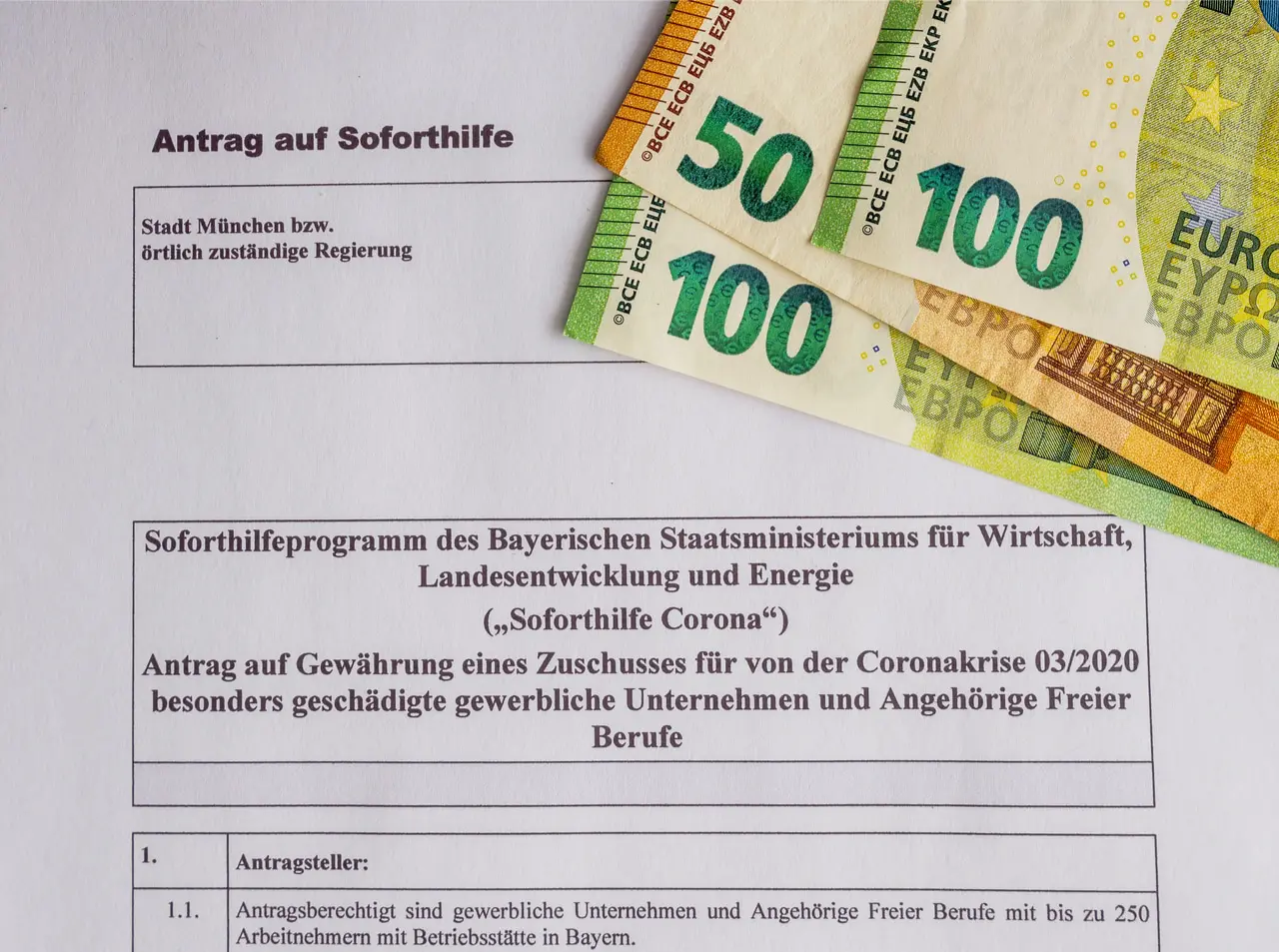
Bank verweigert Corona-Auszahlung
Bei dem betroffenen Mann handelt es sich um einen Soloselbstständigen, der in Nordrhein-Westfalen einen Reparaturservice betreibt und mit diesem seinen Lebensunterhalt bestreitet. Von 2017 bis 2019 hatten sich allerdings beträchtliche Umsatzsteuerschulden angesammelt. In der Folge wurde das Konto des Mannes mit einer Pfändungs- und Einziehungsverfügung belastet, was unter anderem dem Finanzamt Zugriff auf die Finanzen erlaubte, um die vorhandenen Schulden zu tilgen. Seinen Reparaturservice betrieb der Mann weiterhin.
Aufgrund der Corona-Krise kam es jedoch seinen Aussagen zufolge zu einem starken Einbruch der Aufträge, sodass sich der Selbstständige in seiner Existenz bedroht sah. Aus diesem Grund beantragte er die Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmer und Soloselbständige des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 9.000 Euro. Mit dem Geld wollte der Mann die Existenz seines Betriebes sichern und finanzielle Engpässe, die aufgrund der Krise enstanden waren, überbrücken. Die Hilfe wurde gewährt und die Summe von 9.000 Euro auf das Konto überwiesen. Anschließend verweigerte die Bank allerdings die Auszahlung des Geldes.
Kontobesitzer klagt
Die Bank erklärte auf Anfrage des Mannes, dass die Corona-Hilfezahlungen keine einmaligen Sozialleistungen nach § 850k Abs. 2 Nr. 2 ZPO seien und daher nicht vor einer Pfändung geschützt sind. Auch ein erhöhter Freibetrag, den ein Gericht hätte festsetzen müssen, lag der Bank nicht vor. Daher könne man dem Kontobesitzer weiterhin nur der monatliche Freibetrag in Höhe von 1.178,59 Euro auszahlen. Ein Zugriff auf die gesamte Corona-Hilfe sei allerdings nicht möglich.
In der Folge kontaktiere der Mann die Bezirksregierung und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die beide erklärte, dass das Geld trotz der Pfändung an ihn ausgezahlt werden sollte. Beides führte jedoch nicht weiter, sodass er schließlich Anfang Mai eine einstweilige Anordnung anstrebte, mit dem Ziel, dass die Vollstreckung zunächst eingestellt werden sollte. Als Begründung führte er an, dass die Schulden aus der Zeit vor der Corona-Krise stammen und die Auftragslage seitdem sich aber sehr gut entwickelt habe. Aufgrund der Krise sei er aber nun in seiner Existenz bedroht und auf die Soforthilfe angewiesen. Ohne sie könne er seine laufenden Kosten nicht mehr decken.
Corona-Hilfen sind pfändungssicher
Das Finanzamt stellte sich anschließend allerdings gegen den Antrag und wollte die Pfändung nicht aussetzen. Argumentiert wurde dabei, dass die unternehmerische Tätigkeit schon vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten war und man nicht nachvollziehen kann, ob sich tatsächlich eine Verbesserung der Auftragslage eingestellt habe. Zudem sei eine einstweilige Anordnung nicht notwendig, da der Mann den Pfändungsschutz auch über einen Antrag hätte stellen können. Dies sei jedoch nicht passiert.
Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht und erklärte den Antrag als zulässig und begründet. Dem Richter zufolge handelt es sich bei den Corona-Hilfen um eine zweckgebundene finanzielle Unterstützung, die dazu dient, finanzielle Notlagen zu verbessern. Sie ist nicht dafür gedacht, um eventuell vorhandene Forderungen von Gläubigern zu erfüllen, die vor der Corona-Krise beziehungsweise vor dem 1. März 2020 entstanden sind. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das Unternehmen eventuell schon vor der Krise Probleme mit der Auftragslage hatte. Dies zu überprüfen liegt nicht im Ermessen der Gläubiger, sondern ist die Aufgabe derjenigen, welche die Hilfen bewilligen. Auch in Hinblick auf den Antrag auf Pfändungsschutz erteilte das Gericht der Argumentation des Finanzamts eine Absage. Dessen Bearbeitung dauere in der aktuellen Lage zu lange und sei Betroffenen daher nicht zumutbar.
Pfändung wird ausgesetzt
Aufgrund der Tatsache, dass die Corona-Hilfen für einen Zeitraum von drei Monaten bewilligt wurden, verpflichtete das Gericht das Finanzamt, seine Forderungen für den gleichen Zeitraum auszusetzen. Da die Hilfe am 27. März gewährt wurde, kann der Soloselbstständige nun bis zum 27. Juni auf das Geld auf seinem Konto zugreifen. Auch die Kosten für die Verhandlung muss das Finanzamt tragen. Mit seiner Entscheidung bestätigte das Gericht noch einmal, dass Corona-Hilfen explizit als Notlösungen für die aktuelle Krise gedacht sind und auch entsprechend verwendet werden sollten.
Können wir Ihnen während und nach der Corona-Krise juristisch zur Seite stehen?
Wir beraten auch unkompliziert Online per eMail.












