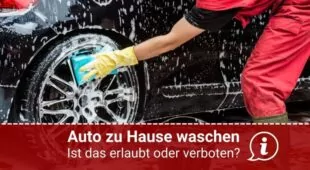Übersicht:
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Windrad-Modernisierung: OLG begrenzt Zusatzvergütung für Verkäufer auf ursprüngliche Vertragsbasis
- Der ursprüngliche Deal: Grundstücksverkauf gegen Festpreis und Windkraft-Pachtanteil
- Der Wandel: Alte Anlagen unrentabel, neue Anlagen errichtet
- Die Entscheidung des Landgerichts und die Berufung
- Die Entscheidung des Oberlandesgerichts: Grundsätzlicher Anspruch ja, aber Höhe begrenzt und kein Auskunftsrecht
- Argumentation des OLG: Warum die Zusatzvergütung dem Grunde nach fortbesteht
- Argumentation des OLG: Warum die Höhe begrenzt ist und kein Auskunftsanspruch besteht
- Die logische Folge: Abweisung des Auskunftsanspruchs
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Bleibt eine vereinbarte Zusatzvergütung bestehen, wenn die Windkraftanlagen auf meinem Grundstück erneuert werden?
- Wie berechnet sich die Höhe der Zusatzvergütung, wenn die neuen Windkraftanlagen leistungsstärker sind als die ursprünglich vereinbarten?
- Habe ich einen Anspruch darauf, Informationen über die Einnahmen oder neuen Pachtverträge der modernen Windkraftanlagen zu erhalten?
- Was passiert, wenn mein ursprünglicher Vertrag den Austausch der Windkraftanlagen nicht ausdrücklich regelt?
- Welche Bedeutung hat es, wenn ein im Vertrag genannter Pachtvertrag nicht wie geplant abgeschlossen oder später geändert wurde?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 12 U 35/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Verfahrensart: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Vertragsrecht, insbesondere Kauf- und Pachtvertragsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die ehemaligen Verkäufer eines Grundstücks, die eine zusätzliche Vergütung aus dem Betrieb von Windkraftanlagen auf dem Grundstück beanspruchen und Auskunft über die Erträge aus neuen Anlagen verlangen.
- Beklagte: Der Käufer des Grundstücks, der nun die Windkraftanlagen betreibt und sich gegen den Auskunftsanspruch der Kläger wendet.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Die Kläger verkauften dem Beklagten ein Grundstück für Windkraftanlagen und vereinbarten eine variable Zusatzvergütung aus deren Betrieb. Die ursprünglichen Anlagen wurden später wegen Unrentabilität abgerissen und durch neue, leistungsstärkere Windkraftanlagen ersetzt. Die Kläger forderten daraufhin weiterhin die Zusatzvergütung sowie Auskunft über die Erträge der neuen Anlagen.
- Kern des Rechtsstreits: Der zentrale Streitpunkt war, ob die vereinbarte Zusatzvergütung auch nach dem Abriss und Neubau der Windkraftanlagen fortbesteht. Weiterhin war strittig, wie die Höhe dieser Zahlung zu bemessen ist und ob den Klägern ein Auskunftsanspruch über die Erträge der neuen Anlagen zusteht.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Berufungsgericht hat das erstinstanzliche Urteil abgeändert. Die Klage der Verkäufer wurde hinsichtlich ihres Auskunftsanspruchs abgewiesen.
- Begründung: Die Pflicht zur Zahlung der Zusatzvergütung besteht dem Grunde nach fort, da der ursprüngliche Kaufvertrag eine unvorhergesehene Lücke für den Austausch der Anlagen aufwies, die durch Ergänzende Vertragsauslegung geschlossen wurde. Die Höhe der Zusatzvergütung ist jedoch auf die ursprünglichen Regelungen des Pachtvertrags W. begrenzt und wird nicht an die höheren Erträge der neuen Anlagen angepasst. Daher besteht kein Auskunftsanspruch, da die Informationen über die neuen Erträge für die Berechnung der geschuldeten Zahlung nicht relevant sind.
- Folgen: Der Käufer ist nicht verpflichtet, Auskunft über die Erträge und den Inhalt des neuen Pachtvertrags zu erteilen. Die Verkäufer erhalten weiterhin eine Zusatzvergütung, deren Höhe sich nach den Bestimmungen des ursprünglichen Pachtvertrags richtet. Eine Revision gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen.
Der Fall vor Gericht
Windrad-Modernisierung: OLG begrenzt Zusatzvergütung für Verkäufer auf ursprüngliche Vertragsbasis
Ein Grundstück wird für den Betrieb von Windkraftanlagen verkauft, und die Verkäufer sichern sich eine zusätzliche, ertragsabhängige Vergütung. Doch was geschieht, wenn die ursprünglichen Anlagen ausgedient haben, abgerissen und durch modernere, leistungsstärkere ersetzt werden? Muss der Käufer weiterhin zahlen, und wenn ja, wie viel? Und hat der Verkäufer einen Anspruch darauf zu erfahren, wie viel Gewinn die neuen Anlagen abwerfen? Mit diesen komplexen Fragen musste sich das Oberlandesgericht (OLG) beschäftigen, nachdem das Landgericht Lübeck in erster Instanz noch anders entschieden hatte.

Im Kern ging es um die Auslegung eines Grundstückskaufvertrags aus dem Jahr 2001 und die Frage, ob eine vereinbarte „Zusatzvergütung“ für die Verkäufer auch nach einem Austausch der Windkraftanlagen fortbesteht und wie sie sich dann berechnet.
Der ursprüngliche Deal: Grundstücksverkauf gegen Festpreis und Windkraft-Pachtanteil
Am 26. Juli 2001 verkauften die Kläger (im Folgenden „die Verkäufer“) ein Grundstück an den Beklagten (im Folgenden „der Käufer“). Dieses Grundstück war für den Betrieb von Windkraftanlagen vorgesehen. Eine Schlüsselklausel im notariellen Kaufvertrag, § 15 mit der Überschrift „Windkraftanlagen“, regelte eine sogenannte „Zusatzvergütung“. Diese sollte sich auf zwei geplante Windkraftanlagen auf dem verkauften Flurstück beziehen.
Die Vereinbarung sah vor, dass die Pacht, die aus einem spezifischen, dem Käufer bekannten Pachtvertrag – dem sogenannten „Pachtvertrag W.“ (Anlage K2) – resultieren würde, für die gesamte Laufzeit dieses Vertrages, einschließlich zweier Verlängerungsoptionen von je fünf Jahren, hälftig zwischen den Verkäufern und dem Käufer geteilt werden sollte. Erst danach sollte die Pacht vollständig dem Käufer zustehen. Der Käufer verpflichtete sich im Kaufvertrag, alle Rechte und Pflichten aus diesem Pachtvertrag W. zu übernehmen.
Die Details des Pachtvertrags W.
Der Pachtvertrag W. wiederum enthielt in § 3 Ziffer 1 eine genaue Regelung zur jährlichen Nutzungsentschädigung: Pro Windkraftanlage sollten 4 % der Stromeinspeisevergütung gezahlt werden, mindestens jedoch 15.000 Deutsche Mark (DM) pro Jahr, bei einer Anlagengröße von 1.500 Kilowatt (kW). Dies entsprach einer Mindestpacht von 10.000 DM pro installiertem Megawatt. Für den Fall, dass größere oder kleinere Anlagen als 1.500 kW errichtet würden, sah § 3 Ziffer 2 des Pachtvertrags W. eine Anpassungsregelung für die festen Geldbeträge vor. Wichtig war auch eine Klausel, die besagte, dass die Beteiligung der Verkäufer an der Pacht entfallen würde, sollten die Anlagen erst nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Datum des Kaufvertrags errichtet werden.
Nach Abschluss des Kaufvertrages kam es jedoch anders als geplant. Statt des Pachtvertrags W. wurde ein anderer Vertrag, der „Pachtvertrag D.“ (Anlage K3), für den Betrieb der Windkraftanlagen abgeschlossen. An diesem Pachtvertrag D. waren die Verkäufer nicht beteiligt, und sie hatten auch keiner Änderung des ursprünglichen Kaufvertrags in diesem Punkt zugestimmt. Die zunächst auf Basis dieses Pachtvertrags D. errichteten „alten“ Windkraftanlagen wurden dann für einige Zeit betrieben.
Der Wandel: Alte Anlagen unrentabel, neue Anlagen errichtet
Zu einem späteren, im Urteil nicht genauer bezeichneten Zeitpunkt, erwies sich der Betrieb der bestehenden Windkraftanlagen als „nicht mehr als hinreichend rentabel“. Dies führte dazu, dass die „alten und verschlissenen Anlagen“, wie es im landgerichtlichen Urteil formuliert wurde, außer Betrieb genommen und abgerissen wurden. Gleichzeitig wurde der Pachtvertrag D. aufgehoben. Die Verkäufer betonten, dass die technische Lebensdauer der Anlagen keineswegs erreicht gewesen sei; der Abriss sei allein auf die mangelnde Wirtschaftlichkeit zurückzuführen.
Obwohl die alten Windkraftwerke abgebaut wurden, blieben die Fundamente im Boden. Der Käufer, als neuer Eigentümer und Verpächter des Grundstücks, schloss einen neuen Pachtvertrag mit einem neuen Pächter ab und ließ neue, leistungsstärkere Windkraftanlagen auf dem Grundstück errichten. Die Verkäufer vertraten die Ansicht, dass die Pflicht des Käufers zur Zahlung der Zusatzvergütung trotz dieser Entwicklungen fortbestehe. Sie verlangten daher Auskunft über die mit den neuen Windkraftanlagen erzielte Einspeisevergütung und über den Inhalt des neuen Pachtvertrags, um die Höhe ihrer Beteiligung berechnen zu können.
Die Entscheidung des Landgerichts und die Berufung
Das Landgericht Lübeck hatte in einem Teilurteil vom 17. Mai 2024 (Az. 17 O 100/22) den Verkäufern im Grundsatz Recht gegeben. Es bejahte einen fortgesetzten Anspruch auf die Zusatzvergütung und sah auch den Auskunftsanspruch als begründet an. Das Landgericht ging davon aus, dass die Zusatzvergütung zukünftig die Hälfte der mit den neuen Windkraftanlagen erzielten Einspeisevergütung umfassen sollte.
Gegen diese Entscheidung legte der Käufer Berufung beim Oberlandesgericht ein. Sein Ziel war die Abweisung des Auskunftsanspruchs und damit implizit eine andere Berechnungsgrundlage für eine etwaige fortbestehende Zusatzvergütung.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts: Grundsätzlicher Anspruch ja, aber Höhe begrenzt und kein Auskunftsrecht
Das Oberlandesgericht (OLG) änderte das Urteil des Landgerichts Lübeck ab. Es entschied, dass die Klage hinsichtlich des Auskunftsanspruchs abgewiesen wird. Die Kostenentscheidung wurde dem erstinstanzlichen Gericht überlassen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, und der Streitwert für das Berufungsverfahren wurde auf 600 Euro festgesetzt. Eine Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.
Um zu verstehen, warum das Gericht so entschieden hat, muss man die Argumentation des OLG in zwei Hauptteile gliedern: erstens die Frage, ob überhaupt noch ein Anspruch auf Zusatzvergütung besteht, und zweitens, falls ja, wie hoch dieser ist und ob dafür eine Auskunft über die neuen Verträge nötig ist.
Argumentation des OLG: Warum die Zusatzvergütung dem Grunde nach fortbesteht
Das OLG stimmte dem Landgericht zunächst darin zu, dass den Verkäufern grundsätzlich weiterhin eine Zusatzvergütung zusteht. Diese ergebe sich aus § 15 des notariellen Kaufvertrags in Verbindung mit § 3 Ziffer 1 des ursprünglichen Pachtvertrags W.
Die Feststellung einer planwidrigen Regelungslücke
Die Richter stellten fest, dass der Kaufvertrag in Verbindung mit dem Pachtvertrag W. keine ausdrückliche Regelung für den Fall enthält, dass die „alten“ Windkraftanlagen wegen fehlender Rentabilität vorzeitig abgerissen und durch neue ersetzt werden. Der später abgeschlossene Pachtvertrag D. sei für die Auslegung des ursprünglichen Kaufvertrages unerheblich, da die Verkäufer daran nicht beteiligt waren und keiner Vertragsänderung zugestimmt hatten.
Das Gericht prüfte, ob die Bedingungen für ein Ende der Zahlungspflicht gemäß dem Pachtvertrag W. erfüllt waren:
- Kein Erreichen der technischen Lebensdauer: § 2 des Pachtvertrags W. sah eine automatische Beendigung bei Abriss nur vor, wenn die technische Lebensdauer (festgelegt auf 25 Jahre) nicht erreicht, die Anlage stillgelegt und das Fundament entfernt wurde. Der Käufer hatte laut OLG nicht ausreichend dargelegt, dass die technische Lebensdauer erreicht war. Sein Vortrag konzentrierte sich auf fehlende Rentabilität und „Verschleiß“, nicht auf ein technisches Ende der Anlagen. Die Formulierung „alt und verschlissen“ im landgerichtlichen Urteil diente nach Ansicht des OLG lediglich der Illustration der fehlenden Rentabilität.
- Keine endgültige Stilllegung des Grundstücks für Windkraft: Selbst wenn die technische Lebensdauer erreicht worden wäre, wäre eine Voraussetzung für den ersatzlosen Wegfall der Zusatzvergütung gewesen, dass das Grundstück nicht mehr für den Betrieb von Windkraftanlagen genutzt, sondern komplett geräumt zurückgegeben wird. Dies war hier nicht der Fall, da der Käufer ja neue Anlagen errichten ließ.
Diese Lücke im Vertrag sei planwidrig. Das bedeutet, die Vertragsparteien haben bei Vertragsschluss diese spezielle Entwicklung (Austausch wegen Unrentabilität bei Weiterbetrieb mit neuen Anlagen) offensichtlich nicht bedacht. Angesichts der Bedeutung der Zusatzvergütung als wesentlicher Bestandteil des Kaufpreises und der langen vereinbarten Laufzeit sei anzunehmen, dass die Parteien diesen Fall bei Kenntnis angemessen geregelt hätten.
Ergänzende Vertragsauslegung: Was hätten die Parteien gewollt?
Da eine direkte Anwendung von Gesetzesvorschriften wie § 162 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), der sich mit der treuwidrigen Herbeiführung oder Verhinderung eines Bedingungseintritts befasst, ausschied, griff das Gericht zur Methode der ergänzenden Vertragsauslegung. Hierbei wird gefragt, was redliche und vernünftige Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie den nicht geregelten Fall bedacht hätten.
Das OLG kam, wie schon das Landgericht, zu dem Ergebnis, dass die Parteien die Ertragsbeteiligung der Verkäufer auch über den Zeitpunkt der Beendigung des Pachtvertrags D. hinaus fortgesetzt hätten. Die Interessenabwägung sprach dafür:
- Die Zusatzvergütung war ein wichtiger Teil der Gesamtvergütung für das Grundstück, die sich aus einem Festkaufpreis und eben dieser variablen Beteiligung an der Stromeinspeisevergütung über potenziell 25 bis 35 Jahre zusammensetzte. Die Verkäufer hatten ein berechtigtes Interesse daran, den ihnen zustehenden hälftigen Pachtzins weiterhin zu erhalten.
- Ein ersatzloser Wegfall der Zusatzvergütung würde das Gleichgewicht zwischen dem gezahlten Kaufpreis und dem Wert des Grundstücks empfindlich stören. Hätten die Verkäufer dies geahnt, hätten sie auf einer Regelung zur Weiterzahlung bestanden. Ein redlicher Käufer, so das Gericht, hätte dem zugestimmt, da er ja durch leistungsstärkere neue Anlagen weiterhin von dem Grundstück profitiert.
- Eine Beendigung der Zusatzvergütung allein aus wirtschaftlichen Rentabilitätserwägungen bezüglich der alten Anlagen wäre für die Verkäufer unkalkulierbar gewesen und hätte ihren Interessen widersprochen.
Argumentation des OLG: Warum die Höhe begrenzt ist und kein Auskunftsanspruch besteht
Obwohl das OLG den grundsätzlichen Fortbestand der Zahlungspflicht bejahte, kam es bei der Höhe der Zusatzvergütung und der daraus resultierenden Frage des Auskunftsanspruchs zu einem anderen Ergebnis als das Landgericht.
Anknüpfung an den ursprünglichen Pachtvertrag W. als Obergrenze
Entscheidend war für das OLG, dass § 15 des Kaufvertrags hinsichtlich der Höhe der Zusatzvergütung ausdrücklich und ausschließlich auf den Pachtvertrag W. Bezug nimmt. Diese vertragliche Anknüpfung müsse auch für die Höhe der nunmehr nach dem Austausch der Anlagen geschuldeten Pacht gelten. Der neu abgeschlossene Pachtvertrag für die neuen, leistungsstärkeren Anlagen könne die weiterhin zu zahlende Zusatzvergütung nicht beeinflussen, da er nicht auf den ursprünglichen Vergütungsüberlegungen der Parteien des Kaufvertrags basiere. Das Gericht betonte, dass eine ergänzende Vertragsauslegung grundsätzlich keine Besserstellung des Berechtigten im Vergleich zur ursprünglichen Vereinbarung zum Inhalt haben solle.
Die Verkäufer könnten daher aus ihrem Anspruch auf den hälftigen Pachtzins nicht mehr verlangen, als sie maximal aus dem Pachtvertrag W. hätten erlangen können. Das OLG verwies hierzu auch auf eine frühere Entscheidung des Landgerichts Lübeck aus dem Jahr 2007 (Anlage K4), die den Verkäufern eine hälftige Teilhabe an Pachterlösen „jedenfalls in einem Pachtkorridor von 30.000 DM“ zugesprochen hatte.
Die Bedeutung der Nichtberücksichtigung von § 3 Ziffer 2 des Pachtvertrags W.
Ein weiteres wichtiges Argument des OLG gegen eine Heranziehung der (potenziell höheren) Pachterlöse aus dem neuen Pachtvertrag zugunsten der Verkäufer war eine Detailregelung im Kaufvertrag: Die Parteien hatten in § 15 des Kaufvertrags ausdrücklich nur § 3 Ziffer 1 des Pachtvertrags W. (Mindestpacht bei 1.500 kW-Anlagen) in Bezug genommen, nicht aber § 3 Ziffer 2. Diese Ziffer 2 hätte eine Neuberechnung der Mindestpacht bei Errichtung von größeren oder kleineren Anlagen als den ursprünglich geplanten 1.500 kW-Anlagen vorgesehen.
Dass diese Anpassungsklausel nicht in die Verweisung im Kaufvertrag aufgenommen wurde, wertete das Gericht als starkes Indiz dafür, dass die Zusatzvergütung – zumindest hinsichtlich der vertraglich fixierten Mindestpacht – auch dann unverändert bleiben sollte, wenn später abweichend dimensionierte Anlagen gebaut würden. Es ging den Parteien des Kaufvertrags also um eine Beteiligung an den Erträgen der ursprünglich geplanten Konfiguration, nicht um eine dynamische Anpassung an jede technische Neuerung.
Die konkrete Berechnung der fortbestehenden Zusatzvergütung
Ausgehend von diesen Überlegungen hatten die Verkäufer nach Ansicht des OLG weiterhin Anspruch auf die Hälfte einer Mindestpacht, die sich aus zwei Windkraftanlagen à 1.500 kW gemäß Pachtvertrag W. errechnet. Dies sind 2 x 15.000 DM jährlich, also insgesamt 30.000 DM. Die Hälfte davon beträgt 15.000 DM, was 7.669,38 Euro jährlich entspricht. An dieser Summe sei auch für die Zukunft festzuhalten. Dass der Käufer zwischenzeitlich auf Basis des Pachtvertrags D. freiwillig 8.000 Euro jährlich pro Windkraftanlage gezahlt hatte, sei für die Bestimmung der vertraglich geschuldeten zukünftigen Zusatzvergütung nicht entscheidend.
Die logische Folge: Abweisung des Auskunftsanspruchs
Da die Verkäufer gemäß § 15 des Kaufvertrags in Verbindung mit dem Pachtvertrag W. lediglich die dort vereinbarte (und nun vom OLG konkret bezifferte) Mindestpacht zur Hälfte verlangen können, verneinte das Gericht den von ihnen geltend gemachten Auskunftsanspruch. Zur Berechnung der Zusatzvergütung auf dieser feststehenden Basis benötigen sie keine weiteren Unterlagen oder Informationen über den Inhalt des vom Käufer neu abgeschlossenen Pachtvertrags für die neuen Windkraftanlagen oder deren konkrete Einspeisevergütungen. Diese Informationen sind schlicht nicht erforderlich, da die Zahlungspflicht des Käufers nach oben hin durch die Konditionen des alten Pachtvertrags W. gedeckelt ist.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das OLG-Urteil zeigt, dass bei langfristigen Grundstücksverträgen mit Ertragskomponenten der ursprüngliche Vertrag maßgeblich bleibt, auch wenn sich die technischen Gegebenheiten ändern. Die Verkäufer behalten zwar ihren grundsätzlichen Anspruch auf Zusatzvergütung beim Austausch von Windkraftanlagen, aber die Höhe bleibt auf die ursprünglich vereinbarte Basis beschränkt (hier: 7.669,38 Euro jährlich). Bei solchen Verträgen sollten daher von Anfang an klare Regelungen für technische Modernisierungen und Leistungssteigerungen getroffen werden, da spätere Anpassungen ohne beiderseitiges Einverständnis schwierig durchzusetzen sind.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Bleibt eine vereinbarte Zusatzvergütung bestehen, wenn die Windkraftanlagen auf meinem Grundstück erneuert werden?
Ob eine vereinbarte Zusatzvergütung für Windkraftanlagen auf Ihrem Grundstück auch nach deren Erneuerung fortbesteht, hängt maßgeblich von der ursprünglichen Vereinbarung ab. Der Wortlaut des Vertrages und die damalige Absicht der Vertragsparteien sind hierfür entscheidend.
Die Bedeutung des ursprünglichen Vertrages
Der Kern der Frage liegt darin, wofür die Zusatzvergütung ursprünglich vereinbart wurde.
- Zweckbindung der Zahlung: Eine Vergütung bleibt in der Regel bestehen, wenn sie für die grundsätzliche Nutzung Ihres Grundstücks zur Windenergieerzeugung vereinbart wurde. Das bedeutet, die Zahlung ist an den Zweck gebunden, dass auf Ihrem Grundstück Windstrom erzeugt wird, unabhängig davon, welche spezifische Anlage diesen Strom produziert. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fläche vermietet, damit dort ein Garten betrieben wird. Solange ein Garten existiert, ist die Miete fällig, egal welche Blumen oder Pflanzen genau dort wachsen. Ähnlich ist es oft bei Windkraftanlagen: Die Zahlung erfolgt für die Bereitstellung des Grundstücks zur Stromerzeugung aus Wind, nicht unbedingt für die spezifische „Altanlage“.
- Anlagenbezogene Zahlung: Nur in seltenen Fällen ist eine Zusatzvergütung so eng an die konkreten, alten Windkraftanlagen gebunden, dass ihr Austausch automatisch zum Wegfall der Zahlung führen würde. Dies wäre der Fall, wenn die Zahlung beispielsweise explizit für bestimmte Nachteile oder Einschränkungen galt, die ausschließlich mit den alten Anlagentypen verbunden waren und mit neuen Anlagen entfallen würden.
Fortbestand des Zwecks und Interessenabwägung
Für den Fortbestand der Vergütung ist entscheidend, ob der grundlegende Zweck der Vereinbarung weiterhin erfüllt wird. Wenn Ihr Grundstück weiterhin zur Energieerzeugung mittels Windkraft genutzt wird, selbst wenn dies mit moderneren und leistungsfähigeren Anlagen geschieht (oft als „Repowering“ bezeichnet), spricht viel für den Fortbestand der Zusatzvergütung.
- Keine automatische Anpassung: Eine rein wirtschaftliche Unrentabilität der alten Anlagen oder die Steigerung der Effizienz durch neue Anlagen führt in der Regel nicht automatisch zum Verlust Ihres Anspruchs. Das Recht auf die Zusatzvergütung ist oft an die Nutzung des Grundstücks als Standort für Windkraftanlagen gekoppelt und nicht an die Wirtschaftlichkeit einer bestimmten Anlagengeneration für den Betreiber.
- Interessen der Parteien: Gerichte legen bei solchen Fragen Wert auf eine Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien. Wenn Sie als Grundstückseigentümer Ihr Land weiterhin zur Verfügung stellen und die Nutzung durch Windkraftanlagen besteht, bleibt der Grund für Ihre zusätzliche Vergütung meist erhalten. Es geht darum, dass die Energieerzeugung aus Wind auf Ihrem Grundstück fortgesetzt wird und nicht darum, ob dies mit einer neuen, effizienteren Technologie geschieht.
Anpassungsklauseln und Ausnahmen
Manche Verträge enthalten spezifische Anpassungsklauseln, die regeln, was bei einem Austausch der Anlagen geschieht oder wie die Vergütung neu berechnet wird. Solche Klauseln sind bindend und müssen beachtet werden. Gibt es keine solche Klausel, steht die Kontinuität des Vertrages und die Fortsetzung der Grundstücksnutzung für Windenergie im Vordergrund.
Wie berechnet sich die Höhe der Zusatzvergütung, wenn die neuen Windkraftanlagen leistungsstärker sind als die ursprünglich vereinbarten?
Wenn neue Windkraftanlagen auf Ihrem Grundstück errichtet werden, die wesentlich leistungsstärker sind als die ursprünglich vereinbarten, stellt sich oft die Frage, wie sich die Höhe Ihrer Zusatzvergütung, die über die Grundpacht hinausgeht, berechnet. Hierbei ist ein weitverbreitetes Missverständnis auszuräumen: Die zusätzliche Vergütung steigt nicht zwingend proportional mit dem höheren Ertrag der neuen Anlagen.
Grundprinzip: Der ursprüngliche Vertrag als Basis
Grundsätzlich bildet der ursprünglich geschlossene Vertrag die Grundlage für die Berechnung Ihrer Vergütung. Dieser Vertrag legt fest, welche Leistung die Anlagen erbringen sollen und wie Ihre Beteiligung – beispielsweise als feste Pacht, Mindestpacht oder als prozentualer Anteil am Ertrag – ursprünglich kalkuliert wurde.
Die erhöhte Leistung der neuen Windkraftanlagen ist eine technische Entwicklung, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses meist nicht vorhersehbar war. Juristisch spricht man hier von einer sogenannten „Störung der Geschäftsgrundlage„. Das bedeutet, dass sich wesentliche Umstände, die die Parteien bei Vertragsschluss vorausgesetzt haben, nachträglich so gravierend geändert haben, dass der Vertrag in seiner ursprünglichen Form nicht mehr fair oder zumutbar wäre.
Was bedeutet „ergänzende Vertragsauslegung“?
In solchen Fällen, in denen ein Vertrag eine unvorhergesehene Entwicklung nicht berücksichtigt, wenden Gerichte die sogenannte „ergänzende Vertragsauslegung“ an. Dabei versuchen sie herauszufinden, was die Vertragsparteien vernünftigerweise vereinbart hätten, wenn sie die höhere Leistung der neuen Anlagen von Anfang an bedacht hätten.
Für Sie als Grundstückseigentümer bedeutet dies, dass die Gerichte in der Regel darauf abzielen, eine faire Anpassung zu finden, die die ursprünglich angedachte wirtschaftliche Balance zwischen den Parteien wiederherstellt. Es geht darum, Nachteile auszugleichen und den ursprünglichen Zweck des Vertrages zu sichern, aber nicht darum, einer Partei einen unverhältnismäßigen Vorteil aus einer unvorhergesehenen technischen Entwicklung zu verschaffen.
Die Gerichte berücksichtigen dabei:
- Die ursprünglich vereinbarte Berechnungsgrundlage für die Vergütung (z.B. eine Mindestpacht oder eine bestimmte Leistungsgröße). Diese dient oft als Obergrenze oder feste Bemessungsgrundlage.
- Die Verteilung von Risiken und Chancen, die die Parteien ursprünglich eingegangen sind. Die Risiken und Investitionen für die technische Weiterentwicklung und den Betrieb der Anlage trägt in der Regel der Betreiber.
Warum die Zusatzvergütung nicht automatisch steigt
Die Höhe der fortbestehenden Zusatzvergütung wird oft nicht an die tatsächlichen Erträge der neuen, leistungsstärkeren Anlagen gekoppelt, die aus der technischen Entwicklung resultieren. Stattdessen dient die ursprünglich vereinbarte Berechnungsgrundlage als Maßstab.
Stellen Sie sich vor, der ursprüngliche Vertrag sah eine Beteiligung vor, die auf einer bestimmten, damals üblichen Leistung der Windkraftanlage basierte. Die neue, stärkere Anlage produziert nun deutlich mehr Strom. Die Gerichte gehen davon aus, dass Ihre Beteiligung als Grundstückseigentümer sich auf die Bereitstellung des Standortes und die damit verbundenen Bedingungen bezieht. Die Steigerung des Ertrags durch technische Fortschritte der Anlagen ist dem Betreiber zuzuschreiben, der die Investition und das technische Know-how einbringt.
Daher wird in vielen Fällen die ursprünglich vereinbarte Vergütung, eventuell unter Berücksichtigung inflationsbedingter Anpassungen oder sonstiger vereinbarter Erhöhungen, als angemessene fortbestehende Zusatzvergütung angesehen. Eine Besserstellung über die ursprüngliche vertragliche Basis hinaus ist oft nicht vorgesehen, da es darum geht, die ursprüngliche Vertragsbeziehung aufrechtzuerhalten und nicht eine neue, an die aktuellen technischen Möglichkeiten angepasste, zu schaffen.
Habe ich einen Anspruch darauf, Informationen über die Einnahmen oder neuen Pachtverträge der modernen Windkraftanlagen zu erhalten?
Ein Anspruch darauf, Informationen über die Einnahmen oder neue Pachtverträge von Windkraftanlagen zu erhalten, besteht nicht pauschal. Ob Ihnen ein solcher Auskunftsanspruch zusteht, hängt entscheidend davon ab, warum Sie diese Informationen benötigen und wie Ihr eigener Anspruch auf eine mögliche Zusatzvergütung vertraglich ausgestaltet ist.
Wann ein Auskunftsanspruch bestehen kann
Ein Anspruch auf Auskunft über Einnahmen oder neue Pachtverträge ist in der Regel dann gegeben, wenn die gewünschten Informationen erforderlich sind, um Ihren eigenen Anspruch zu berechnen oder zu überprüfen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre vertraglich vereinbarte Zusatzvergütung direkt von den erzielten Einnahmen der Windkraftanlagen abhängt.
- Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr Vertrag sieht vor, dass Sie einen bestimmten Prozentsatz der jährlichen Einnahmen der Windkraftanlage als Zusatzvergütung erhalten. In diesem Fall benötigen Sie die genauen Einnahmen, um zu prüfen, ob die Ihnen zustehende Zahlung korrekt berechnet wurde. Ohne diese Information könnten Sie Ihren Anspruch nicht überprüfen, und ein Auskunftsanspruch wäre in der Regel gegeben.
Wann ein Auskunftsanspruch entfallen kann
Wenn Ihre Zusatzvergütung jedoch nicht direkt an die tatsächlichen Einnahmen gekoppelt ist, entfällt der Bedarf an diesen Informationen oft.
- Beispiel: Ist Ihre Zusatzvergütung vertraglich als fester Betrag pro Jahr festgelegt oder auf eine bestimmte Obergrenze begrenzt, die unabhängig von den tatsächlichen Erträgen der Windkraftanlagen ist, dann benötigen Sie die genauen Einnahmen des Betreibers nicht, um Ihren eigenen Anspruch zu berechnen. In solchen Fällen besteht in der Regel kein Anspruch darauf, die Einnahmen oder Details neuer Pachtverträge zu erfahren. Der Grund ist, dass die Höhe Ihrer Zahlung bereits feststeht und die Einnahmen des Vertragspartners dafür keine Rolle spielen.
Bedeutung Ihres Vertrags
Für Sie bedeutet das: Die entscheidende Grundlage für einen möglichen Auskunftsanspruch ist immer Ihr individueller Vertrag und die darin festgelegte Berechnungsweise Ihrer Zusatzvergütung. Nur wenn die Information über Einnahmen oder Pachtverträge zwingend notwendig ist, um die Höhe Ihrer eigenen Beteiligung korrekt zu ermitteln, können Sie in der Regel deren Offenlegung verlangen.
Was passiert, wenn mein ursprünglicher Vertrag den Austausch der Windkraftanlagen nicht ausdrücklich regelt?
Wenn ein Vertrag, wie der über Windkraftanlagen, nicht alle denkbaren zukünftigen Ereignisse oder Szenarien – wie den Austausch der Anlagen – ausdrücklich regelt, spricht man von einer Vertragslücke. Das ist kein ungewöhnliches Problem, denn Verträge können in der Praxis kaum jede Eventualität vorwegnehmen. Solche Lücken führen nicht automatisch dazu, dass der Vertrag seine Gültigkeit verliert oder Ihre Ansprüche entfallen.
Ergänzende Vertragsauslegung bei Vertragslücken
In solchen Fällen kann ein Gericht eine sogenannte ergänzende Vertragsauslegung vornehmen. Das bedeutet, das Gericht versucht nicht, etwas völlig Neues in den Vertrag einzufügen. Vielmehr wird ermittelt, was die Parteien mutmaßlich vereinbart hätten, wenn sie die Lücke gekannt und über das Problem nachgedacht hätten. Es geht darum, den vermuteten Willen der Vertragspartner zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu rekonstruieren.
Dabei stellt das Gericht die Frage: Was hätten redliche und vernünftige Parteien in dieser Situation vereinbart, um ihre ursprünglichen Vertragsziele zu erreichen und ein faires Gleichgewicht ihrer Interessen und Leistungen zu wahren?
Welche Faktoren sind hier wichtig?
Bei dieser Betrachtung spielen mehrere Aspekte eine Rolle:
- Die ursprünglichen Ziele des Vertrags: Wozu wurde der Vertrag überhaupt geschlossen? Was wollten die Parteien mit der Vereinbarung erreichen?
- Die Interessenabwägung: Welche Interessen hatten die einzelnen Parteien beim Abschluss des Vertrags, und wie hätten sie diese bei der Regelung des nicht bedachten Falles ausgeglichen?
- Das Gleichgewicht der Leistungen: Wie würde eine ergänzende Regelung die faire Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen den Parteien beeinflussen? Es soll keine Partei einseitig benachteiligt werden.
Für Sie bedeutet das: Selbst wenn der Vertrag eine bestimmte Situation nicht explizit anspricht, gibt es rechtliche Mechanismen, um solche Lücken zu schließen. Die Gerichte sind darauf bedacht, eine Lösung zu finden, die dem ursprünglichen Geist und Zweck des Vertrages so nahe wie möglich kommt und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt. Es geht darum, eine praktikable und gerechte Lösung zu finden, die den Vertrag weiterhin sinnvoll fortführt.
Welche Bedeutung hat es, wenn ein im Vertrag genannter Pachtvertrag nicht wie geplant abgeschlossen oder später geändert wurde?
Wenn in einem Vertrag, wie beispielsweise einem Kaufvertrag, auf einen anderen Vertrag – hier einen Pachtvertrag – Bezug genommen wird, ist es wichtig, die genauen Bedingungen dieser Bezugnahme zu verstehen. Grundsätzlich gilt im deutschen Recht der Grundsatz der Vertragsfreiheit und der Vertragsbindung. Das bedeutet: Ein einmal wirksam abgeschlossener Vertrag ist für die beteiligten Parteien bindend und legt ihre Rechte und Pflichten fest.
Was maßgeblich ist: Der Zeitpunkt der ursprünglichen Vereinbarung
Für die Auslegung Ihres ursprünglichen Kaufvertrages und eventuell daran geknüpfter Zahlungen (wie eine Zusatzvergütung) sind in erster Linie die Bedingungen entscheidend, die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Kaufvertrages vereinbart und dort in Bezug genommen wurden. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Grundstück und im Kaufvertrag steht, dass die Höhe des Kaufpreises oder eine zusätzliche Zahlung davon abhängt, ob für ein bestimmtes Gebäude auf diesem Grundstück ein Pachtvertrag zu bestimmten Konditionen abgeschlossen wird. Die grundlegenden Bedingungen, die für diese Abhängigkeit maßgeblich sind, sind jene, die Sie im Kaufvertrag festgelegt haben.
Auswirkungen späterer Änderungen oder Nicht-Abschlusses
Wenn der im Kaufvertrag genannte Pachtvertrag nicht wie geplant abgeschlossen wird oder wenn er später zu geänderten Konditionen vereinbart wird, hat dies grundsätzlich keine automatischen Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten, die im ursprünglichen Kaufvertrag festgelegt wurden.
- Keine automatische Änderung: Ein Vertrag bindet nur die Parteien, die ihn abgeschlossen haben. Ändert also eine Partei später einen Pachtvertrag, der in Ihrem ursprünglichen Kaufvertrag erwähnt wurde, betrifft das zunächst nur die Parteien des Pachtvertrages. Ihre Rechte oder Pflichten aus dem Kaufvertrag ändern sich dadurch nicht von selbst, es sei denn, diese Änderung ist ausdrücklich und unmissverständlich im Kaufvertrag selbst vorgesehen oder Sie haben der Änderung zugestimmt.
- Schutz der nicht beteiligten Partei: Für eine Partei, die am späteren Pachtvertrag gar nicht beteiligt ist, bedeutet dies einen Schutz. Sie ist in der Regel nicht von den späteren Entscheidungen oder Abweichungen der anderen Parteien betroffen. Ihre im Kaufvertrag gesicherten Rechte bleiben bestehen, auch wenn die Pachtbedingungen sich ändern oder der Pachtvertrag gar nicht zustande kommt.
Wann Änderungen relevant werden können
Eine Abweichung von den ursprünglichen Bedingungen oder der Nicht-Abschluss des referenzierten Pachtvertrages würde Ihre Rechte aus dem Kaufvertrag nur dann beeinflussen, wenn:
- Sie diesen Änderungen ausdrücklich zugestimmt haben. Dies kann durch eine schriftliche Vereinbarung oder eine klare, eindeutige Erklärung Ihrerseits geschehen.
- Der ursprüngliche Kaufvertrag selbst eine spezifische Klausel enthält, die regelt, was passiert, wenn der Pachtvertrag nicht wie geplant abgeschlossen oder geändert wird, und diese Klausel eine direkte Auswirkung auf Ihre Rechte vorsieht.
Kurz gesagt: Was im ursprünglichen Vertrag steht und wie es dort gemeint war, ist der Maßstab. Spätere Anpassungen durch Dritte beeinflussen Sie nur, wenn Sie dem aktiv zustimmen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Zusatzvergütung
Eine Zusatzvergütung ist eine vertraglich vereinbarte zusätzliche Zahlung, die über einen festen Kaufpreis hinausgeht und meist von einem bestimmten Erfolg oder Ertrag abhängt. Im vorliegenden Fall bezieht sich die Zusatzvergütung auf einen Anteil an der Pacht, die aus dem Betrieb von Windkraftanlagen auf einem Grundstück erzielt wird. Diese Zahlung soll die Verkäufer am wirtschaftlichen Nutzen beteiligen, der durch die Nutzung des Grundstücks für Windkraftanlagen entsteht. Anders als eine feste Summe ist eine Zusatzvergütung variabel und kann von der weiteren Nutzung oder den erzielten Erträgen abhängen.
Beispiel: Wenn Sie ein Grundstück verkaufen und sich zusätzlich dazu vertraglich einen Teil der Einnahmen aus der Vermietung der darauf errichteten Anlagen sichern, spricht man von einer Zusatzvergütung.
Pachtvertrag
Ein Pachtvertrag ist ein spezieller Mietvertrag, bei dem der Verpächter dem Pächter nicht nur die Nutzung einer Sache (z. B. Grundstück oder Anlage) gestattet, sondern zusätzlich auch die Fruchtziehung oder sonstige Nutzen zulässt, also Erträge aus der Sache. Im gegebenen Fall setzt sich die Zusatzvergütung aus einer Beteiligung an den Pachterträgen zusammen, die aus dem Windkraftbetrieb auf dem Grundstück resultieren (§ 3 des Pachtvertrags W.). Entscheidend ist, dass der ursprüngliche Kaufvertrag Rechte und Pflichten aus einem bestimmten Pachtvertrag übernimmt, welcher die Grundlage für die Ermittlung der Zusatzvergütung bildet.
Beispiel: Sie verpachten Ihr Feld einem Landwirt nicht nur zur Nutzung, sondern erhalten dafür auch einen Anteil der Ernte als Pacht.
Ergänzende Vertragsauslegung
Die ergänzende Vertragsauslegung ist eine juristische Methode, die bei einem Vertragsmangel oder einer sogenannten Vertragslücke angewandt wird – also wenn ein Vertrag einen bestimmten Fall nicht ausdrücklich regelt. Dabei versucht das Gericht herauszufinden, was die Parteien vernünftigerweise und redlicherweise vereinbart hätten, wenn sie die Situation bei Vertragsschluss bedacht hätten. Im vorliegenden Fall wurde die ergänzende Vertragsauslegung angewandt, um zu klären, wie die Parteien die Zusatzvergütung im Fall des Austauschs der Windkraftanlagen geregelt hätten.
Beispiel: Ein Kaufvertrag regelt nicht, was passiert, wenn ein Grundstück wegen Neubebauung vor Ablauf der ursprünglich geplanten Pachtzeit nicht mehr genutzt werden kann. Das Gericht interpretiert dann den Vertrag so, wie es den gemeinsamen Willen der Parteien am ehesten widerspiegelt.
Auskunftsanspruch
Ein Auskunftsanspruch ist das Recht, von einer anderen Vertragspartei bestimmte Informationen zu verlangen, die zur Durchsetzung oder Prüfung eines eigenen Anspruchs erforderlich sind. Hier geht es um die Frage, ob die Verkäufer Einsicht in die neuen Pachtverträge oder Einnahmen der neuen Windkraftanlagen verlangen können, um ihre Zusatzvergütung zu berechnen. Das OLG lehnte dies ab, weil die vertraglich vereinbarte Zusatzvergütung an den ursprünglichen Pachtvertrag gebunden und durch eine Obergrenze definiert ist, sodass keine weiteren Informationen über die aktuellen Einnahmen nötig sind.
Beispiel: Wenn Sie einen Anteil am Umsatz erhalten, haben Sie unter Umständen das Recht zu erfahren, wie hoch dieser Umsatz tatsächlich ist, um Ihren Anteil korrekt zu berechnen.
Planwidrige Regelungslücke
Eine planwidrige Regelungslücke liegt vor, wenn ein Vertrag für einen vorhersehbaren, aber nicht ausdrücklich geregelten Fall keine gültige Regelung enthält und diese Lücke offensichtlich von den Vertragsparteien übersehen wurde. Im vorliegenden Fall gab es keine Regelung dafür, was bei einem Austausch der Windkraftanlagen aufgrund von Unrentabilität zu gelten hat. Diese Lücke wurde vom OLG als planwidrig eingestuft, da die Parteien den Fall wohl nicht bedacht hatten und eine vernünftige ergänzende Regelung notwendig war, um den Vertrag fortzuführen.
Beispiel: Ein Mietvertrag regelt nicht, wer für defekte Heizungen zuständig ist, obwohl dies bei Einzug absehbar war. Das Gericht ergänzt den Vertrag so, wie es den Interessen beider Parteien am besten gerecht wird.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 15 Kaufvertrag in Verbindung mit § 3 Ziffer 1 Pachtvertrag W.: Regelt die Zusatzvergütung als hälftigen Anteil an der Pacht für zwei Windkraftanlagen nach dem ursprünglichen Pachtvertrag. Diese Grundlage definiert explizit Höhe und Berechnung der Zahlungen an die Verkäufer. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Anspruch der Verkäufer auf Zusatzvergütung beruht direkt auf dieser vertraglichen Bezugnahme und bleibt grundsätzlich bestehen, allerdings begrenzt auf die Bedingungen des ursprünglichen Pachtvertrags.
- Grundsatz der ergänzenden Vertragsauslegung (§ 157 BGB): Bei planwidriger Regelungslücke wird ermittelt, was die Parteien bei Kenntnis der Lücke vereinbart hätten, um Vertragszwecke und Interessen zu wahren. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Da der Vertrag keinen Fall des Austauschens von Anlagen bei mangelnder Wirtschaftlichkeit behandelte, ergänzte das OLG die Vereinbarung, um den Fortbestand der Zusatzvergütung trotz moderner Anlagen zu sichern.
- § 2 Pachtvertrag W. (technische Lebensdauer und Beendigung): Bestimmt, dass die Beteiligung an der Pacht endet, wenn Anlagen das technische Ende (Lebensdauer) erreichen und Fundamente entfernt werden. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG stellte klar, dass die technische Lebensdauer nicht erreicht wurde und die Fundamente blieben, weshalb kein automatisches Ende der Zusatzvergütung eintrat.
- Vertragliche Bezugnahme und Zweckbindung der Zusatzvergütung: Die Höhe der Zusatzvergütung ist auf die Mindestpacht aus dem ursprünglich vereinbarten Pachtvertrag W. beschränkt, eine Anpassung an neue Pachtverträge ist nicht vorgesehen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Trotz neuer, leistungsstärkerer Anlagen kann die Vergütung höchstens auf Grundlage des alten Vertrags berechnet werden; eine dynamische Anpassung oder Erhöhung wird abgelehnt.
- § 3 Ziffer 2 Pachtvertrag W. (Anpassungsregelung bei abweichender Anlagengröße): Regelt die Anpassung der Mindestpacht bei Änderung der Anlagengröße, wurde aber im Kaufvertrag nicht referenziert. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Da diese Regelung im Kaufvertrag nicht aufgenommen wurde, entfällt eine dynamische Rückwirkung auf geänderte technische Anlagen und somit eine Erhöhung der Zusatzvergütung.
- Auskunftsanspruch (insb. §§ 242, 257 BGB analog): Berechtigt zur Einsicht in Vertragsunterlagen, soweit für die Durchsetzung rechtlicher Ansprüche notwendig. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Zusatzvergütung auf den alten Mindestpachtkonditionen basiert, sind aktuelle Pachtverträge und Ertragsdaten der neuen Anlagen für die Berechnung irrelevant, folglich besteht kein Anspruch auf Auskunft.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Schleswig-Holstein – Az.: 12 U 35/24 – Urteil vom 26.02.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.